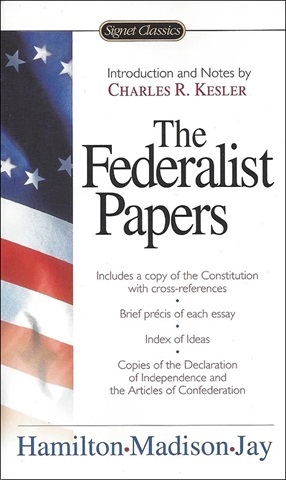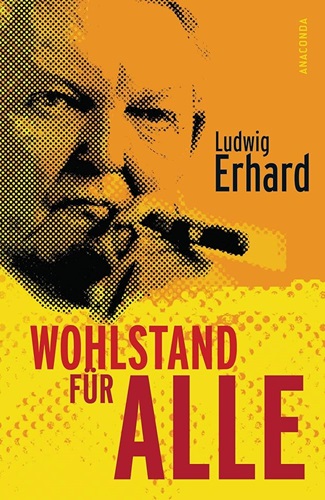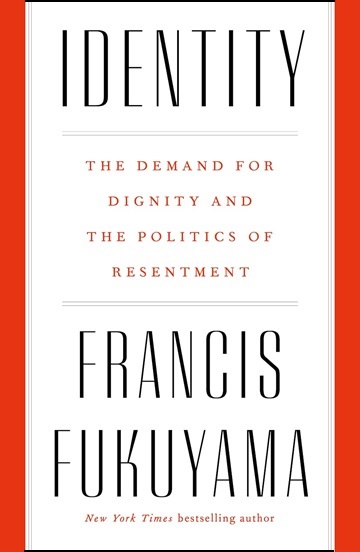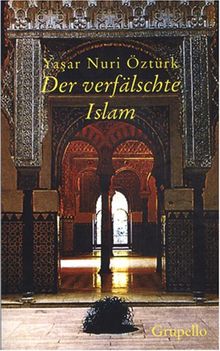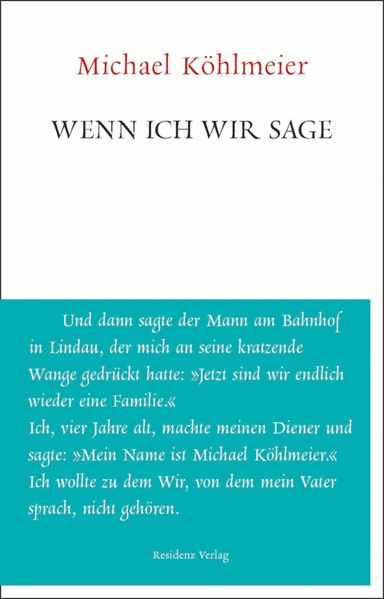Leider der falsche Autor für dieses wichtige Thema – Was eigentlich hätte gesagt werden müssen
Der Grundgedanke dieses Buches ist genial, überaus legitim und längst überfällig: „Der Osten“, also das Gebiet der ehemaligen DDR mit ihren Bürgern, wird vom Westen völlig falsch wahrgenommen, deshalb fehlinterpretiert und außerdem systematisch benachteiligt. Eine innere Einheit Deutschlands ist heute so weit entfernt wie der Mond.
Besonders erschreckend sind die faktischen Benachteiligungen, unter denen der Osten bis heute zu leiden hat, von denen man in den von Wessis beherrschten Medien jedoch nie etwas erfährt: So rekrutiert sich das Führungspersonal in Universitäten, Behörden, aber auch in privatwirtschaftlichen Unternehmen bis heute weitgehend aus Wessis. Es ist leider nicht so, dass Wessis nur vorübergehend die Leitungsfunktionen übernahmen, um die neuen Bundesländer auf demokratischen Kurs zu bringen, sondern bis heute wird auch der Führungsnachwuchs weitgehend aus Wessis rekrutiert. Das ist ein ernstes Problem. Ebenso ein Problem ist natürlich, dass die Balance zwischen den Geschlechtern in manchen ostdeutschen Regionen ernsthaft aus dem Gleichgewicht gekommen ist, weil insbesondere viele junge Frauen in den Westen gegangen sind. Oder dass die Vermögensbildung im Osten nicht in Gang gekommen ist. Schließlich muss man auch lesen, dass es zwar einen Beschluss der Bundesregierung gab, Bundesbehörden bevorzugt im Osten anzusiedeln, aber anders als der naive Wessi denkt, wurde dieser Beschluss offenbar schlicht ignoriert: Ein Skandal von vielen.
Aber auch in der Wahrnehmung des Ostens durch westdeutsche Politiker, Journalisten und Intellektuelle hat dieses Buch eine lange Liste von erschreckenden Anekdoten zu bieten. Die Ossis seien dumm, faul, rechtsradikal und moralisch verdorben, und all das verdanke sich der sozialistischen Indoktrination, von der sich die Ossis innerlich nicht lösen könnten. Es ist niederdrückend, all diesen bestenfalls halbwahren Unsinn noch einmal in geballter Form vor Augen geführt zu bekommen.
Kritik
Leider bleibt Dirk Oschmann bei diesem Befund stehen. Er sagt nicht, welches denn die Lebenslügen des Westens sind. Er sagt fast nichts dazu, wie der Osten denn besser wahrgenommen werden sollte. Warum das so ist, und was zum Westen und zum Osten eigentlich hätte gesagt werden müssen, dazu jetzt mehr.
Kritik – Chaotische Polemik
Dirk Oschmann hat sein Werk als reine Polemik angelegt. Er macht gar keinen Hehl daraus, dass er die Sache einseitig betrachtet, er macht Polemik vielmehr zum Prinzip, sogar explizit mit dem biblischen Satz: „Auge um Auge.“ (S. 194). Das schadet aber der Glaubwürdigkeit des Unterfangens gewaltig, denn wer mit gleicher Münze heimzahlt, kann nicht mehr von sich behaupten, besser zu sein als der andere. Und der Leser ahnt, dass vieles einfach nur übertrieben, schief oder auch ganz falsch ist.
Hinzu kommt, dass Oschmann seine Polemik zuerst nur als Artikel in der FAZ veröffentlicht hatte. Diesen FAZ-Artikel hat er nun zu einem Buch angereichert, in dem er zahlreiche Vorworte und Vorbetrachtungen vorangestellt sowie zahlreiche Nachworte und Nachbetrachtungen nachgeschoben hat. Irgendwie geht der ursprüngliche Artikel in diesen vielen Nach- und Vorbauten etwas unter, und eine Systematik in der Ordnung der vorgebrachten Inhalte ist nicht mehr erkennbar. Das führt dazu, dass dem Leser im Laufe der Lektüre außer der ständigen Polemik wenig im Gedächtnis haften bleibt, weil ihm kein Ordnungsrahmen angeboten wird, anhand dessen er sein Gedächtnis hätte organisieren können.
Kritik – Ein linksgrüner Anywhere verteidigt den Osten?
Dankenswerterweise hat Dirk Oschmann zahlreiche Angaben zu seiner eigenen Biographie, seinen Lebensumständen und seinen Ansichten eingeflochten. Es wird deutlich, dass Dirk Oschmann, obwohl er als einer der wenigen Professoren mit Osthintergrund immer wieder zu diesem Thema befragt wird, eigentlich alles andere als ein typischer Ossi ist.
Dirk Oschmann hat in den USA studiert und lebt heute in Leipzig in der Innenstadt in einer Altbauwohnung und wählt – horribile est dictu – die Grüne Partei (S. 43 f.). Vermutlich besitzt er auch Windrad-Aktien, schickt seine Tochter auf eine teure Privatschule, wo alles ganz buntig ist, und fährt mit dem Lastenfahrrad bei Alnatura zum einkaufen (nein, das steht nicht in diesem Buch, aber dieser Gedanke sei eingeflochten, um zu demonstrieren, wie Polemik funktioniert, oder eben gerade nicht funktioniert). Ganz unverblümt bekennt sich der Autor dazu, ein Anywhere zu sein, er grüßt seine Freunde in der Danksagung als Anywheres, und verkündet das ewig falsche Dogma der Anywheres, dass die Herkunft einen Menschen nicht ausmache (S. 221).
Da staunt der Leser doch: Wie kann jemand, der die Grüne Partei wählt und daran glaubt, dass die Herkunft einen Menschen nicht ausmache, auch nur irgendetwas Kluges über den Westen und den Osten sagen? Denn Westen und Osten sind Herkünfte, und sie prägen uns stark. Darum geht es doch. Das und das Bekenntnis zum Anywhere ist schon sehr radikal. Hier ist Dirk Oschmann nun selbst Repräsentant eines völlig abgehobenen Milieus, eines nur allzu westdeutschen Milieus, dessen soziale Distinktionsmerkmale und Statussymbole er völlig ungeniert einflicht. Wie kann so jemand für den Osten sprechen?
Eine spezifisch linksgrüne Haltung zeigt sich auch bei vielen Polemiken und Kritiken, die Dirk Oschmann vorzubringen hat: So echauffiert er sich z.B. über unsere geliebte deutsche Nationalhymne, die bekanntlich aus der dritten Strophe des Deutschlandliedes besteht, und nur aus dieser, und eine lange, gesamtdeutsche Tradition hat. Aber Oschmann meint, dass die Hymne durch die erste und zweite Strophe „chauvinistisch verseucht“ sei (S. 52). Eine groteske Auffassung, wie man sie von einem westdeutschen Feuilletonisten erwarten würde.
Den Namen „Mitteldeutschland“ für den Raum Thüringen-Sachsen möchte Oschmann ebenfalls nicht akzeptieren, weil dies Polen missfallen könnte, zu dem heute das frühere Ostdeutschland gehört (S. 81). Doch warum sollte man diese historische Bezeichnung nicht beibehalten? Es ist ja bei geographischen Namen recht häufig so, dass sie historisch gewachsen und nicht wörtlich zu nehmen sind. Die Region Franken gehört schon lange nicht mehr zu einem „Frankenreich“ und auch Frankreich ist kein „Reich der Franken“ mehr. Zudem leben in Sachsen überhaupt keine Sachsen, denn der Name „Sachsen“ wurde nur durch die Herrscherfamilie auf dieses Land übertragen, ähnlich wie der Name „Preußen“ auf ganz Brandenburg-Preußen. Wo fängt man da an, wo hört man auf? Es ist kaum vorstellbar, dass die von Oschmann geplante Sprachbereinigung im Osten auf Akzeptanz stoßen würde. Bei manchen Besserwessis schon eher. Aber wollte sich Oschmann nicht für den Osten in die Bresche schlagen?
Auch der Wiederaufbau des Berliner Schlosses anstelle des „Palastes der Republik“ ist ihm ein Greuel (S. 54). Wie wenn das Kaiserreich mit der Diktatur der DDR auf einer Stufe stünde: Oschmann fragt allen Ernstes, ob denn nun dieses Kaiserreich die bessere deutsche Vergangenheit sei, an die es anzuschließen gilt? (S. 55) Selbstverständlich ja! Wie kann er es wagen, diese Frage auch nur zu stellen! An das Kaiserreich nicht anschließen zu wollen, das hieße ja nichts anderes, als dass man die Geschichte überhaupt und als solche abservieren will. Denn Dirk Oschmann wird wohl kaum plausibel machen können, warum man an das Kaiserreich nicht anschließen dürfen soll, an die Metternich-Ära oder das Heilige Römische Reich Deutscher Nation aber doch? Das wäre ja nur albern. Albern, wie es Westdeutsche oft sind, wenn es um die Nation geht.
Oschmann übersieht auch völlig, dass manches westdeutsche Unternehmen, das einst im Osten gegründet worden und wegen des Sozialismus in den Westen geflohen war, nach 1989 soziale Verantwortung bewies und wieder an seinem alten Standort im Osten investierte – doch für Oschmann gibt es von Seiten westdeutscher Unternehmen nur Profitgier und Ausbeutung (S. 114 ff.). Überhaupt sieht Oschmann unsere Gesellschaft heute als eine „pervers profitorientierte Konsum- und Freizeitgesellschaft“ (S. 190). Wie gestört muss die Wahrnehmung der Wirklichkeit sein, um solche maßlosen Sätze zu formulieren? Und wie westdeutsch?
Den regional pay gap zwischen Ost und West möchte Oschmann „endlich“ (!) schließen, genauso wie den sattsam bekannten gender pay gap (S. 116). Dass die Idee, diese Lohnunterschiede „endlich“ – also vollständig – zu schließen, eine radikale und unrealistische Forderung ist, weil es nämlich nicht nur Ungerechtigkeiten, sondern auch legitime und unüberwindbare Gründe für gewisse Lohnunterschiede gibt, scheint Oschmann nicht bewusst zu sein.
Das Lieferkettengesetz, ein weiteres völlig verfehltes Bürokratie-Monstrum aus der Mottenkiste der linksgrünen Utopie, begrüßt Oschmann naiv (S. 115). Hingegen verurteilt Oschmann, dass westliche Unternehmen in Bangladesch investieren (S. 115, 132). Dass er Ländern wie Bangladesch damit die Möglichkeit zur wirtschaftlichen – und sozialen! – Entwicklung abspricht, übersieht Oschmann geflissentlich.
Schließlich findet das ganze Buch hindurch ein ständiges namedropping linker und – oft genug – westdeutscher Autoren statt, von Jürgen Habermas bis Axel Honneth, und ganz abseitig und deshalb umso bezeichnender z.B. Per Leo.
Kritik – Keine Kritik an westdeutschen Lebenslügen
Dirk Oschmann wirft dem Westen eine völlig falsche Perspektive auf den Osten vor, aber in Wahrheit unterlässt Oschmann es vollständig, dem Westen seine eigenen, westdeutschen Lebenslügen vorzuhalten. Dabei hätte er dazu gerade als Germanist eine wunderbare Steilvorlage durch einen westdeutschen Literaten gehabt: Denn im Jahre 1988, nur ein Jahr vor dem Fall der Mauer, publizierte kein geringerer als Martin Walser sein Büchlein „Über Deutschland reden“. Darin formulierte Martin Walser gegen den Zeitgeist der alten BRD den Gedanken, dass er sich nicht mit der deutschen Teilung abfinden könne. Martin Walser hätte von Dirk Oschmann zwingend genannt werden müssen, wenn er hätte glaubwürdig über den Westen sprechen wollen. Er hat es nicht getan.
Denn das ist die zentrale Lebenslüge des Westens: Die Flucht aus der nationalen Identität hinein in eine utopische Überidentität von Europa oder der Welt, verkörpert in einem utopischen Glauben an das Gute in EU und UNO. Der Ungeist der alten BRD, der Ungeist der 1980er, der dann zum vorherrschenden gesamtdeutschen Geist wurde und bis heute ungebrochen scheint, ist der Ungeist der Anywheres, zu denen sich Dirk Oschmann selbst bekennt. Aber kein Mensch kann wirklich ein Anywhere sein, niemand kann seine Herkunft einfach abstreifen (und wer wollte das schon?). Wir alle haben unsere kulturellen Herkünfte und wir brauchen sie auch. Eine Befreundung mit der eigenen Lebensrealität, zu der die Nation ganz selbstverständlich dazu gehört, hat noch niemandem geschadet. (Und daran ändert sich überhaupt nichts, bloß weil ein Rechtsradikaler wie Björn Höcke dasselbe sagt, aber etwas anderes meint.)
Zwar spricht Oschmann das Phänomen, dass sich Westdeutsche gerne als Europäer sehen, kurz an, doch nur und ausschließlich als unzulässigen Versuch, die Schuld des Nationalsozialismus abzustreifen (S. 59). Dass es darüber hinaus auch andere gute, bodenständige, realistische Gründe geben könnte, an einer deutschen Identität festzuhalten, kommt Dirk Oschmann nicht in den Sinn. Dirk Oschmann reproduziert auf diese Weise die unsägliche Fixierung des Nationalgedankens auf den Nationalsozialismus. Deutscher ist man unter dieser Perspektive nur noch, wenn es um den Nationalsozialismus geht, sonst aber tunlichst nicht mehr. (Anders als Höcke muss man allerdings daran festhalten, dass der Holocaust als größter Makel unserer Nationalgeschichte sehr wohl einen bleibenden und besonderen Platz in unserer Erinnerungskultur einnehmen muss.)
Und dann packt Oschmann auch noch die olle Kamelle von den alten Nazis in der alten BRD aus (z.B. S. 21, 136 f.). Es war vielleicht einmal eine westdeutsche Lebenslüge, dass es in der BRD keine alten Nazis gab, doch seit ungefähr 1968 läuft die Lebenslüge andersrum: Dass nämlich die BRD praktisch von alten Nazis gegründet wurde. Oschmann steigt voll auf dieses Thema ein, wenn er sagt, dass Fremdenfeindlichkeit auch im Westen verbreitet wäre (S. 133). Nicht zufällig bringt Oschmann an dieser Stelle auch eine überempfindliche Kritik an Günther Oettinger vor (S. 133). Das ist kein Zufall. Denn bei Günther Oettinger geht es in Wahrheit gar nicht darum, dass er ein paar schräge Äußerungen über schlitzäugige Chinesen gemacht hatte, sondern natürlich darum, dass Günther Oettinger einst zu sagen wagte, dass Hans Filbinger, einer der Mitbegründer der Südwest-CDU, kein Nazi war. Denn damit hatte Oettinger an der Macht der westdeutschen Linken gekratzt, die sie über die öffentliche Meinung haben.
Zum Höhepunkt kommt Oschmanns Blindheit über die Lebenslügen des Westens, wo er den Grund für den Erfolg Angela Merkels in ihren „herausragenden machtpolitischenh Fähigkeiten“ sieht (S. 183 f.). Denn nichts könnte falscher sein. Angela Merkel hatte im Grunde nur eine einzige herausragende Fähigkeit, und die ist für unser Thema von höchster Relevanz: Angela Merkel war eine Meisterin darin, sich dem herrschenden westdeutschen juste milieu in Politik und Medien anzupassen. Das Regierungsprinzip von Angela Merkel lautete schlicht: Gehe den Weg des geringsten Widerstandes beim westdeutschen juste milieu aus Politikern, Journalisten und Intellektuellen. Angela Merkel hatte Macht, weil sie diesem Milieu gab, was es wollte. Das Milieu revanchierte sich dafür, indem es Angela Merkel zur Überkanzlerin stilisierte, jede Kritik kleinschrieb, und Merkel auf diese Weise unangreifbar machte. Eine Allianz des Unheils, bei dem das Wohl und der Wille des Volkes gefährlich unter die Räder geriet.
Was hatte man gehofft, als Merkel Kanzlerin wurde: Dass sie endlich so manche westdeutsche Lebenslüge abschneiden würde wie einen alten Zopf. Denn hier kam etwas völlig neues, nämlich eine Frau, noch dazu aus dem Osten. Doch Merkel enttäuschte diese Hoffnungen auf fast schon brutale Weise, indem sie gewissermaßen zur Inkarnation westdeutscher Lebenslügen wurde und den Ungeist der 1980er Jahre bis in die 2020er Jahre hinein konservieren half. Im Windschatten des Kalten Krieges vergaß man sich selbst und die Realität um sich herum, und gab sich Blütenträumen hin. Diese Enttäuschung wurde 2011 von der Autorin Cora Stephan in ihrem Buch „Angela Merkel: Ein Irrtum“ erstmals formuliert. Doch kein Wort davon bei Oschmann.
Kritik – Oschmann folgt westdeutschen Lebenslügen
Warum tut Dirk Oschmann das alles? Die Antwort ist einfach: Weil auch Dirk Oschmann sich, wie Angela Merkel, ganz den Erwartungen eines westdeutschen juste milieu angepasst hat. Er folgt selbst den Lebenslügen der Besserwessis, das ist doch ganz offensichtlich! Wie Dirk Oschmann richtig bemerkt hat, bekommen viele Ossis keine Führungspositionen, weil ihnen der westdeutsche Stallgeruch fehlt. Vielleicht sollte sich Dirk Oschmann in diesem Sinne einmal selbst befragen, warum er es als Ossi zum Professor geschafft hat? Wohl eben deshalb, weil er sich den Erwartungen des westdeutschen juste milieus völlig angepasst hat?
Dirk Oschmann hat keinen Sinn für die deutsche Nation und die deutsche Kultur, sondern für ihn ist Deutschland eher eine Art Verwaltungszone eines utopisch gedachten Weltstaates, oder wenigstens doch EU-Europas. Oschmann möchte, dass sich die Lebensverhältnisse in Ost und West angleichen, ja, aber nur „sozial“. Politisch und kulturhistorisch ist ihm der Osten genauso egal wie der Westen, denn er hat sich schon längst in das Niemandsland der Anywheres verabschiedet. Lokale Kultur ist für ihn vielleicht noch Folklore für Touristen, also Küche und bunte Trachten. Deshalb tun sich die Anywheres mit Multikulti so leicht, weil sie blind dafür sind, dass Kulturen mit wirkmächtigen Weltanschauungen verknüpft sind.
Und so spricht Oschmann auf der letzten Seite seines Büchleins (S. 200), im vorletzten Satz, wo er dann doch noch in radikaler Kürze auf die regionalen Kulturen zu sprechen kommt, nicht von Ländern. Denn Länder sind nicht einfach Regionen und Dialekte. Länder sind politisch bedeutsame weil historisch gewachsene Gegebenheiten, deren Kultur mehr ist als Küche und Trachten. Länder mit ihrer Geschichte und ihren Dialekten sind Identitäten und politische Macht und Nester des Widerstands gegen alle Überstülpungen, die von „oben“ kommen. Der Anywhere Oschmann hat dafür kein Verständnis, denn für ihn kommt das Gute von „oben“, von der EU und der UNO.
Was fehlt – Nation
Bei Dirk Oschmann fehlt jedes positive Nachdenken über Deutschland als Nation. Wie das westdeutsche juste milieu möchte auch Oschmann den Gedanken an eine deutsche Nation am liebsten töten: Deshalb kein Schloss, keine Hymne, keine Geschichte, kein „Mitteldeutschland“ usw. Doch damit tötet er jeden positiven Gedanken an und über sich selbst, bei allen Deutschen, in Ost und West. Damit wird jede Selbstermächtigung untergraben und eine Psychologie der Unterwerfung durch Identitätslosigkeit betrieben.
Oschmann meint, das vereinigte Deutschland hätte eine neue Verfassung gebraucht (S. 52). Was er damit gewiss nicht meint: Eine andere Verfassung. Denn das Entscheidende an einer neuen Verfassung wäre die Debatte darüber gewesen, wie man sich selbst als Nation versteht. Diese Debatte findet bei Oschmann nicht statt. Gar nicht. Deshalb nennt Oschmann als Gründe für eine neue Verfassung auch nur „Demokratietheorie“ und „Symbolik“.
Am Ende sind die Deutschen für Oschmann nur noch die Angestellten in einem Multikulti-Freizeitpark für deutsche Folklore in einem geschichtsvergessenen Disney-Stil (Oktoberfest in Brandenburg, französische Woche bei REWE, Ramadan in der Fußgängerzone), dessen Politik in Brüssel und anderswo von den Anywheres gemacht wird. Wen wundert’s, dass die Leute rebellieren? Man hat ihnen nie eine akzeptable, demokratische Vision von Nation gegeben. Man hat das Thema vollkommen und restlos den Rechtsradikalen überlassen. Und die greifen dankbar zu.
Was fehlt – Preußen
Dirk Oschmann hätte beim Thema Osten ganz zwingend auf den höchst seltsamen Umstand zu sprechen kommen müssen, dass die Länder im Osten vielfach nicht nach historischen Grenzen gebildet worden sind. Das muss doch jedem Betrachter gleich als erstes auffallen! Der aktuelle Zuschnitt der Länder reflektiert die Zerstückelung Preußens durch die Siegermacht Sowjetunion. Von Preußen ist nur noch Brandenburg übrig, mit einem riesigen Loch namens Berlin in der Mitte. Vorpommern gehört heute zu Mecklenburg, was völlig ahistorisch ist. Geradezu grotesk ist, dass der Restzipfel Schlesiens – die „Perle in der Krone Preußens“ – heute ausgerechnet zu Sachsen gehört. Und von einem „großen“ Bundesland namens Sachsen-Anhalt hat man in der ganzen deutschen Geschichte noch nie etwas gehört.
Man stelle sich vor: Ausgerechnet das Bundesland Preußen, ohne dass es Deutschland in seiner heutigen Form gar nicht gäbe, darf nicht existieren. Ob Friedrich der Große oder Immanuel Kant, ob Wilhelm von Humboldt oder Alexander von Humboldt, ob Bismarck oder Gustav Stresemann: Deutschland soll ohne ihr Land auskommen? Ohne preußischen Geist, ohne preußische Rationalität und ihre Beiträge zu Humanismus und Aufklärung? Undenkbar. Deutschland macht ohne Preußen gar kein Bild in der Seele: Hier ist erst der Schlüssel zu allem.
Die Genesung Deutschlands ist ohne die Wiedererrichtung Preußens nicht möglich. Alles, was diesen Schritt blockiert, markiert das Elend Deutschlands: Die irre Idee, man könne sich von der Geschichte verabschieden und zu einer No-Name-Nation werden. Die irre Idee, die ganze deutsche Geschichte wäre ein einziges Präludium zum Holocaust gewesen. Die irre Idee, dass Adolf Hitler der Inbegriff alles Deutschen gewesen wäre, das demzufolge logischerweise zu verfemen und komplett abzuräumen sei. Und last but not least die irre Idee, man könnte sich heute auch vom klassischen Humanismus verabschieden, der gleich im ersten Artikel unserer deutschen Verfassung, dem Grundgesetz, mit dem humanistischen Schlüsselbegriff der „Würde des Menschen“ festgeschrieben ist, als doppelte Erinnerung daran, was Deutschland groß sein ließ, und was niemals verloren gehen darf – hin zu einer Welt, in der der Mensch nur noch eine beliebige, postmoderne Konstruktion ist, ohne Realismus, ohne Rationalität.
In der Autobiographie von Marcel Reich-Ranicki finden wir das Wort „Preußen“ immer wieder. Und zwar positiv konnotiert. Insbesondere das preußische humanistische Gymnasium wird gelobt: Doch die Anywheres dieser Welt wollen das alles abräumen. Alles abservieren. Julian Nida-Rümelin hat Recht mit seinem Urteil über die Anywheres: „Ein antikommunitaristischer Kosmopolitismus hat weder politisch noch ethisch eine Zukunft“.
Nach seiner Wiederrichtung als ganz normalem Bundesland (als was denn sonst?), bestehend nur aus den ostdeutschen Landesteilen Preußens, kann Preußen dann noch einmal den Grenzvertrag mit Polen gegenzeichnen. Damit alle zufrieden sind. Dann wird ein Björn Höcke Preußen auch nicht mehr als beliebig formbare Projektionsfläche für seine kruden Ideen missbrauchen können. Und Deutschland kann endlich normal werden.
Was fehlt – Unterdrückte Wessis
Dirk Oschmann ist so fixiert auf das westdeutsche juste milieu, dass er völlig übersieht, dass es auch im Westen normale Menschen gibt. Normale Menschen, die unter den Lebenslügen und Utopien der Anywhere-Besserwessis ebenso leiden wie die Ossis.
Oschmann hätte sich z.B. fragen können, warum der Lokalpatriotismus im Westen so ausgeprägt ist. Oder der Fußballpatriotismus. Oder der Wirtschaftspatriotismus. Die Antwort ist ganz einfach: Es sind Ersatz- und Ausweichhandlungen der Wessis, die ihren Patriotismus nicht ausleben dürfen und deshalb auf diese Gelegenheiten ausweichen. Auch Militärkultur – allein dieses Wort! – und Pflichtbewusstsein ist den Besserwessis ein Greuel, nicht jedoch den Normalwessis.
Dirk Oschmann hätte sich auch unbedingt mit der westdeutschen Kritik am politischen System der BRD auseinandersetzen müssen, um zu verstehen, dass die Ossis mit mancher Kritik nicht allein sind. Hier wäre ganz zentral das Buch „Wohin treibt die Bundesrepublik?“ des Philosophen Karl Jaspers aus dem Jahr 1966 zu nennen gewesen. Denn hier findet sich alle Kritik am System und an der Parteienoligarchie und dem ganzen Ungeist der BRD aus berufenem Munde formuliert, gültig bis heute. Doch nichts davon, nichts, gar nichts, bei dem Anywhere Oschmann.
Und glaubt Dirk Oschmann etwa, dass die Westdeutschen komplett hinter Angela Merkel und ihrer irren Migrationspolitik standen?! Natürlich nicht! Es war eine rebellische Bürgerversammlung in Hessen, nicht in Sachsen, auf der Walter Lübcke seine unglückselige Rede hielt, in der er u.a. sagte, dass jeder, dem Merkels Migrationspolitik nicht passe, die Freiheit habe, das Land zu verlassen. (Dass er später von Rechtsextremisten kaltblütig ermordet wurde, macht daran nichts besser. Walter Lübcke ist kein Vorbild.) Und Hans-Georg Maaßen, der die Lebenslügen von Merkels Migrationspolitik hinterfragte („Hetzjagden“ in Chemnitz) und deshalb als Präsident des Verfassungsschutzes entlassen wurde, stammt aus NRW. Maaßen erzählt, wie er zu Wolfgang Schäuble ging, um Merkel zu stoppen. Schäuble hätte geantwortet: Dann zerreißt es die CDU. Worauf Maaßen gesagt haben soll: Deutschland ist mir wichtiger als die CDU. Schließlich wollen wir noch Boris Palmer nennen, den grünen Querdenker gegen den Zeitgeist und Oberbürgermeister in Tübingen in Baden-Württemberg.
Ja, Dirk Oschmann erwähnt tatsächlich die Tradition des Querdenkens aus dem deutschen Südwesten! Aber nicht im Sinne einer lobenden Anerkennung dieser Tradition, sondern abqualifizierend, wie es Besserwessis tun, denn er spricht vom deutschen Südwesten als dem „Eldorado für Verschwörungstheoretiker.“ (S. 100)
Was fehlt – Der Osten im Westen
Man hätte auch fragen können, ob nicht manches, was heute als westdeutsch gilt, womöglich gar nicht westdeutsch ist, sondern einfach nur gesamtdeutsch? Nur, dass der Osten diese Eigenschaft in der Zeit der DDR abgelegt hatte? Man könnte z.B. fragen, ob manche Traditionen der preußischen Verwaltung in NRW besser überdauerten als im Osten? Ostdeutsche würden sich sicher sehr viel leichter mit westdeutschen Gepflogenheiten anfreunden können, wenn sie wüssten, dass diese etwas zurückbringen, was einst auch im Osten so war. Die Demokratie als solche gehört ja auch zu diesen Dingen: Demokratie ist nichts westdeutsches, sondern etwas gesamtdeutsches.
Und dann hätte man noch fragen können, ob nicht so mancher Wessi in Wahrheit ein Ossi ist. Denn nicht wenige Ossis endeten nach 1945 im Westen. Eine weitere westdeutsche Lebenslüge lautet, dass sich alle Vertriebenen assimiliert hätten und gewissermaßen „verschwunden“ wären. Doch ist das so? Zweifel sind angebracht. Die Nachkommen der Vertriebenen tragen oft von ihnen selbst unerkannt ein geistiges Erbe in sich. Aber auch die Erfahrung der Vertreibung prägt sie, denn diese wirkt psychisch über Generationen hinweg, wie die Forschung zeigen konnte. Es wäre wert, nach dem Osten im Westen zu suchen: Gab und gibt es Ossis im Westen, die Westdeutschland auf eine Weise geprägt haben, die eher ostdeutsch ist?
In seiner Rede „Die Ehre Preußens“ von 1951 sagte Hans-Joachim Schoeps mit Bezug auf die westdeutsche BRD: „Wichtiger ist der große Bestand an preußischem Ethos und Pflichterfüllung, der in unserem Volke noch lebendig ist und nicht nur von den ostdeutschen Heimatvertriebenen gehütet wird. Wenn diese den nicht in sich hätten, dann stünden wir nämlich angesichts der Unrechtsordnung in der Besitzgüterverteilung schon seit langem in einer blutigen Sozialrevolution. Ich kann nur sagen: Gott möge geben, daß unsere Bundesregierung diese Kräfte zu nutzen und diese Traditionen zu wahren und zu erneuern versteht.“
Und umgekehrt: Ist womöglich der Osten unvermutet von manchen westdeutschen Traditionen geprägt? Erich Honecker kam bekanntlich aus dem Saarland. Bertolt Brecht aus Bayern. Anna Seghers aus Mainz. Angela Merkel aus Hamburg. Und Karl Marx aus Trier.
Fazit
Dirk Oschmann hat eine notwendige Polemik lanciert, doch gelungen ist sie nicht. Denn Oschmann ist als bekennender Anywhere der falsche Autor für dieses Thema. Deutschland und seine Geschichte, seine Länder und die Nation als ganzes sind für Oschmann nichts, worüber er wirklich gerne reden würde. Und etwas chaotisch ist das Buch noch dazu. Wir Deutschen jedoch lieben die Ordnung.
Bewertung: 2 von 5 Sternen.