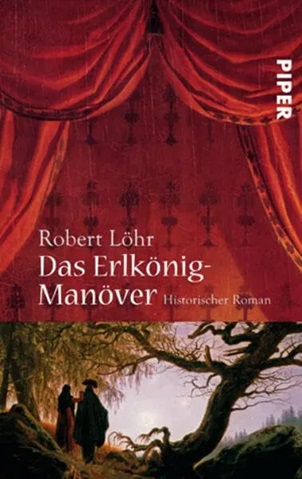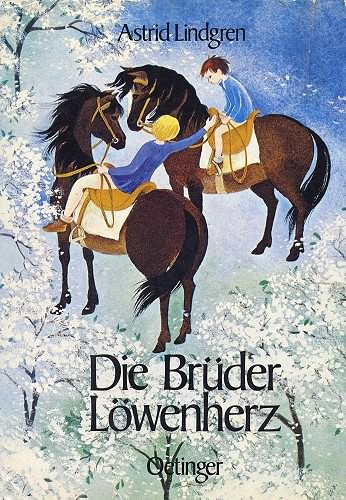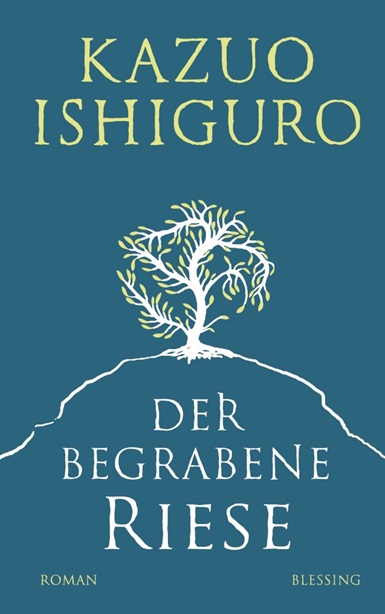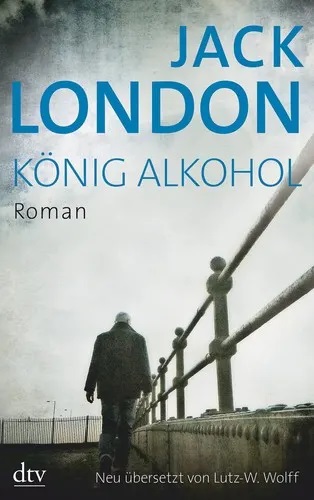
Lesenswert: Gesellschaftskritik und Weltschmerz eines Alkoholikers
Das autobiographische Buch „König Alkohol“ (original: „John Barleycorn – Alcoholic Memoirs“) von Jack London beschreibt, wie der Lebensweg des Autors aus verschiedenen Gründen immer von Alkohol begleitet war, bis in die Sucht hinein, die den Autor bald nach der Veröffentlichung des Buches im Alter von 40 Jahren in den Tod führen sollte. Überraschenderweise steht dabei weniger die Alkoholsucht als solche im Zentrum des Buches, sondern vielmehr die „verschiedenen Gründe“ für das Trinken. Diese Gründe lassen sich im wesentlichen in drei Themenbereichen zusammenfassen:
Thema (1): Soziale Akzeptanzrituale, die für sich allein betrachtet sinnlos, albern oder sogar schädlich sind (Gessler-Hut-Rituale): In diesem Buch ist es das gemeinsame Trinken von Alkohol, durch das man als „Mann“ anerkannt wird. Aber es sind andere Beispiele von Ritualen aus unserer heutigen Lebenswelt denkbar, die zur Akzeptanz in gewissen Milieus führen: Vom Reden und Prahlen über Fußball und Autos, über die Verfemung von Microsoft, Wehrdienst und George W. Bush, bis hin zum gemeinsamen Bordell-Besuch. Das Problem ist: Entweder man macht mit, oder man bleibt einsam und erfolglos. Und wer mitmacht, gewöhnt sich daran.
Thema (2): Die Entfremdung des lesenden Menschen von den „normalen“ Menschen durch seine Bildung. Das Problem ist: Der Abgrund zu den weniger gebildeten Menschen ist auch durch ein gewolltes Herablassen auf deren Niveau nicht wirklich überbrückbar. Man bleibt innerlich einsam, und wird nur noch von wenigen, einzelnen Mitmenschen wirklich verstanden, die leider schwer zu finden sind.
Thema (3): Desillusionierungen über Gesellschaft, Mitmenschen, Religion und Weltanschauung, die zu einer verschärften Form der Sinnfrage führen (Weltschmerz, Weltekel). Das Problem ist: Entweder man findet neue, eigene Antworten auf die Sinnfrage, oder man endet in Verzweiflung und Zynismus.
Jack London hatte sich als junger Mann dem Ritual des gemeinsamen Alkoholtrinkens hemmungslos hingegeben, um Abenteuer und Kameradschaft zu erleben, was ihn für die Sucht vorbereite. Später wurde ihm die Herablassung auf das Niveau der weniger gebildeten Menschen durch den Alkohol erleichtert. Er hatte aber auch jene wenigen, einzelnen Menschen gefunden, mit denen er sich ganz ohne Alkohol auf Augenhöhe unterhalten konnte, darunter seine Ehefrau. Bis zu diesem Punkt kann noch nicht von einer Sucht gesprochen werden.
In die Sucht geriet Jack London durch die Sinnfrage. Jack London war Sozialist und vor allem Materialist. Anders als die meisten Materialisten hatte er die Folgerungen dieser Weltanschauung jedoch konsequent zu Ende gedacht, sowie mögliche Alternativen rigoros abgelehnt, so dass er dem Leben keinen Sinn mehr abgewinnen konnte. Alles wurde schal und sinnlos für ihn, und seine Perspektive auf die Welt und die Menschen wurde zynisch. Es gab offenbar nichts mehr, was seinen Geist durch Sinnhaftigkeit in Stimmung bringen konnte: Kein Streben nach Wissen, kein Suchen nach etwas Unbekanntem, keine Anschauung des Schönen, und zuletzt vielleicht auch kein echter Glaube mehr an die Möglichkeit gesellschaftlicher Verbesserungen.
Um sich gegen Pessimismus und Zynismus immer wieder in Stimmung zu bringen, musste Jack London zur Flasche greifen, und verfiel auf diese Weise schrittweise der schleichenden Sucht.
Man könnte es auch andersherum deuten: Möglicherweise führte der langjährige, „soziale“ Alkoholkonsum zu einer Depression, und diese Depression war es, die eine rationale, positive Antwort auf die Sinnfrage verhinderte („Weiße Logik“ des Alkohols), und das wiederum ließ Jack London am Ende freiwillig zur Flasche greifen. Ob nun eher eine kranke Psychologie (Depression wegen Alkoholkonsum), oder eher eine falsche Philosophie (Materialismus mit allen Konsequenzen) die Ursache für das finale Scheitern waren, wird sich wohl nie mehr ganz klären lassen. Das eine schließt das andere ja keineswegs aus.
Am Ende des Buches behauptet Jack London überraschend, dass er die „Weiße Logik“ überwinden konnte, indem er gelernt habe, der Sinnfrage auszuweichen. Trinken würde er allerdings dennoch hin und wieder, weil er sich daran gewöhnt hatte, Alkohol mit der guten Erinnerung an Geselligkeit und Kameradschaft in Verbindung zu bringen. Das ist alles andere als ein überzeugender Schluss! Denn erstens kann man der Sinnfrage nicht auf Dauer ausweichen. Und zweitens befindet sich Jack London damit immer noch in dem Zustand, Alkohol gerne zu trinken, um eine angenehme Stimmung hervorzurufen.
Bewertung: 5 von 5 Sternen.
(Erstveröffentlichung auf Amazon am 22. Mai 2018)