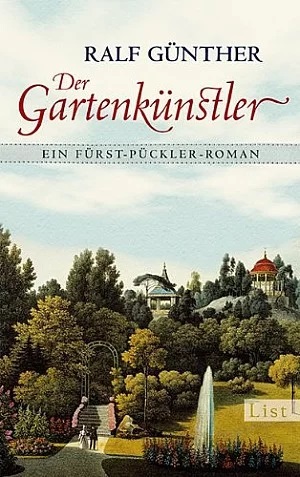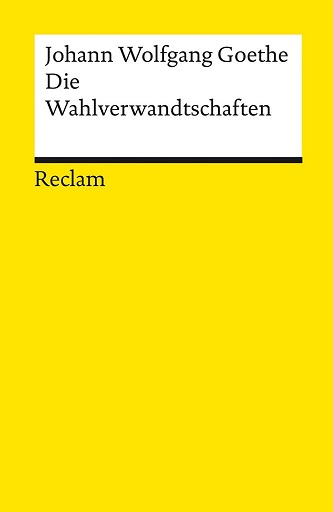„Werther für Erwachsene“ – Starker Anfang, starkes Nachlassen, interessante Nebenthemen
Goethes Roman „Die Wahlverwandtschaften“ von 1809 handelt vom Wechselspiel der Gefühle in den Beziehungen zwischen Männern und Frauen; wie sie sich zu Paaren finden, oder wieder lösen, um sich in anderer Kombination neu zu verbinden, und welche subtilen und teils romantischen, teils unromantischen Antriebe und Motive hinter all dem stecken.
Im ersten Drittel geht es sehr subtil zu, und das ist auch der starke Teil des Romans: Im Zentrum steht das Paar Eduard und Charlotte, die glücklich verheiratet auf einem Schloss wohnen. Doch bereits das Zustandekommen dieser Idylle war nicht geradlinig: Schon als Jugendliche waren sie einander zugetan, dann aber in andere Ehen gekommen, und nur das Schicksal hat es ihnen erlaubt, am Ende doch noch zusammen zu kommen. Dabei hatte Charlotte jedoch zunächst versucht, Eduard mit ihrem jüngeren Patenkind Ottilie zu verkuppeln. Doch Eduard hatte nur Augen für Charlotte, und so kam diese scheinbar perfekte Ehe zustande.
Als Eduard seinen Freund, einen Hauptmann, und Charlotte Ottilie zum dauerhaften Mitwohnen in ihr Schloss einladen, kommt es zu weiteren Wechselfällen der Gefühle: Eduard und Ottilie fühlen sich zueinander hingezogen, und ebenso Charlotte und der Hauptmann. Dabei sind Eduard und Ottilie die eher schlichteren Gemüter, während Charlotte und der Hauptmann sich an Feinsinnigkeit gleichen, und über Eduard und Ottilie lächeln. Dem entsprechend verfallen Eduard und Ottilie ihren Leidenschaften, während Charlotte und der Hauptmann ihre Beziehung platonisch halten.
Der Roman verflacht zusehends, als die Leidenschaft zwischen Eduard und Ottilie irrational aufflammt und gewissermaßen kindisch wird, und bis zum Ende des Romans nicht mehr zur Vernunft kommt, sondern sich auf eine unnötige Weise zu einer überromantischen Tragik steigert. Gegen Ende stört es einfach nur noch, und man möchte nur noch möglichst schnell zum unvermeidlichen und offensichtlichen Ende kommen, wenn die „heilige“ Ottilie sich endlich entschlossen zu haben scheint, auf Eduard zu verzichten, und sie diesen Entschluss dann doch wieder über den Haufen wirft, aber auch das wieder nicht richtig. Oder wenn Charlotte auf die Gefühle von Eduard und Ottilie eine Rücksicht nimmt, die sie nicht verdient haben, die ihnen auch nicht gut tut, und die Charlottens eigenes Schicksal völlig unterpflügt. Das ist dann kein subtiles Seelenleben mehr, sondern Kitsch und Unvernunft. Das ist dann wieder „Werther für weniger erwachsene Leser“, und man fragt sich, warum Goethe seinem Roman diese Wendung gegeben und den größeren Teil seines Romans auf solche Geschehnisse verwendet hat. Hatte er nicht immer darunter gelitten, vor allem als der Autor des „Werther“ zu gelten? Wirklich entfernt davon hätte er sich mit dem größeren Teil dieses Romans nicht.
Vielleicht handelt es sich bei den „Wahlverwandtschaften“ wie bei „Wilhelm Meister“ um einen Roman ohne geradlinigen Plot, der sich spontan und wenig planvoll entwickelt hat, und bei dem zeitweise manches Nebenthema wichtiger wird als die Handlung selbst, so dass sich die Handlung der Präsentation eines Nebenthemas unterordnen muss?
Folgende Nebenthemen werden behandelt:
- Landschaftsgartenbau. Gärtnerei. Architektur. Wandmalerei. Der Hauptmann. Der Architekt. Der Gärtner.
- Chemie: Von hier kommt der Begriff der „Wahlverwandtschaften“, der sich in der damaligen Chemie auf Stoffe bezog, die sich einander unwillkürlich anzogen, deshalb aus vorhandenen Bindungen lösten, und miteinander eine neue Bindung eingingen.
- Diskussion um die Institution der Ehe. Der Graf und die Baronesse. Mittler. Es ist keineswegs ausgemacht, was genau die Meinung Goethes ist.
- Erziehung. Gebote statt Verbote. Der Gehülfe aus der Pension. Mittler.
- Gesellschaftliches Leben. Frechheit siegt. Die Tochter Charlottens.
- Übernatürliche Empfindungen. Wunderglaube. Pendeln. Nanny. Der Begleiter des Lords.
- Diverses: Tableaux vivants. „Dunkle Kammer“ zur Zeichnung von Landschaftsbildern.
Fazit
Das erste Drittel ist ein starker Einblick in das subtile Seelenleben der Menschen. Die Nebenthemen sind interessant. Es ist jedoch kein runder Roman. Die Stärke des ersten Drittels wird den Roman über nicht durchgehalten, und das Abdriften der Handlung ins allzu Romantische, Irrationale, Kitschige stört den guten Eindruck aus dem ersten Teil doch sehr.
Man beachte: Der Roman ist keinesfalls ein Plädoyer für Beliebigkeit und Laisser-faire, als der er von weniger gebildeten Menschen gerne verstanden wird.
Bewertung: 4 von 5 Sternen.
(Erstveröffentlichung auf Amazon am 11. Februar 2022)