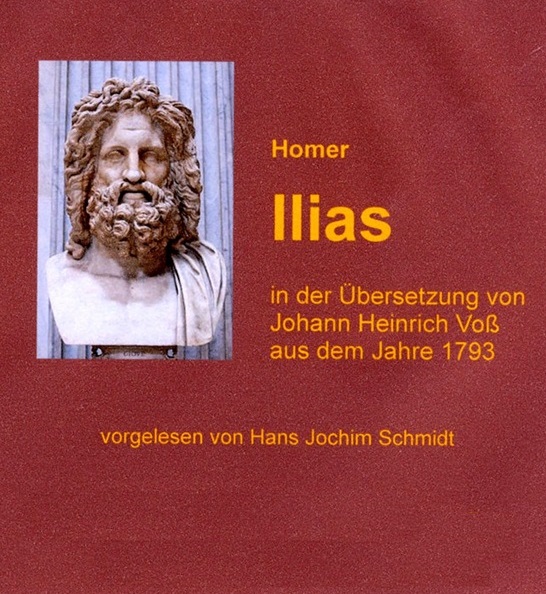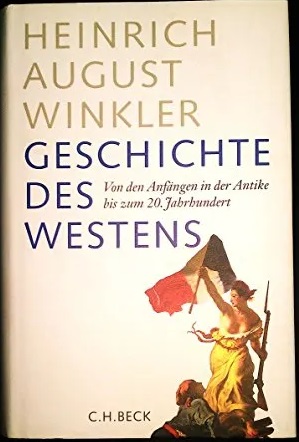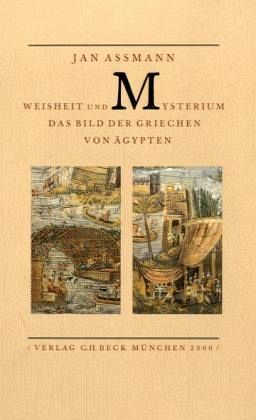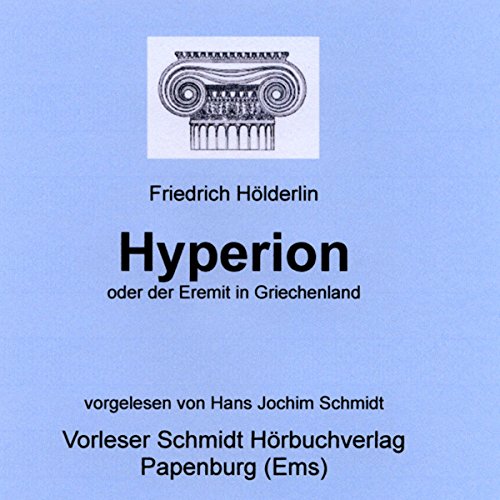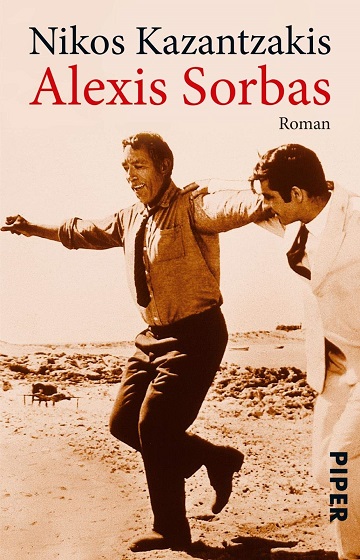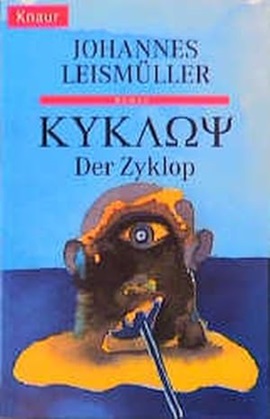
Ein Münchner baut auf einer griechischen Insel ein Haus – doch kein Zyklop, nirgends
Der Roman „Der Zyklop“ von Johannes Leismüller erzählt, wie ein Münchner, der regelmäßig auf einer bestimmten griechischen Insel Urlaub macht, dort eines Tages die Ruine eines Bauernhauses im Hinterland kauft und das Haus neu aufbauen lässt. Wir erleben den Kontakt zu den Einheimischen, dem Wirt Apostolis, den Verkäufern des Hauses, den verschiedenen Handwerkern, dem Popen, aber auch mit anderen Nichtgriechen, die sich auf der Insel niedergelassen haben. Wir sehen, wie das Haus Stück für Stück neu aufgebaut wird, mit allen physischen und bürokratischen Hindernissen auf diesem Weg. Esel transportieren das Baumaterial. Die Mauern müssen der Tradition gemäß aufgeführt werden. Nachbarn klagen die Hälfte einer Mauer ein. Strom, Wasser und Abwasser müssen organisiert werden. Ein kleiner Arbeitsunfall muss versorgt werden, das Unfallopfer wird von der Insel nach Athen geflogen. Der zunehmende Tourismus wird eher störend wahrgenommen.
Immer wieder fliegt der Protagonist zwischendurch zurück nach München. Dort spaziert er durch die Stadt und stellt Vergleiche zu Griechenland an. In den Hofgartenarkaden betrachtet er die Bilder des Griechenlandzyklus von Richard Seewald. Auch Föhnwetter und Bierkultur sind ein Thema. Einmal geht es auch nach Berlin, das damals eine einzige Baustelle war, und einmal nach Paris, wo er auf eine Reisegruppe nach Disneyworld Paris trifft.
Aber auch ganz banale Beobachtungen werden angestellt: Über die Konsumkultur, abgepacktes Fertigessen, über das wahre Leben, oder über typische Momente und Erlebnisse einer Flugreise. Der Protagonist ist verheiratet, managt den Wiederaufbau aber fast völlig ohne seine Frau, so dass diese kaum in Erscheinung tritt und der Protagonist eher wie ein Einsiedler wirkt, der sich fortwährend seine ganz eigenen Gedanken macht.
Der Autor hat ganz offensichtlich einen politisch linksliberalen Drall, ganz dem naiven Zeitgeist der damaligen Schickeria gemäß. Allerdings bleiben alle Überlegungen in diese Richtung sehr an der Oberfläche. Der Autor assoziiert diese Dinge mehr, als dass er darüber nachdenkt. Themen sind hier z.B. die bayerische Politik, die katholische Kirche, die Jugoslawienkriege, Palästinenser und Israelis, griechisch-türkische Rivalitäten, sowie Religion und sexuelle Freizügigkeit. Als Schutzheiligen seines neuen Hauses wünscht sich der Protagonist Sokrates. Umweltschutz ist kaum ein Thema. Klimaschutz gar keines. Das Thema kommt nicht vor. Ebensowenig Flugscham: Es wird viel geflogen in diesem Buch!
Das Buch stammt aus dem Jahr 1999. Es wird noch in Mark bezahlt. Keiner hat ein Handy. Einer der Handwerker gibt das Telefon des örtlichen Cafés als Telefonnummer an. An einer Stelle wird „jemand mit Handy“ als etwas besonderes, als Wichtigtuer und Macher dargestellt. Die linksliberale Haltung des Romans wirkt wie selbstverständlich. „Rechte“ kommen nicht vor, noch nicht einmal als Negativfolie.
Grundsätzlich könnte das Buch ein authentischer Bericht eines Müncheners sein, der tatsächlich ein Haus auf einer griechischen Insel wiederaufbauen ließ, es muss nicht als Roman gelesen werden. Tatsächlich verbrachte der Autor Johannes Leismüller seit den 1950er Jahren einen großen Teil seiner Zeit in Griechenland. Reale Personen, die im Roman auftauchen, verstärken den Realitätseffekt, so z.B. Argyris Marneros, ein Dichter und Fremdenführer auf der Insel Kos, oder Manolis Glezos, der die Hakenkreuzfahne von der Akropolis holte und auf der Insel Naxos geboren wurde. Leismüller verstand sich auch als „europäischer Bürger“, der linksliberale Drall ist auch also ebenfalls authentisch und nicht nur die Fiktion eines Romans.
Ein Zyklop kommt im ganzen Buch nicht vor. An einigen wenigen Stellen werden Vergleiche zu Zyklopen gezogen. Diese sind aber nebensächlich und unzusammenhängend. So wird z.B. eine Insel mit dem Schädel eines Zyklopen verglichen. Die gekaufte Hausruine sieht aus, als ob ein Zyklop auf das Haus getreten sei. Dem wiederaufgebauten Haus wird außerdem ein würfelförmiger Aufbau verpasst, der ebenfalls mit dem Aussehen eines Zyklopen verglichen wird. Aber es wird nichts weiter dazu gesagt oder daraus geschlossen. Der Titel „Der Zyklop“ erscheint eher wie ein Verlegenheitstitel der Marketingabteilung des Verlages. Die überlieferte Mythologie der Zyklopen wird nicht wirklich zum Thema gemacht.
Fazit
Wer erfahren will, wie es ist, in Griechenland nicht nur Urlaub zu machen, sondern dort zu leben und ein Haus zu bauen und in einen nicht-touristischen Kontakt mit den Einheimischen zu kommen, für den kann dieses Buch sehr wertvoll sein. Auch die Vergleiche und Überlegungen sind teilweise wertvoll, hier macht sich jemand Gedanken über alles mögliche, wie wir das alle fortwährend tun, und auch das kann sehr lehrreich sein. Schließlich ist das Buch ein Dokument für eine Zeit, die vergangen ist: Eine Zeit ohne Handys und ohne Euro, als Linksliberale noch ganz unhinterfragt ihre Naivität ausleben konnten. Eine literarische, philosophische oder politische Offenbarung ist das Buch jedoch nicht.
Bewertung: 3 von 5 Sternen.