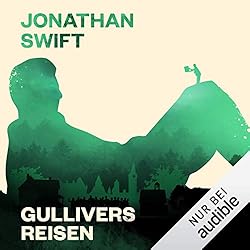
Bissige und unterhaltsame Gesellschaftssatire
Der Roman „Gullivers Reisen“ von Jonathan Swift ist keine schöne Kindergeschichte, als die sie weithin bekannt ist, sondern eine bissige Gesellschaftssatire für erwachsene Leser. Obwohl sie schon 1726 erschienen ist, hält sie auch für den modernen Leser noch manche Überraschung bereit. Im ganzen gelangt der Protagonist auf seinen Reisen zu vier verschiedenen Ländern:
Weithin bekannt sind noch die ersten beiden Länder: Liliput, ein Land von winzig kleinen Menschen, und das entsprechende Gegenteil, Brobdingnag, ein Land von riesenhaften Menschen. Interessant ist, dass immer auch die Vegetation entsprechend kleiner oder größer sein soll. Außerdem sind alle bereisten Länder ziemlich genau auf dem Globus verortet, in Regionen, die damals noch unerforscht waren. In Liliput und Brobdingnag werden vor allem politische Vorgänge aufs Korn genommen, durch Intrigen und Machtspiele, in die der Protagonist gerät.
Für den modernen Leser eher amüsant ist dann die Insel Laputa, eine Insel von Gelehrten, die im Grunde Fachidioten sind, und von Dienern begleitet werden, um sie notfalls aus ihrer inneren Versunkenheit zu wecken. Hier sind wiederum die „Projektmacher“ am besten getroffen: Leute, die bewährte Vorgehensweisen z.B. in der Landwirtschaft oder beim Hausbau zugunsten irrwitziger Ideen abschaffen, die für modern gelten. Man kennt das auch heute.
Im Land der Houyhnhnms schließlich begegnet der Protagonist einem Volk von sprechenden, menschenähnlich lebenden Pferden, die wahrhaft edelmütig gesinnt sind und praktisch den Idealstaat Platons realisiert haben. Alles wird durch Vernunft geregelt, nichts durch Emotion. Zugleich findet er dort aber auch verwilderte Menschen vor, die sogenannten Yahoos, die zu wilden, trügerischen Tieren geworden sind. An ihnen werden grundlegende Eigenschaften der Menschen kritisiert, und der Protagonist tut sich schwer, nach dieser Reise wieder mit normalen Menschen zu verkehren, ohne sich zu ekeln. Und man kann es nachvollziehen.
Interessant am Rande: In Laputa wird eine Maschine vorgestellt, die durch die Kombinatorik von Worten in verschiedenen flektierten Formen beliebige Werke hervorbringen soll. Das erinnert an die Ars Magna des Raimundus Lullus, und an die Bibliothek von Babel von Jorge Luis Borges.
Bewertung: 5 von 5 Sternen.
(Erstveröffentlichung auf Amazon am 28. April 2021)

