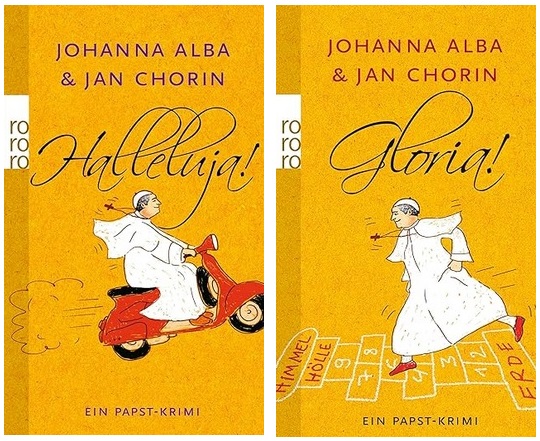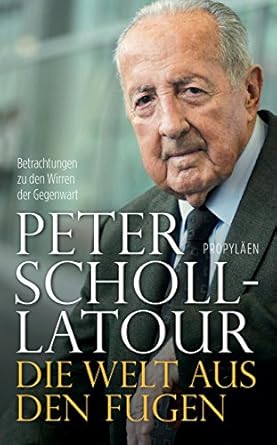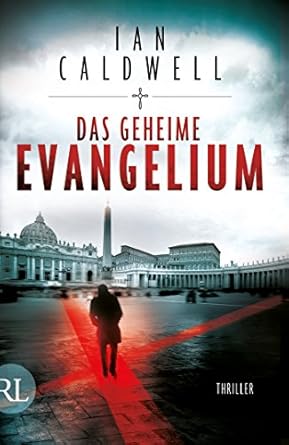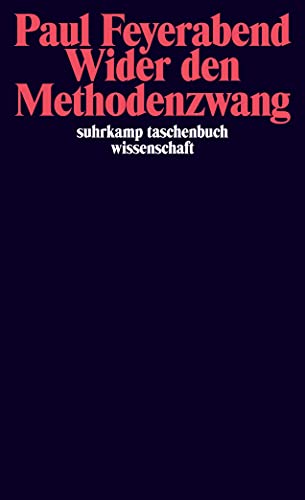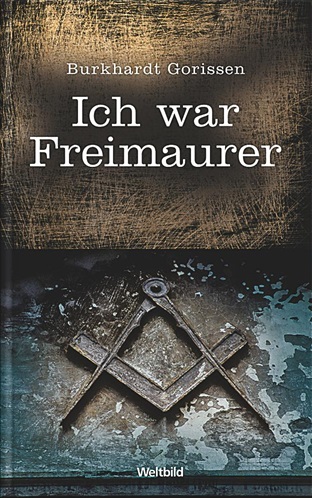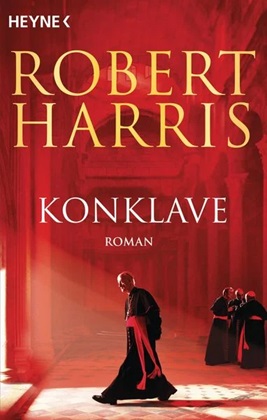Den Rationalismus schärfen, festigen und im Niveau heben
Das Buch „Wider den Methodenzwang“ von Paul Feyerabend und seine Kritik am Rationalismus, vor allem an Karl Popper, ist ein wichtiges Werk zur Wissenschaftstheorie. Allerdings nicht deshalb, weil es Feyerabend gelingen würde, den Rationalismus zu widerlegen, sondern deshalb, weil dieses Werk für jeden Rationalisten eine große Hilfe dabei sein kann, die Denkfallen eines allzu einfach gedachten Rationalismus zu überwinden.
Die Kritik
Feyerabend wendet sich gegen die falsche Auffassung, dass man neue Erkenntnisse gewissermaßen zwangsläufig „ausrechnen“ könnte, wenn man nur von den Gegebenheiten ausgehend rational regelgerecht – methodengerecht – weiterdenken würde. Vielmehr sind neue Erkenntnisse gerade dadurch entstanden, dass Forscher die rationalen Regeln ihrer Zeit gebrochen hatten. Rationalität sei gewissermaßen abhängig vom Sprach- und Weltanschauungssystem: Was nach dem alten Paradigma rational war, ist es nach dem neuen nicht mehr, und umgekehrt. Sehr lesenswert Feyerabends Ausführungen zum Welt- und Menschenbild der homerischen Epen. Feyerabend zeigt auch sehr überzeugend, dass die Theorie der Hexenprozesse im Rahmen der damaligen Theologie und Philosophie sehr rational war. Auch heute unterscheide sich die Wissenschaft nach Auffassung von Feyerabend im Kern nicht von der Kirche und habe ihre Dogmen.
Die rationalistische Lehre von der Falsifikation von Thesen würde zu Dogmen führen, wenn eine Falsifikation schwierig ist, auch wenn vieles für andere Thesen spräche, die genauso wenig falsifizierbar seien, aber das Pech haben, nicht etabliert zu sein oder nicht dieselbe Zeit zur Entwicklung eingeräumt bekommen zu haben. Manche Auffassung hat sich dadurch durchgesetzt, dass die Forscher bewusst mogelten und geschickt darin waren, eine gute Propaganda für ihre neuen Thesen zu machen. Hier verweist Feyerabend z.B. auf Galileo Galilei. Nicht alles neue ist auch besser. Feyerabend lobt hier die Traditionelle Chinesische Medizin gegenüber der Schulmedizin.
Die Kritik der Kritik
Viele der Kritiken Feyerabends sind berechtigt und geben wertvolle Hinweise darauf, wie Wissenschaft funktionieren sollte – und wie nicht. Im Kern jedoch scheint Feyerabend seine Kritik auf einem falschen Verständnis von Rationalismus aufgebaut zu haben.
Was die Regelüberschreitung und die Begrenzung durch Sprache und Weltanschauung anbelangt, so ist es der Standpunkt des Rationalismus im Sinne Poppers, dass neue Thesen mithilfe von Phantasie geboren werden. Darin, in der Phantasie, ist jede mögliche Überschreitung von Regeln praktisch bereits enthalten. Dass die Vernunft in sich eine gewisse abstrakte, kulturunabhängige Regelhaftigkeit hat, hätte man bei Feyerabend gerne gelesen („Dass da eins zum anderen passt“ könnte man als die innerste Regel der Rationalität formulieren), doch Feyerabend schweigt dazu. Die Auffassung, es gäbe nicht die eine Vernunft, ist falsch; was verschieden ist, sind die Ausgangspunkte, auf die man sie anwendet, die Vernunft ist aber immer dieselbe.
Feyerabend tut so, als glaubten Rationalisten, dass sie völlig rationale Wesen seien. Nicht dass sie Vernunft hätten, sondern dass sie Vernunft seien. Doch das ist falsch. Der Mensch ist keine Vernunft, er hat Vernunft; und er kann sie gebrauchen oder auch nicht. Und er kann sie nur auf dieses anwenden oder nur auf jenes oder auch auf alles. Vor allem aber hat der Mensch auch noch andere Fähigkeiten, z.B. Phantasie. Der Mensch sollte eben versuchen, diese andere Dimension und die Vernunft in Einklang zu bringen. Es ist das alte Ideal des Weisen. Aus diesem steten Wechselspiel erwächst dann ein Erkenntnisfortschritt.
Bei Feyerabend hat man öfter den unabweisbaren Eindruck, er plädiere für völlige Irrationalität, für haltlose Anarchie. Doch wenn Phantasie und Kreativität, die auch vorübergehend gegen vermeintlich rationale Sichtweisen verstoßen dürfen, nicht immer wieder mit der Vernunft eingefangen und zu einem neuen rationalen System konsolidiert werden, kommt dabei auf Dauer keine Erkenntnis, sondern Chaos heraus. Erst das ständige, nie endende Wechselspiel beider Seiten, das Bemühen, beidem gerecht zu werden, macht die Erkenntnis aus und hält den Prozess lebendig.
Auch ist der Rationalismus nicht auf eine simple Scheidung der Erkenntnis in Wissen und Unwissen festgelegt. Vielmehr zeigt sich gute, rationale Wissenschaft häufig gerade daran, wie sie mit verschiedenen Graden von Ungewissheit umgeht und vernünftige Abwägungen trifft, indem sie einzelne Unwägbarkeiten gegeneinander abgleicht und zu einem plausiblen, wahrscheinlichen Gesamtbild integriert. Richtig ist allerdings auch, dass es viele „rationale“ Menschen gibt, die nur „hartes Wissen“ gelten lassen wollen, und damit in die Irre laufen, denn je sicherer das Wissen, desto seltener ist es.
Wenn Feyerabend kritisiert, dass sich die Wissenschaft gerne Dogmen schafft und alternative Thesen nicht in angemessener Weise würdigt, kritisiert er eher den real existierenden Wissenschaftsbetrieb als die Idee der Wissenschaft. Natürlich ist es richtig, dass eine Theorie nicht deshalb besser ist, weil sie etabliert ist, weil sie zuerst da war oder weil sie die größere Zahl an Fürsprechern hat, die gar nicht daran denken, ernsthaft nach einer Falsifikation zu suchen, weil eine Falsifikation ihren Status gefährden würde. Und natürlich ist es völlig richtig, dass man einer alternativen Theorie auch Zeit zur Entwicklung geben muss: Man muss eine Hypothese, die man zunächst nicht belegen kann und die wackeliger aussieht als andere Thesen, auch eine Zeitlang in der Schwebe halten und an ihr arbeiten und mit ihr spielen können. Aus diesen Überlegungen kann man Maßnahmen zur Ausbildung von Wissenschaftlern und zur Organisation des real existierenden Wissenschaftsbetriebes ableiten, damit die nötige Weite des Geistes (oder wenigstens Toleranz) herrscht. Eine Kritik am Rationalismus ist das jedoch nicht.
Die Kritik Feyerabends am real existierenden Wissenschaftsbetrieb ist im Übrigen zu hart und gerät teilweise rabulistisch. Die Gleichsetzung mit der Kirche ist doch stark übertrieben. Es gibt zwar auch in der Wissenschaft Phasen der Erstarrung und der Wissenschaftsgläubigkeit, aber diese Phasen sind meist auf eine Generation beschränkt, was eine grundsätzliche Reformfähigkeit belegt. Die Kirche jedoch kann ihre Dogmen über Jahrhunderte durchhalten, wenn die Umstände ihr kein Um- und Weiterdenken aufzwingen. Feyerabends Einschätzung des Prozesses von Galilei, dass nämlich die Kirche im damaligen Rahmen durchaus rational und richtig urteilte, während Galileo noch zu schwache Argumente hatte, mag zwar in Ordnung sein, aber Feyerabend hätte klarer hinzufügen sollen, dass es unabhängig von der Frage der Richtigkeit des Urteils ein Problem ist, wenn sich die Kirche ein solches Urteil anmaßt und Denkverbote erlässt.
Sehr unappetitlich ist es, dass Paul Feyerabend sein 1970 veröffentlichtes Buch mit längeren Zitaten von Lenin beginnt. Auch Engels, Ilja Ehrenburg und Mao kommen zu Wort. Es ist grausig, diese naive Unbefangenheit gegenüber mehr oder weniger verbrecherischen Charakteren zu sehen, die offenbar aus einer linksideologischen Verblendung Feyerabends herrührt: Hegel und Marcuse werden auch zitiert. Hier zeigt sich, dass Paul Feyerabend nicht immer erfolgreich darin gewesen sein kann, enge Denksysteme zu überwinden, sonst hätte er wenigstens eine menschenfreundliche Distanz gewahrt. Zudem handelt es sich um Zitate, die man in dieser Form und mit diesem Sinn sicher auch und besser bei anderen und gewiss größeren Persönlichkeiten gefunden hätte. In der bei Linken üblichen Weise unausgegoren ist auch Feyerabends Idee einer Instanz, die nach den sozialen Folgen von Wahrheit fragt; von der Liebe zur Wahrheit oder von einer Sensibilität gegen subtile Zensurmechanismen zeugt dies leider nicht. Wenn man die Unbekümmertheit von Feyerabends Linksdrall betrachtet, bekommt seine heillose Relativierung der Vernunft einen gefährlichen Zug; hatte nicht auch Lenin ein weltverneinendes Faible für Dada, eine Grundverzweiflung an Ordnung und Sinn? Aus dem Urgrund der Seele erwächst unvermutet das Böse.
Fazit
Ein wichtiges Buch für alle Rationalisten, um ihren Rationalismus zu schärfen, zu festigen und im Niveau zu heben: Vernunft ist nicht alles, aber ohne Vernunft ist alles nichts. Letztlich ist es trotz vieler richtiger Einzeleinsichten ein aufs Ganze gesehen irriges Buch.
Bewertung: 3 von 5 Sternen.
(Erstveröffentlichung auf Amazon am 08. August 2012)