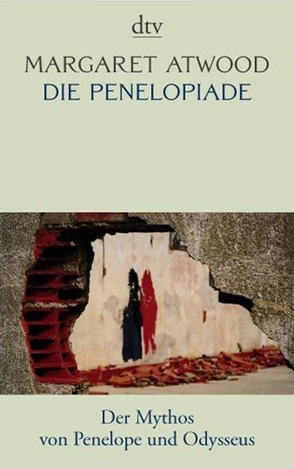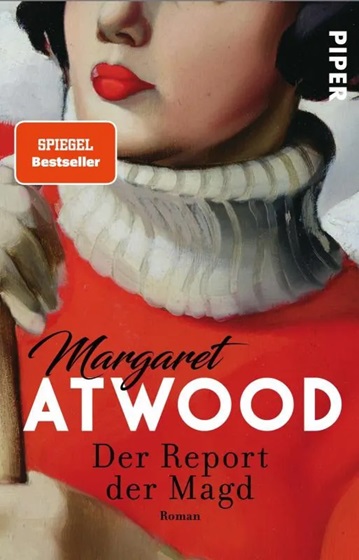
Ein moderner Klassiker der dystopischen Literatur
Margaret Atwoods „Report der Magd“ ist eine Dystopie, die eine post-moderne US-amerikanische Gesellschaft beschreibt, in der christliche Traditionalisten ein totalitäres Regime namens „Gilead“ errichtet haben. Insofern es eine Kombination aus christlich-traditionalistischen Elementen mit bekannten Elementen anderer totalitärer Regime ist, handelt es sich um das exemplarische Beispiel eines totalitären Staates. Dem Alten Testament verdankt sich die Praxis, dass sogenannten „Mägde“ Kinder für ihre unfruchtbaren Herrinnen empfangen und gebären müssen.
Aus der Ich-Perspektive einer solchen „Magd“ beschreibt Atwood die typischen Auswirkungen des Systems, wie wir sie auch von anderen literarischen Dystopien und authentischen Zeugenberichten aus realen dystopischen Staaten (Kommunismus, islamischer Traditionalismus, usw.) kennen: Die völlige Zurückgeworfenheit des Individuums auf sein Inneres, das traumatisierende Im-Kreis-Drehen der eigenen Gedanken, die Flucht in die Phantasie, das Klammern an alte Erinnerungen und an jeden Strohhalm der Hoffnung, die Erfahrung der Sinnlosigkeit des eigenen Daseins und der Gedanke an Selbsttötung, das Alleinsein und das Misstrauen gegenüber jedermann, die Angst und das völlige äußere Anpassen und willenlose Mitlaufen, das Abtöten aller Gefühle und Regungen, die Korruption und Verbiegung von Gefühlen wie Liebe und Vertrauen, schließlich auch das absurde Sich-Einrichten in einer kafkaesken Welt. – Zugleich bilden sich die üblichen informellen Strukturen, die die offizielle Ideologie unterlaufen: Ein Schwarzmarkt für verbotene Artikel wie Zeitschriften, Bücher, Alkohol oder Zigaretten, geheime Zusammenkünfte zwischen Mann und Frau, sogar ein Bordell für die höheren Funktionäre. All diese typischen Eigenschaften einer solchen Dystopie werden von Atwood in sehr eindringlicher Weise vor Augen geführt.
Anders als bei anderen Dystopien stehen bei Atwood die Frauen als Täter und Opfer im Mittelpunkt, weshalb manche von einer „feministischen Dystopie“ sprechen. Das Tun und Leiden der Männer in diesem System wird von der Autorin aber keineswegs vergessen. – Immer wieder wird das Wörtlichnehmen diverser Bibelstellen ad absurdum geführt, indem ihre Realisierung sehr konkret beschrieben wird. Ein kritisches Vaterunser wird formuliert.
In einigen Passagen klingt auch Kritik an manchen Zuständen in unserer modernen, freien Welt an: Der allzu oberflächliche und ignorante Umgang der Geschlechter miteinander, das Alleinsein alleinerziehender Mütter, eine Mode, die raubgierig und auf Beute aus ist, Enttäuschungen bei der Partnersuche und in der Ehe. Dass Atwood unsere Welt und unser Sozialleben in der Dystopie kritisch spiegelt, ist eine der Stärken dieses Werkes, die es über eine bloße Warnung vor totalitären Strömungen hinaushebt.
Zwei Kritikpunkte
Der Leser hat lange Zeit Schwierigkeiten zu verstehen, in welchem geschichtlichen und gesellschaftlichen Rahmen sich die Handlung abspielt, und was überhaupt passiert ist, dass es zu dieser dystopischen Gesellschaft kommen konnte. Wenn der Klappentext nicht einige hilfreiche Hinweise dazu gegeben hätte, hätte dies die Lektüre ernsthaft trüben können.
Die Errichtung einer christlich-traditionalistischen Dystopie in den USA nach einer atomaren Verseuchung ist ein etwas weit hergeholter Plot. Denn zum einen ist diese atomare Verseuchung, die viele Frauen unfruchtbar gemacht haben soll, ein Anlass, ein klein wenig Verständnis dafür aufzubringen, dass eine dergestalt bedrohte Gesellschaft drastisch auf eine demographische Katastrophe reagiert. Wie für alles in Atwoods Roman gibt es auch dafür historische Beispiele, etwa die Erlaubnis der höchst unchristlichen Vielehe in manchen deutschen Staaten nach der Entvölkerung ganzer Landstriche im Dreißigjährigen Krieg. Ohne den Aspekt der atomaren Verseuchung wäre die Absurdität einer christlich-traditionalistischen Dystopie klarer zutage getreten. Hier stehen sich zwei typische Themen Atwoods gegenseitig im Weg herum: Weniger wäre mehr gewesen.
Zum anderen ist der christlichen Rechten in den USA ein solches Vorgehen nicht zuzutrauen. Denn erstens hält die christliche Rechte die Verfassung der USA quasi für heilig. Das mag zwar manchmal holzschnittartige Formen annehmen, garantiert aber doch wesentliche Freiheiten. Und zweitens ist die christliche Rechte in den USA auch nicht so stark, als dass sie eine solche Machtübernahme bewerkstelligen könnte.
Man kann den Plot nur aus der Zeit der Entstehung des Romans und aus dem politischen Denken von Margaret Atwood verstehen: Für Margaret Atwood sind Dinge wie Atomkraft oder konservative Christen der leibhaftige Gott-sei-bei-uns. Das Tragische daran ist, dass diese allzu vehemente, unabgestufte, radikale Ablehnung von Andersdenkenden selbst wiederum in Gefahr ist, totalitäre Züge anzunehmen. Wir sehen heute die Gegenreaktion: Die Präsidentschaft von Donald Trump bedeutet weniger ein Erstarken der christlichen Konservativen als vielmehr einen Protest der gesellschaftlichen Mitte gegen eine kulturelle Hegemonie der Linksliberalen, die oft keinen Raum mehr für Andersdenkende lässt, und die kein Verständnis mehr für die Legitimität von rational oft höchst begründbaren Gegenpositionen aufzubringen vermag.
Dennoch ein Klassiker
Glücklicherweise spielen diese zeitbedingten Aspekte in Atwoods „Report der Magd“ nur am Rande eine Rolle. Atwoods Werk ist eine sehr überzeugende und geradezu exemplarische Darstellung der Zustände in einer dystopischen Gesellschaft jedweder Couleur und der conditio humana in einem solchen Regime. Deshalb hat dieses Werk das Zeug zum Klassiker, und in der Tat wird der „Report der Magd“ immer wieder völlig zurecht ein „moderner Klassiker“ genannt.
Bewertung: 4 von 5 Sternen.
(Erstveröffentlichung auf Amazon am 18. Juni 2018 mit einer Bewertung von 5 von 5 Punkten)