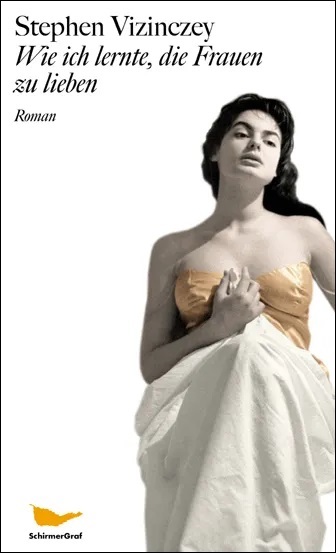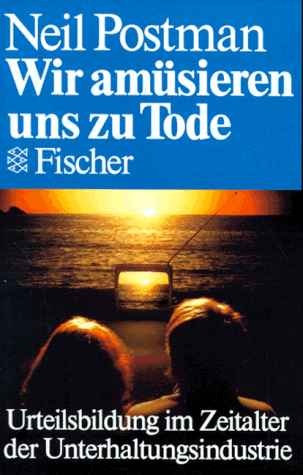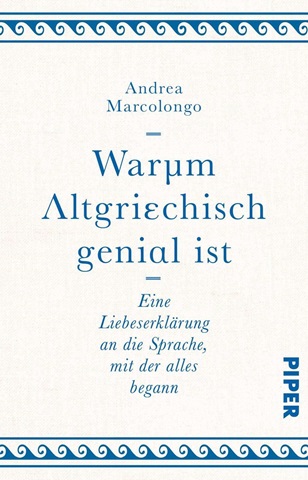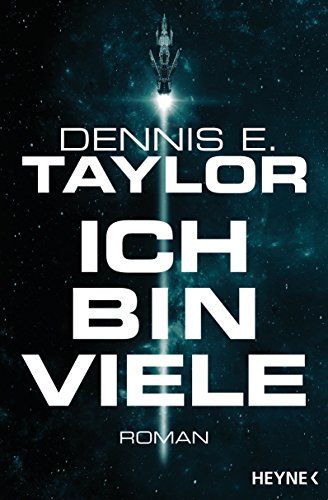Ungewollte Satire: Egomanischer Womanizer verwechselt Erotik mit Liebe
In seinem halbautobiographischen Roman „Wie ich lernte, die Frauen zu lieben“ (Originaltitel: „In Praise of Older Women“) beschreibt Stephen Vizinczey, wie ein Jugendlicher die „Geheimnisse“ der „Liebe“ lernt und dann als Erwachsener reihenweise Frauen von verschiedenstem Charakter „liebt“. Dabei wird in Tat und Theorie der „Liebe“ so dick aufgetragen, dass man manchmal meint, es handele sich um eine Satire. Doch es ist keine Satire, der satirische Effekt schwingt ungewollt mit und wird nirgends vom Autor aufgegriffen und zu echter Satire gemacht. Das Buch wird auch nicht als Satire verstanden. Es gilt als „Meisterwerk“ und „moderner Klassiker“, gewann Preise und wurde verfilmt, und ist bis heute ein internationaler Bestseller. Ein gewisser Arno Widmann nannte es laut Cover sogar „eines der weisesten Bücher der Weltliteratur“. Nun ja. Damit ist es eine ungewollte Satire auf einen egomanischen Womanizer, der sich für aufgeklärt, frauenfreundlich und erfahren in der „Liebe“ hält, ohne zu erkennen, wie er an der Liebe und den Menschen vorbei lebt.
Nur Erotik statt Liebe
Der Autor (oder sein Protagonist Andras Vajda) verwechselt systematisch Liebe mit Erotik. Nichts gegen erotische Anziehung! Und nichts gegen die Gabe, „mit Frauen umgehen“ zu können. Und auch keine grundsätzlichen Bedenken gegen Sex ohne formale eheliche Bande. – Aber eine erotische Zuneigung ist nun einmal noch keine Liebe, auch wenn das Wort „Liebe“ ständig dafür benutzt wird. Eine erotische Beziehung ist, wie das Buch korrekt wiedergibt, eine oft recht kurze und erstaunlich umstandslos wieder beendete Beziehung. Die Beziehungen in diesem Buch werden denn auch auf einer rein emotionalen Ebene geschlossen, eben der erotischen Ebene. Wie das Buch korrekt wiedergibt, ist die Entscheidung für oder wider eine solche Beziehung oft schon gefallen, bevor das erste Wort zwischen den Partnern gesprochen ist. Mehrfach heißt es, der Protagonist habe spontan „beschlossen“, mit einer Frau, die er gerade erst kennengelernt hat, zu schlafen. Sieht so Liebe aus? Es ist fast schon zum Lachen, wenn es heißt, der Protagonist habe die „Liebe“ im Bett gelernt (S. 236), und zum selben Ereignis: „Mit ihr war die Liebe eine Vereinigung, keine Selbstbefriedigung zweier Fremder im selben Bett“ (S. 97). Die Frau, in deren Bett der Protagonist die „Liebe“ als „Vereinigung“ lernte, war eine verheiratete Nachbarin, deutlich älter als er, sie machte sich nichts daraus, dass der Protagonist zwischendurch auch ihre Cousine flachlegte, und irgendwann später beendete sie die Beziehung abrupt und geschäftsmäßig, als sie einen anderen Liebhaber gefunden hatte. Später dann trifft der Protagonist auf eine frigide Frau, die sich über die Sexbesessenheit der Männer beklagt – und prompt ist der Protagonist ernsthaft gekränkt, als ihm bescheinigt wird, er sei nicht sexbesessen (S. 240 f.).
Moralisch verwirrt
Es ist leider nicht mehr zum lachen, wenn es ausgerechnet in bezug auf die Verkuppelung von US-Soldaten mit Flüchtlingsfrauen, die sich aus purer Not selbst prostituieren mussten, heißt: „Meine erste Erkenntis dank dieser abenteuerlichen Beschäftigung war, dass die meisten moralischen Ansichten über Sex keinerlei Bezug zur Wirklichkeit hatten.“ (S. 34) Ausgerechnet eine Notsituation dafür zu benutzen, die Maßstäbe der Moral zu bestimmen, ist höchst irrig – und geschmacklos. Warum eine dieser Flüchtlingsfrauen es strikt ablehnte, dass sich ihre 18jährige Tochter ebenfalls prostituierte, kann der Protagonist mit seiner beschränkten Weltsicht jedenfalls nicht erklären. Auch bietet er keine Erklärung dafür an, warum eine seiner Liebhaberinnen meinte: „wenn … meine Töchter von uns erfahren, bringe ich Dich um!“ (S. 296). Warum sollten denn die Töchter nichts von ihnen erfahren, wenn es doch moralisch unbedenklich ist? Auch bleibt völlig unverständlich, warum der Protagonist es für „sexistisch“ hält, wenn Medizinstudenten ihren Kommilitoninnen anbieten, sie von der „Krankheit der Jungfräulichkeit“ zu kurieren; völlig isoliert vom Rest des Buches wird plötzlich von – sic! – „Rücksicht“ auf Gefühle und – sic! – „moralische Prinzipien“ gesprochen. (S. 165 f.). Für eine solche Aussage bietet das Buch keine Grundlage, der Protagonist kommt hier in erhebliche Selbstwidersprüche. Auch liest man nichts darüber, warum die verschiedenen Freundinnen, die der Protagonist gleichzeitig hat, besser nichts voneinander erfahren dürfen (S. 288 ff.). Der Protagonist des Buches verschwendet keinen Gedanken daran, ob es klug und gut ist, in eine intakte Ehe einzubrechen; oder die verheiratete Mutter von Kindern zu „vögeln“; oder zwischendurch eben schnell die Cousine der derzeitigen Liebhaberin. Dass die Beziehungen zwischen Liebenden, zwischen Eltern und Kindern, auch zwischen Cousinen einen höheren Wert darstellen könnten, den für das kurze Vergnügen einer erotischen Beziehung zu opfern unklug und maßlos sein könnte, ist ein Gedanke, der in diesem Buch nicht vorkommt. Dass leichthin verletzte Gefühle auf dem Gebiet von Liebe und Sexualität zu ungeahnten Gefühlsdramen bis hin zu Mord und Totschlag führen könnten, ist dem Protagonisten fremd. Kurz, der Protagonist des Buches ist moralisch verwirrt.
Extremurteil über konservatives Denken
Dennoch ist der Protagonist unerschüttert in seinem Vorurteil über Konservative, und findet Bestätigung in der einzig konservativen Person, die ihm begegnet: Der tatsächlich dummen Cousine einer Liebhaberin, die sich ihm emotional überwunden hingibt, obwohl sie ihn auf rationaler Ebene für unmoralisch hält. Aber man hat nicht deshalb Recht, weil ein Vertreter der Gegenmeinung dümmer ist als man selbst. Schließlich begeht der Protagonist Ehebruch mit einer Frau, die emotional stark hin und her schwankt, ob sie dies zum ersten Mal in ihrem Leben tun sollte, und erklärt hinterher eiskalt zu ihren Bedenken: „Verstehe. Du glaubst zwar nicht mehr an Sünde, aber der Gedanke daran macht dir trotzdem zu schaffen, sozusagen aus Gewohnheit.“ (S. 284) – Wie wenn Moral und Gewissen restlos verschwinden würden und keine Begründung mehr hätten, wenn der christliche Glaube geschwunden ist! Um so zu denken muss man schon sehr dumm sein. Eine innere, wahrhaft liebende Beziehung zwischen Partnern, aufgrund von geteilten Lebenserfahrungen, Interessen, Weltanschauungen, gemeinsamen Kindern, politischen Zielen oder was immer sonst einen Menschen tief im Inneren antreibt, gibt es nach Meinung des Protagonisten offenbar nicht, sondern ist seiner Meinung nach wohl eine Illusion von Stockkonservativen, die er einfach für dumm und unaufgeklärt hält, wie die besagte Cousine. Einzig zugute halten möchte man dem Protagonisten, dass Konservative damals noch „strenger“ und eine Ehe damals noch „fesselnder“ war als heute, aber viel Verständnis und Nachsicht lässt sich aus diesen Umständen für die grundlegenden Irrtümer nicht ableiten.
Oberflächlicher Charakter
Der ganze Lebenssinn wird in diesem Buch auf einen guten Fick mit wem auch immer reduziert. Sogar die Selbstbefriedigung wird präzise deshalb gegeißelt, weil man statt dessen doch lieber mit irgend einer Frau geschlafen hätte, welche ist dabei nicht so wichtig. Der Protagonist kommt nicht auf die Idee, eine Liebesbeziehung anzustreben, in der er sich selbst als diejenige Person angenommen fühlen kann, die er ganz allein ist. Der tiefere Grund dafür könnte sein, dass der Protagonist ein 08/15-Mensch ist, ein austauschbarer, oberflächlicher Charakter, der sich natürlich leicht damit tut, sich mit anderen austauschbaren Charakteren auszutauschen (oder mit tieferen Charakteren, falls diese vorübergehend keine Tiefe wünschen). Ein austauschbarer Charakter also, der gar keine tiefere Beziehung zu einem anderen Menschen aufbauen kann, weil er keine eigene Tiefe hat, und der auch kein Bedürfnis nach einem „inneren Kreis“ von Vertrautheit hat, weil er in seiner Austauschbarkeit und Oberflächlichkeit kein Bedürfnis nach Schutz von etwas Eigenem vor dem öffentlichen Schwachsinn hat. Der öffentliche Schwachsinn gilt einem solchen Menschen vielmehr als das Richtige, Normale und Gute; das ist seine Ebene, auf der er sich mit anderen trifft. Und hier hat auch das Leitthema des Buches seinen Platz: Die Erfahrung des Protagonisten, dass er mit gleichaltrigen jungen Mädchen nichts anfangen konnte, weil diese zickig sind, weshalb er auf ältere Frauen auswich. Kann man nicht wenigstens das nachempfinden? Nein. Denn auch unter den Gleichaltrigen gibt es immer Einzelne, die schon als junge Menschen vernünftig sind – aber das sind eben die mit Charakter. Dass die oberflächlichen Zicken erst im mittleren Alter genießbar werden, das will man gerne glauben, aber damit verrät sich der Protagonist in seiner Oberflächlichkeit einmal mehr selbst. Die Maxime der Philosophie, sich selbst zu erkennen, verwirft er denn auch, weil er darüber nur gemeiner und dümmer werden würde, wie er selbst sagt (S. 236). Vielleicht wird er dadurch aber gar nicht gemeiner und dümmer, sondern erkennt nur, dass er eben dieses ist?
Ungarn
Nebenbei wird auch noch ein wenig über die Geschichte Ungarns und das Schicksal der Flüchtlinge von 1956 erzählt. Das ist fast noch das wertvollste an diesem Buch, aber es ist nicht eben viel.
Fazit
Für viele Menschen, die sich für gebildet und aufgeklärt halten, ohne dass sie es sind, scheint dieses Buch ein Ideal von sexueller Freizügigkeit zu repräsentieren; in Wahrheit ist es jedoch eine ungewollte Satire auf maßlose sexuelle Enthemmung. Leider sind die meisten Menschen entweder maßlos enthemmt oder maßlos verklemmt, und feiern damit in ihren jeweiligen Milieus Erfolge – nur wenige sind klug und maßvoll, und müssen damit auf der Hut sein, um nicht unter die Räder der kleinen und großen Meinungsführer zu geraten, die es überall gibt. Kurz: Ein schlechtes Buch.
Bewertung: 1 von 5 Sternen.
(Erstveröffentlichung auf Amazon mit einigen sprachlichen Glättungen am 18. März 2013)