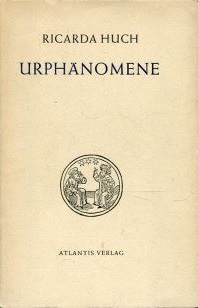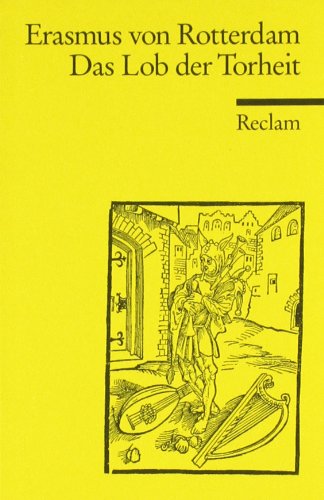
Rundumschlag quer durchs Leben, gelungen und doch irreführend
Erasmus lässt die personifizierte Torheit eine Lobrede auf sich selbst halten. Versteckt hinter der Maske der Torheit und der Ironie kann Erasmus die Fehler der großen und kleinen Leute durchsprechen. Teilweise ist das anregend und witzig und auch für die heutige Zeit oft gut getroffen.
Teilweise ist es aber auch sehr unübersichtlich: Dummheit als Hauptthema einer Arbeit eröffnet ein viel zu weites Feld, als dass noch ein gemeinsames Band hinter allem zum Vorschein käme.
Teilweise ist es auch irreführend. Die Torheit redet teils so überzeugend und doppelt-ironisch, dass der Leser an manchen Stellen wirklich nicht mehr wissen kann, was Erasmus nun selbst ernst meint, und was er nur ironisch meint. Weniger gebildete Leser werden so manchen Rat der Torheit ernst nehmen und ihn entweder als Provokation empfinden oder sogar gutheißen! Das zynische Klischee des Weisen, der am Leben vorbeilebt und von den Frauen verschmäht wird, das Klischee von den Frauen, für die man sich zum lächerlichen Narren machen müsse, um sie zu gewinnen, das Klischee vom erfolgreichen Toren und dem erfolglosen Weisen (leidvolle Erfahrungen von Erasmus?): Sie sind wenig hilfreich und polarisieren die Leser, statt zu differenzieren.
Teilweise ist so manches, was die Torheit als Torheit hinstellt, in Wahrheit gar nicht töricht, wodurch das Werk schiefe und halbwahre Aussagen trifft. Witz, Ironie und Höflichkeit als Dummheiten hinzustellen, ohne die die Welt nicht funktionieren würde, ist irrig. Ebenso irrig ist es, das „Ich weiß dass ich nichts weiß“ des Sokrates für töricht zu halten.
Gegen Ende des Werkes kommt Erasmus auf die Vernunftlogik des Glaubens zu sprechen, die in den Augen der Nichtgläubigen Torheit ist (Paulus: Wir sind Narren um Christi willen; Gott lässt die Weisheit der Weisen zuschanden werden und offenbart sich in Torheit). Dass die Worte des Paulus nicht vernunftfeindlich gemeint sind, sondern lediglich besagen, dass man mit derselben Vernunft zu anderen Schlüssen kommt, wenn man von anderen Voraussetzungen ausgeht (Jesus lebt, oder eben auch nicht), kommt nicht zum Ausdruck. Die Verwirrung zwischen Torheit und Vernunft ist perfekt.
Der eigentliche Wert des Werkes liegt vermutlich weniger in dieser oder jener Aussage, sondern in der Provokation selbst. Diese ist zweifelsohne in mehrfacher Hinsicht gelungen. Die Frage ist, ob Erasmus es mit der Provokation nicht übertrieben hat, und wohin die Provokation führen soll, da es doch teilweise an Klarheit mangelt. Unter diesem Gesichtspunkt verliert das Werk stark an Wert. Das „Lob der Torheit“ ist ein Querschläger, der schief und krumm in der Landschaft herumsteht, und viel Nebel verbreitet. Auch die heutigen Interpreten sind sich nicht völlig einig darin, was Erasmus eigentlich wollte, jeder sieht es wieder ein wenig anders.
Teilweise ist der Mangel an Klarheit auch dem Umstand geschuldet, dass Erasmus mit diesem Werk die politische Korrektheit seiner Zeit unterlief und unter der Maske der Torheit Dinge aussprach, die man nicht ungestraft sagen konnte. Erasmus soll durch dieses Büchlein das Aufbrechen von Tabus gelungen sein, so dass er als Wegbereiter der Reformation gilt.
Es finden sich interessante Reformgedanken zum Christentum, bis hin zu historisch-kritischen Denkweisen: Zum einen in der Feststellung, dass die Apostel einst kaum über das theologisch spitzfindige Wissen der Theologen aus Erasmus‘ Zeit verfügt haben werden, und was für einen Sinn es dann haben sollte? Zum anderen z.B. in der Feststellung, dass auch der Apostel Paulus die Altarinschrift für den unbekannten Gott in Athen zu seinen Gunsten zurechtbog. Beides erstaunliche Gedanken, die das scholastische Christentum massiv hinterfragen.
Die Anzahl der antiken Anekdoten, die Erasmus einbaut, ist erstaunlich. Die Interpreten sagen, die Torheit würde mit ihnen nur so um sich werfen, weil sie selbst sage, dass die Toren mit Zitaten nur so um sich werfen. Aber gleichzeitig kann Erasmus so seine Belesenheit beweisen, ohne selbst als töricht zu gelten.
Fazit
Eine geschickte und wirkmächtige, aber leider auch teils undurchsichtige Provokation, die das mittelalterliche Denken ordentlich durchschüttelte und bis an seine Grenzen in Richtung der Moderne dehnte. Nebenbei auch mancher Ratschlag, manche Einsicht der Lebensklugheit und Menschenkenntnis, die auch heute noch von Wert ist.
Bewertung: 4 von 5 Sternen.
(Erstveröffentlichung auf Amazon am 11. Januar 2014)