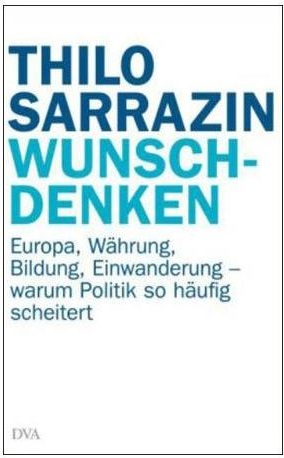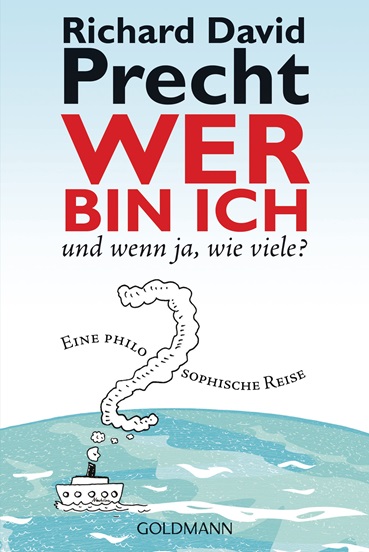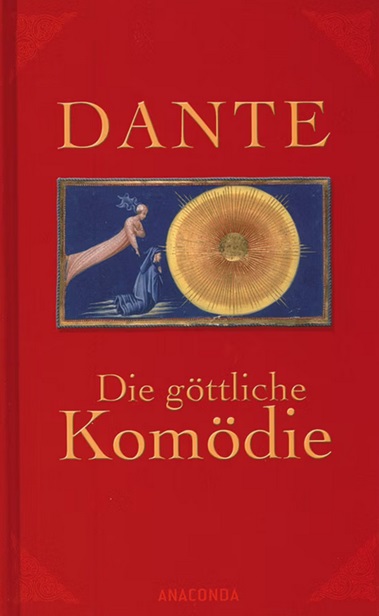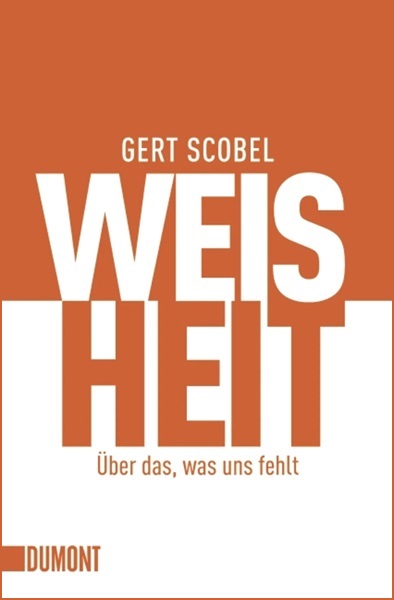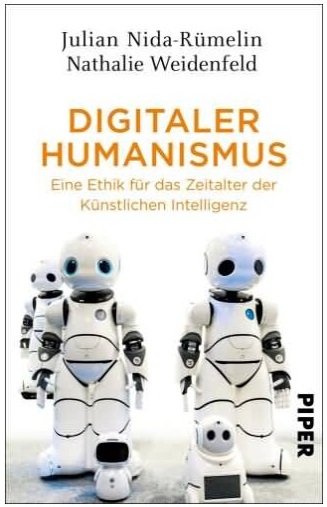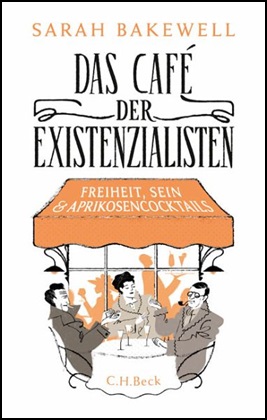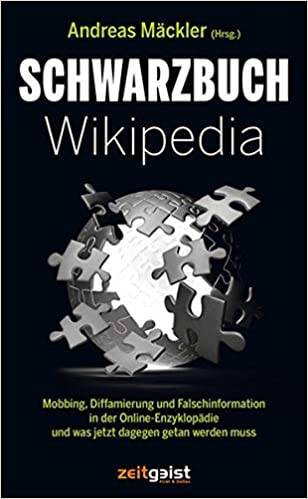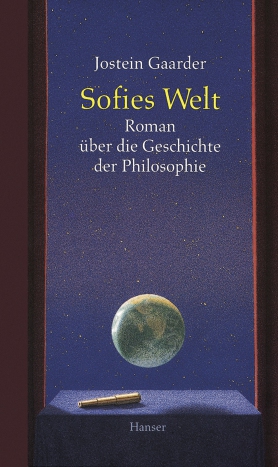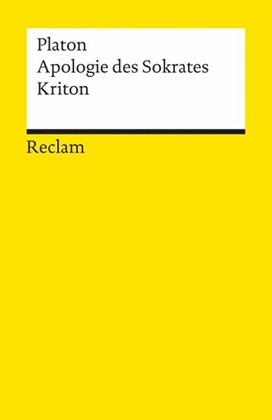
Der zentrale Grundlagentext der westlichen Zivilisation
Platons Apologie des Sokrates ist der zentrale Grundlagentext der westlichen Zivilisation. Viele werden jetzt fragen: Ist das nicht zuviel gesagt? Ist nicht die Bibel der Grundlagentext der westlichen Zivilisation? Und wieso überhaupt die Apologie? Die kennt doch so gut wie niemand? Und wie kann ein so kurzer Text so wichtig sein?
Nun, die Bibel ist natürlich ebenfalls ein unverzichtbarer Grundlagentext der westlichen Zivilisation. Aber die Bibel gab es schon lange bevor die spezifisch westliche Zivilisation mit Renaissance und Aufklärung ins Leben trat. Deshalb kann die Bibel nicht Zentrum und Ursache sein, sondern nur Wegbereiterin. Demgegenüber war die Apologie des Sokrates das ganze Mittelalter über verloren gewesen. Erst mit der Renaissance wurde der Text wieder verfügbar, und zwar präzise mit der ersten lateinischen Übersetzung von Platons Gesamtwerk durch Marsilio Ficino in den Jahren 1484/85. Erst von diesem Zeitpunkt an konnte die Apologie des Sokrates ihre Wirkung neu entfalten.
Der Geist der Apologie
Aber was war das für eine Wirkung? Um was geht es in der Apologie? Die Apologie des Sokrates ist die Verteidigungsrede des Sokrates in jenem Prozess, an dessen Ende er wegen Gottlosigkeit und der Verführung der Jugend zum Tode verurteilt wurde. Zur Rechtfertigung seiner „Missetaten“ erzählt Sokrates, wie er zur Philosophie kam und was es damit auf sich hat. Wir lernen dabei folgendes:
- Wer die Wahrheit erkennen will, muss sich zunächst einmal klar machen, wie wenig er weiß. Im streng philosophischen Sinne des Wortes „Wissen“ wissen wir Menschen so gut wie gar nichts. Viel zu viele Menschen jedoch bilden sich ein, dass sie etwas wüssten. Doch fast immer, wenn Sokrates damit anfängt, nachzufragen, stellt sich heraus: Die Leute wissen nicht, was sie zu wissen glauben, und ihre Meinungen sind haltlos.
- Wer sich der Wahrheit nähern will, muss in einen Dialog verschiedener Meinungen eintreten. Genau das tut Sokrates immer wieder und wieder. Denn erst in dem Dialog verschiedener Meinungen lässt sich eine neue und bessere Meinung entwickeln, die näher und näher an die Wahrheit herankommt. An die Stelle von „Wissen“ im Vollsinn des Wortes treten Meinungen, die möglichst gut begründet sein sollten. Je nach dem Grad der Begründetheit haben diese Meinungen eine hohe oder niedrige Plausibilität bzw. Wahrscheinlichkeit und sind dann entweder Überzeugungen auf der Grundlage von guten Argumenten, oder doch nur „bloße“ Meinungen.
- Wer die Wahrheit erkennen will, muss seine Meinung zur Debatte stellen. Denn auch eine wohlbegründete Meinung ist kein sicheres Wissen. Immer ist es möglich, dass weitere Aspekte auftauchen, die noch nicht bedacht wurden. – Sokrates blieb nicht beim Nichtwissen stehen, sondern begann, im Dialog mit Freunden und Gegnern verschiedene Thesen zu entwickeln, die tragfähig waren. Um dieses Werk fortzusetzen gründete Platon später eine Philosophenschule vor den Toren Athens, im Hain des Akademos. Platons Schüler strickten an dem neuen Erkenntnisgebäude weiter, darunter auch Aristoteles. Daraus entstand die Wissenschaft.
- Wer die Wahrheit erkennen will, muss respektlos vor Autoritäten sein. Wir sehen, wie Sokrates auch vor angesehenen Politikern nicht haltmacht und auch diese befragt, was sie denn eigentlich wissen. Und es stellte sich heraus: Von allen Menschen wissen die Politiker am wenigsten, während die Handwerker, die praktischen Menschen, sich immerhin auf ihr praktisches Handwerk verstehen. Aber auch die Religion blieb von den Fragen des Sokrates nicht verschont.
Das ist das Zentrum unserer westlichen Welt: Sokrates und Platon haben eine Revolution der Erkenntnisgewinnung eingeläutet und auf diese Weise unser Denken für immer verändert. Es ist der Siegeszug der Rationalität. Und mit ihm auch der Siegeszug der Liberalität, denn nur freie Bürger können sich erlauben, respektlose Fragen zu stellen und gefährlich ins Offene und Unbekannte hinein zu denken. Dieser Geist begann ab 1484/85 wieder zu wirken.
Die Apologie heute
Es ist wahr, dass die Apologie des Sokrates heute kaum noch jemandem bekannt ist. Die Reduktion der humanistischen Bildung quer durch alle Schulfächer bis hin zur Abschaffung des Latein- und Griechischunterrichtes hat ganze Arbeit geleistet. Damals hieß es, man könne doch auch Übersetzungen lesen. Das ist wahr. Aber Lehrpläne, die die Lektüre dieser Übersetzungen vorsahen, wurden nie erstellt.
Ich selbst habe den wunderlichen Sokrates durch meinen Deutsch- und Geschichtslehrer Bruno Epple kennengelernt, der als Mundartdichter unseres Bodensee-alemannischen Dialektes bekannt war. Es war beeindruckend, wie er zwischen den Schulbänken auf und ab tigerte und ein ums andere mal ausrief: „Die waren doch verrrrrückt! Diese alten Griechen: Verrrrückt! Was die für komische Fragen gestellt haben! Das muss man sich mal vorstellen: Was die sich herausgenommen haben! Lauter Verrrrückte! usw.“ – Das war im siebten Schuljahr, um 1985, auf einem baden-württembergischen Gymnasium. Man muss dazu wissen: Bruno Epple hielt sich selten an die Vorgaben der Lehrpläne und setzte eigene, eher traditionelle Schwerpunkte. Womöglich sind andere Lehrer zur gleichen Zeit ohne viel Aufhebens über Sokrates hinweggegangen. Im Schulbuch waren Sokrates anderthalb Seiten gewidmet, seiner Befragung der Mitbürger aber nur ein Absatz. Den Originaltext der Apologie des Sokrates haben wir an der Schule nie gelesen. Auch in höheren Klassenstufen nicht. Und das, obwohl sich dieser Text aufgrund seiner Kürze als Schullektüre hervorragend eignen würde.
Heute kennt in der Tat kaum noch jemand die Apologie des Sokrates. Und das könnte ein wichtiger Teil der Probleme unserer Zeit sein. Denn heute geschehen schier unglaubliche Dinge, die niemand akzeptieren kann, der einmal vom Geist der Apologie ergriffen wurde:
- Wir haben öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalten, die nicht nur behaupten, kompetent zu sein (das wäre noch in Ordnung, wenn’s denn nur wahr wäre), sondern die doch tatsächlich auch noch behaupten, objektiv zu sein! Natürlich sollte jeder danach streben, so objektiv wie möglich zu sein, aber wir alle nähern uns der Wahrheit von verschiedenen Seiten her an. Es ist grundsätzlich nicht möglich, dass jemand auftritt und legitim sagen kann, er wäre der Verkünder objektiven Wissens. Das konnte einst die Kirche im Mittelalter tun. Aber in einer modernen Gesellschaft sollte das nicht mehr möglich sein.
- Ständig werden wir dazu aufgefordert, irgendwelchen „Experten“ zu glauben. „Follow the Science“ ist ein beliebter Slogan. Aber es gibt doch gar nicht „den Experten“, der uns objektives Wissen verkünden könnte, denn verschiedene Experten vertreten verschiedene Meinungen. Und auch „die Wissenschaft“ gibt es so nicht, denn die Wissenschaft lebt davon, dass sich verschiedene Meinungen im freien Dialog miteinander befinden.
- Sogenannte „Faktenfinder“ tragen „Fakten“ zu komplexen Fragen zusammen, und jubeln uns ihre Urteile als unumstößliche „Fakten“ unter. Nicht selten tragen solche Faktenfinder eine durchaus hilfreiche Sammlung von Informationen zusammen. Aber würde man sich sein Urteil nicht lieber selbst bilden?
- In den sozialen Netzwerken des Internet werden aus den „Faktenfindern“ die berüchtigten „Faktenchecker“, die ihre Urteile als Verurteilungen auch gleich in die Tat umsetzen: Im Auftrag der sozialen Netzwerke bzw. der Regierungen unterdrücken sie unliebsame Meinungen, auch wenn diese gar nicht strafbar sind. Sie tun dies durch die Markierung von Beiträgen, durch die Drosselung der Reichweite, durch Shadow-Banning, durch die vollständige Sperrung einzelner Beiträge, durch Demonetarisierung oder durch die Sperrung von ganzen Kanälen und Accounts. Aber woher nehmen diese „Faktenchecker“ die übermenschliche Weisheit, zu wissen, was „wahr“ und was „falsch“ ist?
- Carolin Ehmcke wurde 2016 mit dem Friedenspreis des deutschen Buchhandels ausgezeichnet. Im Jahr 2024 sprach sie sich auf der Konferenz „re:publica“ allen Ernstes und unter frenetischem Beifall des „progressiven“ Publikums gegen Pro- und Contra-Formate in den Medien aus. Ehmcke glaubt, dass die Experten in vielen Fragen schon wissen würden, was die „richtige“ Wahrheit ist. Deshalb würde ein Pro- und Contra-Format die Menschen nur verwirren, denn dort würde die „richtige“ Wahrheit einer „falschen“ Wahrheit gleichberechtigt gegenübergestellt. Das ist schön gedacht. Aber weiß Carolin Ehmcke wirklich, welche Experten die „richtige“ Wahrheit besitzen? Eine dermaßen „richtige“ Wahrheit, dass man keine Fragen mehr stellen darf? Und wie kann sie sich sicher sein, dass nicht doch eines Tages eine Frage auftaucht, an die keiner gedacht hatte? Sollte die „richtige“ Wahrheit nicht triumphal überzeugen, wenn sie einer „falschen“ Wahrheit tatsächlich völlig gleichberechtigt gegenübergestellt wird? Und bezieht die „richtige“ Meinung nicht gerade daraus ihre Legitimität als „richtige“ Meinung, dass sie gegen andere Meinungen bestehen kann? Wie steht es denn um die Legitimität einer „richtigen“ Meinung, wenn sie der Konfrontation mit anderen Meinungen systematisch aus dem Weg geht?
- Unsere Universitäten folgten einst dem Ideal des preußischen Reformers Wilhelm von Humboldt, dass Forschung und Lehre so miteinander verwoben sein sollten, dass die Studenten das Fragen und Hinterfragen lernen. Doch mit den Bologna-Reformen ist davon nicht viel übrig geblieben. Ob Preußen oder die humanistische Bildung: Mit solchen „ewiggestrigen“ Dingen will man heute nichts mehr zu tun haben, denn man will „progressiv“ sein. Aber ist es denn wirklich progressiv?
- Die einflussreiche Online-Enzyklopädie Wikipedia arbeitet nach dem Prinzip des „neutralen Standpunktes“. Gemeint ist in Wahrheit nicht Neutralität, sondern Objektivität, wie Wikipedia immer noch festlegt („möglichst objektiv“). Die Darstellung verschiedener Meinungen soll nach Möglichkeit vermieden werden. Auch wenn die heutige Version des Wikipedia-Artikels „Neutraler Standpunkt“ viel von der Darstellung verschiedener Meinungen spricht, ist das früher sehr viel schärfer formulierte Prinzip eines möglichst einheitlichen, objektiven Standpunktes immer noch das Ziel. Objektivität ist für Menschen aber nicht zu erreichen. In der Praxis führt das dazu, dass Wikipedia-Artikel vom Standpunkt eines allwissenden, autoritären, übermenschlichen Erzählers verfasst werden, der ganz und gar nicht neutral ist, sondern der genau eine einzige Meinung als die lexikographisch geoffenbarte Wahrheit darlegt, während alle anderen Meinungen folgerichtig entweder als Unsinn herabgewürdigt oder als unwürdig ausgeblendet werden. Diese Praxis entspricht zwar lexikographischer Tradition, aber sollte ein modernes Lexikon nicht besser den Standpunkt eines Beschreibers der Gesamtwirklichkeit einnehmen? Dieser würde es sich zur Aufgabe machen, überhaupt keine Meinung zu vertreten, also wirklich neutral zu sein, sondern alle existierenden Standpunkte wertfrei darzustellen. Eine legitime Unterscheidung verschiedener Standpunkte wäre der Grad ihrer Unterstützung in Wissenschaft und Öffentlichkeit: Erst stellt man Unstrittiges dar, dann die Mehrheitsmeinung, und zuletzt – etwas kleiner, aber wertfrei – Minderheitsmeinungen. Wer seinen Mitmenschen „Wissen“ vermitteln will, dabei aber immer nur eine einzige Meinung mitteilt, statt verschiedener Meinungen und ihrer Begründungen, begeht einen grundsätzlichen Fehler. Denn die Legitimität einer „richtigen“ Meinung beruht zentral darauf, dass sie die Konfrontation mit anderen Meinungen überlebt. Und das nicht nur einmal, sondern immer wieder und wieder.
Wer einmal mit Sokrates durch Athen gegangen ist und gesehen hat, wie Sokrates Handwerker, Händler und Politiker in Dialoge verwickelte, um herauszufinden, was sie wirklich wissen und was wirklich die Wahrheit ist, sofern sich dies überhaupt herausfinden lässt, der erkennt den Unsinn unserer Tage mit einem Blick. Es ist eigentlich ganz einfach: Wenn wir die Texte, die einst Renaissance und Aufklärung entfachten, nicht mehr lesen, dann versteht es sich von selbst, dass uns die Errungenschaften von Renaissance und Aufklärung langsam wieder abhanden kommen. Wenn der Westen sich wieder auf sich selbst besinnen will, dann muss er zurück zu den Quellen: Ad fontes!
Anderes
Die Apologie hat noch mehr zu bieten: Sie zeigt Sokrates als einen Weisen, der nicht nur in Worten philosophiert, sondern seiner Philosophie auch mit großer Konsequenz Taten folgen lässt. Sokrates gibt seinen Anklägern nicht nach und geht auch keine faulen Kompromisse ein. Das Todesurteil am Endes des Prozesses nimmt er gelassen auf sich und nutzt auch diese Gelegenheit noch einmal, um seine Philosophie zu bekräftigen: Andersdenkende aus dem Weg zu räumen, ist weder schön, noch wird es Erfolg haben.
Die Rede ist außerdem voller Ironie und deshalb sehr vergnüglich zu lesen. Ein weiteres Thema ist die Schwierigkeit, Menschen zum Umdenken zu bewegen, nachdem sie über lange Zeit mit einer bestimmten Meinung indoktriniert wurden. Das Verhältnis von Bürger und Staat wird beleuchtet. Nicht zuletzt handelt es sich um eine Rede vor Gericht, weshalb sich auch manche Weisheit und Einsicht rund um die Juristerei finden lässt.
Bewertung: 5 von 5 Sternen.