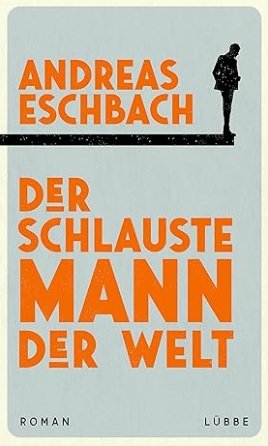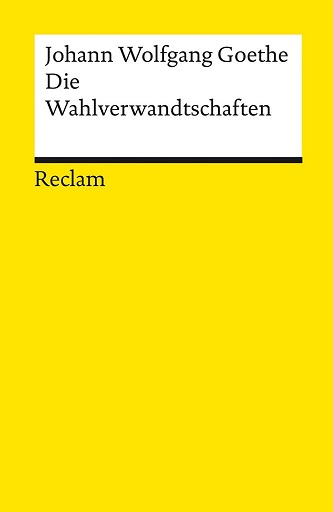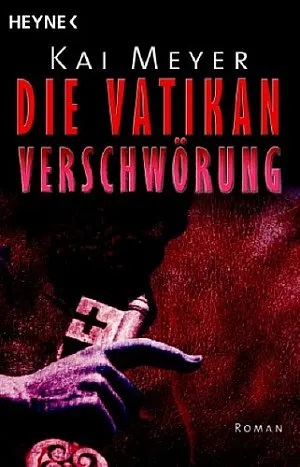
Ärgerlich: Autor verschenkt großartigen Ansatz
Eigentlich hat das „Haus des Daedalus“ (auch: die „Vatikan-Verschwörung“) alles, was eine erstklassige historische Schnitzeljagd im Stile Dan Browns braucht: Geradezu genial der Einfall, dass die Carceri-Stiche von Piranesi keine Phantasiebilder sind, sondern eine verborgene Unterwelt zeigen, die es wirklich gibt. Selten war ein Historien-Thriller so gut und so glaubwürdig in der Historie verankert! Der Geheimbund der Bewacher des Zugangs zur Unterwelt und seine verschiedenen Charaktere ist ebenfalls glaubwürdig. Die Parallelhandlung der Kapuzinermönche war gelungen und kreuzt sich gut mit der Haupthandlung. Kai Meyer schafft es auch, eine Spannung aufzubauen, die sich immer weiter steigert. Er versteht es, mit der Erwartung des Lesers zu spielen, die bei jedem neuen Puzzleteil neu darüber nachdenkt, wie sich am Ende alles zusammenfügen könnte. So viele Hinweise werden gegeben: Die endlose Treppe in die Tiefe. Das Getrappel von Hufen. Verbrennungen. Fußspuren an der Decke. Licht lockt „es“ an. Ein mattes Leuchten aus der Tiefe. Dass auch ein wenig Esoterik mit hineinzuspielen scheint (schleichende Labyrinthisierung der Stadt Rom), stört ausnahmsweise überhaupt nicht, und auch das könnte immer noch eine natürliche Erklärung haben.
Doch dann … ist das Buch plötzlich zu Ende!
Die Protagonisten sind nicht in die Unterwelt hinabgestiegen! Sie haben es nur bis zum obersten Treppenabsatz geschafft. Ob es dort unten wirklich wie auf den Stichen von Piranesi aussieht, erfährt man überhaupt nicht! Ob der Stier tatsächlich ein Minotaurus ist, und wie er dort unten Jahrtausende überleben konnte, bleibt offen. Das feurige Flügelwesen und der „Geist“ grenzen dann wieder ans Esoterische, diesmal leider störend.
Kai Meyer hat hier einen grandiosen Ansatz verschenkt!
Selbstverständlich hätten die Protagonisten in die Unterwelt hinabsteigen müssen. Das, was Piranesi auf den Stichen gezeigt hatte, hätte in die Handlung einfließen müssen. Für den Stier hätte es eine plausible Erklärung geben müssen, z.B. dass es Daedalus gelang, eine Dampfmaschine zu konstruieren, die sich selbst am Laufen hält, und auf Licht und Geräusche reagiert. Auch das Flügelwesen hätte auf diese Weise zur Not gerade eben noch erklärt werden können. Wie üblich hätte es einen Showdown in der Unterwelt geben müssen, der durch einen Wissensvorsprung über Piranesis Stiche entschieden wird. Es hätte sich alles aufgelöst, und am Ende hätte man ja die Höhlen einstürzen lassen können.
Aber nichts davon. Es ist, wie wenn man gezwungen würde, eine spannendes Buch nach zwei Dritteln aus der Hand zu legen … – das Spiel mit Erwartungshaltungen macht noch kein gutes Buch: Wer Erwartungen weckt, muss sie auch befriedigen können. Es ist kein akzeptabler Stil, am Ende alles in der Schwebe zu lassen.
Ebenfalls störend waren zahlreiche Rückblenden zu Ereignissen in der Zeit vor der Romanhandlung. Man hatte am Anfang ständig das Gefühl, dass man den zweiten Band einer Serie liest, den man vielleicht nur dann richtig verstehen könnte, wenn man zuvor den ersten Band gelesen hat. Doch es gibt keine Serie und keinen Vorgängerband.
Bewertung: 3 von 5 Sternen.
(Erstveröffentlichung auf Amazon am 23. Februar 2015)