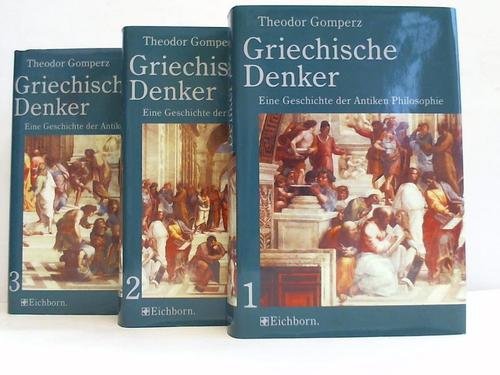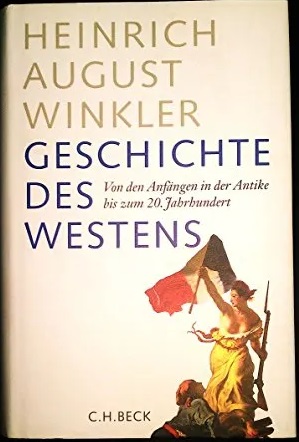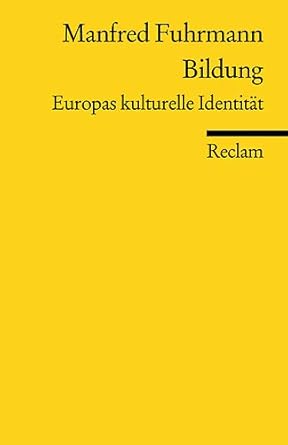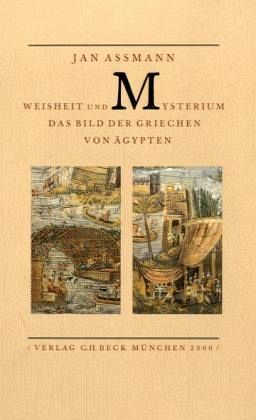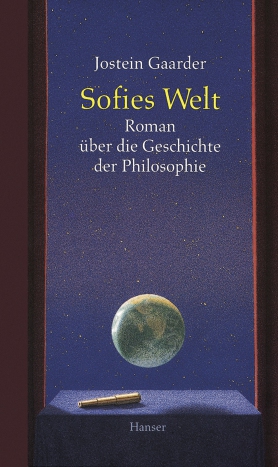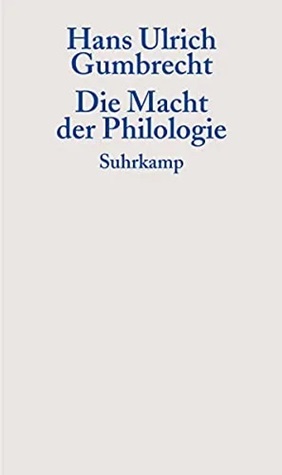
Völlig am Ziel vorbei geredet
Wenn man von der „Macht der Philologie“ hört, dann denkt man an die große Bedeutung, die die richtige Interpretation alter (und neuer) Texte für die Gegenwart hat, insbesondere für Humanismus und Aufklärung. Man denkt an die historisch-kritische Methode, an Historisierung, korrekte Einordnung vergangener Zeiten, Korrekturen von bedeutsamen Schreibfehlern, oder die Wiedergewinnung bedeutender Texte. Und man denkt auch an die große Aufgabe, dies nun alles auch für den Koran und andere islamische Grundlagentexte durchzuführen, ohne Rücksicht auf die allzu Rücksichtsvollen.
Enttäuschte Erwartungshaltung
Aber in diesem Buch wird unter „Macht“ etwas anderes verstanden. Der Autor versteht unter „Macht“ die Ergriffenheit des Philologen während seiner philologischen Tätigkeit, bzw. den fast schon körperlichen (An-)Trieb, sich philologisch zu betätigen. Sozusagen den Eros der Philologie. Letztlich ist „Macht“ hier natürlich eine unpassende Wortbildung, weil das Wort „Macht“ üblicherweise so nicht gebraucht wird.
Und leider wird die Ausführung dieses Ansatzes den Erwartungen nicht gerecht. Man hätte sich gewünscht, von Platon und der intrinsischen Motivation des Philosophen zu hören, sich für die Gemeinschaft einzusetzen, statt sich zurückzuziehen, oder von der Motivation der Stoiker versus der Demotivation der Epikureer, oder von Platons Mythen, die auch das Ziel verfolgen, die Rationalität emotional zu unterstützen. Oder ganz modisch: Von Schamanen und ihren Beschwörungen, von der Verschmelzung von Subjekt und Objekt, von Sigmund Freud und seinen zwei Antrieben Eros und Tod. Zum Beispiel.
Statt dessen: Langweilige Betrachtungen von Walter Benjamin über Wolken, die über das Heidelberger Schloss ziehen. Und vieles andere „gelehrige Geschwätz“. Durchaus nicht falsch. Aber immer am Punkt vorbei. Eine lange Kette von mühsamen Assoziationen, an deren Ende man sich fragt, was man jetzt eigentlich gelernt hat. Nutzlos in diesem Sinne wie die „Dialektik der Aufklärung“. Die einzelne Denkfigur kann nützen, wenn der Leser sie aus ihrem morastigen Zusammenhang befreit und selbst durch Klarheit zu neuem, besserem Leben erweckt.
Kein überzeugendes Buch. Habe es nach zwei Fünfteln abbrechen wollen –
– Habe es dann aber doch zu Ende gelesen. Man lernt so dies und das. Und bekommt diesen oder jenen Einblick. Aber eher im Sinne von Wissenschaftsgeschichte. Nicht im Sinne von Wissenschaft selbst.
Nach dem ersten Kapitel hört man dann nicht mehr viel von der „Macht“ der Philologie, und die Überlegungen geraten in das Fahrwasser von üblichen philologischen Überlegungen. Vieles ist „g’schwoll’nes G’schwätz“, das dem Leser gegenüber offenbar bewusst einen klaren und unzweideutigen Zugang zum Verständnis des Textes verstellt. Man kann streckenweise nur raten, was das Buch wohl meint. Am Ende zeigt sich oft, dass man dasselbe auch wesentlich klarer und einfacher hätte formulieren können. An so einem ärgerlichen Text möchte man nicht „scheitern“. So weit kommt’s noch …
Gegen Ende kommt das Buch wieder auf die Ergriffenheit, auf die „Macht“ der Philologie zurück, von der bisher nur im ersten Kapitel die Rede war. Das Erlebnis der Konfrontation mit einer komplexen zu lösenden Aufgabe, für deren Lösung man nicht unter Zeitdruck steht, wird als das Erlebnis bezeichnet, was die Faszination der Philologie ausmache. Das ist aber in mehrfacher Hinsicht fragwürdig. Diese Faszination kann man auch beim Schachspiel erleben, in einem schwierigen Stellungsspiel, ohne Schachuhr. Ja, das ist auch eine Faszination. Aber es ist nicht die Faszination der Philologie.
Die wahre Macht der Philologie
Aus irgendwelchen Gründen redet das Buch völlig am Kern der Sache vorbei. Die Faszination der Philologie besteht natürlich darin, dass die alten Texte elementare Einsichten über das Menschsein enthalten, die jeden betreffen und berühren. Deshalb u.a. haben sich diese alten Texte schließlich auch erhalten, und andere Texte nicht. Die Apologie des Sokrates hatte offenbar mehr Menschen zu allen Zeiten etwas zu sagen, als religiöse Hymnen oder technische Anleitungen, die verloren gegangen sind. Eine zweite Betroffenheit als Mensch ergibt sich aus der Erkenntnis, dass alte Texte über geistesgeschichtliche Entwicklungen Auskunft geben, die unser Denken bis heute prägen, ohne dass wir uns dessen bewusst sind – und dass wir uns dessen nur bewusst werden und dadurch freier und verständiger werden können, wenn wir die alten Texte kennen. Hüter und Pfleger dieses wertvollen Erbes der Menschheit zu sein, das ist die faszinierende Aufgabe der Philologie. Dies ist die Faszination der Philologie, dies ist der Zauber, der von ihr ausgeht, dies ist die Ergriffenheit dessen, der mit alten Texten arbeitet.
Das gilt auch für zunächst unwichtig erscheinende Texte, denn man weiß nie, zu welchen Schlussfolgerungen sie führen können. Es ist ein komplexes, nie endendes Puzzlespiel, das ist richtig. Der Philologe ist Gralshüter und Schatzsucher zugleich. Auf dem Weg zum Schatz sind natürlich – Dan Brown lässt grüßen – einige faszinierende Rätsel zu lösen, aber das eigentlich faszinierende ist der Schatz. Der Weg ist nicht das Ziel.
Wilamowitz-Moellendorff ist da mit seiner Erkenntis der Pflichtethik aus dem humanistischen Menschenbild heraus erheblich näher am Thema dran als das Buch. Ein authentisches Verständnis von Pflicht, nicht als blinder Gehorsam, sondern als innerer Antrieb, das zu tun, was einem als Mensch zu tun zukommt, ein solches authentisches Verständnis von Pflicht kann z.B. aus alten Texten gewonnen werden, und den, der es begreift, ergreift es. Pflicht eben. Von dieser Ergriffenheit ist in diesem Buch aber nicht die Rede.
Demotivierender Defätismus
Statt dessen finden wir die völlig unverständliche Auffassung, dass niemand mehr an den Nutzen der Geisteswissenschaften glaube, und dass alle Versuche, einen Nutzen zu begründen, gewissermaßen unästhetisch seien. Unästhetisch? Wo doch das Schöne selbst der höchste Nutzen ist. Unverständlich.
Völlig unverständlich auch der folgende Satz: „Nie wieder möchte ich Behauptungen hören müssen wie den Satz, die Geisteswissenschaften seien ‚aufklärend‘, weil sie angeblich den Auftrag haben, ‚als Barriere gegen die Remythisierungstendenzen unserer Zeit‘ zu fungieren.“ – Gewiss, solche Anforderungen sind manchmal etwas oberflächlich. Die persönliche Ergriffenheit durch die Botschaft alter Texte ist immer zunächst intim und privat, und ihre Anwendung für die Öffentlichkeit erscheint manchmal als Schamverletzung und Profanierung. Aber solche Anforderungen sind eben auch nicht falsch, denn die Philologie kann das tatsächlich leisten. Fühlt sich der Autor dieses Buches denn nicht ergriffen von der Macht der Philologie, Einsichten bewirken zu können, zuerst bei sich selbst, und dann auch bei anderen?
Aber die Gedanken verlaufen seltsam krumm in diesem Buch. So heißt es z.B., dass Historisierung etwas „erschaffen“ würde, was sonst nicht da wäre. Das ist aber ganz falsch. Historisierung ist nichts anderes als eine richtige Erkenntnis von real existierenden Sachverhalten. Wer nicht erkennt, dass Dinge vergangen sind, einer anderen Zeit angehören, und unter der Perspektive dieser Zeit gesehen werden müssen, und nicht unter der Perspektive der Gegenwart, und dass die Perspektive der Vergangenheit einem Urteil unter der Perspektive der Gegenwart unterliegt, der schaut die Dinge nicht so an, wie sie sind, sondern der ist es, der den Dingen etwas zufügt, was sie nicht an sich haben. Ebenso ist es mit dem Klassischen. Klassisch ist, wo vergangene Perspektive und heutige Perspektive zusammenfallen. Etwas buchstäblich zeitloses. Auch da wird nichts „erschaffen“, sondern erkannt. Die Theorie dieses Buches, dass Historisierung sich nicht dem Streben nach richtiger Erkenntnis verdankt, sondern dem Streben nach der Überwindung des Todes, ist sehr schräg.
Es ist auch befremdlich, wie leicht sich der Autor dieses Buches der Auffassung hingibt, dass nach dem Tode nichts mehr komme. Woher will er das wissen? Das ist doch plumper Materialismus. Ein Geisteswissenschaftler weiß es doch besser. Es ist nicht so einfach. Es stört auch, wenn der Autor von seinen „sozialdemokratischen“ Instinkten spricht. Da fragt sich der Leser doch, ob das hier noch eine Abhandlung mit argumentativem Anspruch sein soll, oder eher ein persönliches Tagebuch? Seltsam auch, wenn die preußische Moral von Wilamowitz-Moellendorff mit „Eisen“ assoziiert wird und das für schlecht gehalten wird. Wäre eine Moral aus Gummi denn besser? Eisen ist doch für eine Moral eine sehr schöne Assoziation. Eisen lässt sich nämlich schmieden, verliert aber danach nicht so leicht seine Form, bricht aber andererseits auch nicht, sondern biegt sich, aber nur, wenn es gar nicht mehr anders geht. Man vergleiche auch mit Granit.
Und ach ja: Werner Jaeger … und dass man so heute nicht mehr denken könne. Nicht wirklich eine neue Einsicht. Aber was dann? Wie sollen wir denn Identität sinnvoll konstruieren? Denn ohne Identität lebt es sich nicht gut. Werner Jaeger hat uns eine Aufgabe gestellt, die wir noch nicht gelöst haben. Immer diese abwehrenden Reden gegen Jaeger, deren bloße Existenz das Eingeständnis ist, dass an Jaeger doch was dran war. Wenn an Jaeger nichts dran gewesen wäre, würde man von ihm nämlich schweigen. Es ist also ein komplexes Problem, das schon Jahrzehnte ungelöst vor uns liegt. Man könnte das faszinierend finden. Und sich zur Tat animiert fühlen.
Wir leben in einer Zeit, in der das Wort „Humanismus“ eine äußerst bedenkenswerte Bedeutungsverschiebung in der Wahrnehmung der Öffentlichkeit erfährt: Unter „Humanismus“ verstehen heute viele eine auf Atheismus gegründete Weltanschauung. Es ist so töricht. Und so elend. Man könnte sich dagegen empören. Aus innerster Seele. Dieses ganze gegenwärtige Unverständnis für das Erbe der Vergangenheit, für Tradition, für die Tiefe der Geschichte, für die conditio humana, und wie darüber die Errungenschaften des Westens aufgegeben werden zugunsten eines kulturvergessenen Kulturrelativismus: Man könnte sich darüber empören und kreativ werden. Daran geht dieses Buch aber vorbei.
Fazit
Ein Buch, das vor manche Tür geführt hat. Hineingehen musste man aber immer selber. Das Buch blieb draußen.
Bewertung: 2 von 5 Sternen.
(Erstveröffentlichung auf Amazon am 08. Oktober 2017)