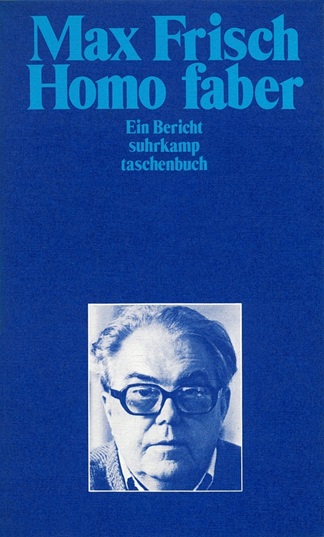
Tristesse des alternden, egozentrischen Materialisten – Ohne konstruktive Perspektive
Der Roman „Homo faber“ von Max Frisch zeigt den Schweizer Ingenieur Walter Faber im Alter von 50 Jahren, der für die Unesco Turbinen in Mittelamerika montiert, und der für seine Arbeit in New York wohnt und dabei auch nach Paris zu Konferenzen fliegt. Technisches Jet-Set sozusagen. Das Wort „faber“ bedeutet auf Lateinisch Handwerker oder Arbeiter.
Ein Hauptthema des Buches ist die bloß rationale, technische Intelligenz des egozentrischen Protagonisten. Für Faber gibt es praktisch keine Gefühle. Er ist immer sachlich. Alles ist planbar und erklärbar. Der Mensch ist für ihn eine schlecht konstruierte biologische Maschine. Roboter werden bald vieles besser können als der Mensch. Wenn nicht alles. Abtreibung ist für ihn eine Notwendigkeit zur Geburtenregelung, moralische Fragen nur sachfremd und störend. Literatur liest er keine. Er ist der perfekte Praktiker und Materialist. Die Welt des Geistes ist ihm verschlossen. Damit ist er natürlich auch etwas egozentrisch.
Das Buch ist als endloser Monolog gestaltet, den Walter Faber mit sich selbst führt, während er die Ereignisse aus der Erinnerung heraus nacherlebt. Dabei geht es immer praktisch zu. Und alles ist von einer gewissen Tristesse. Faber sieht das Schöne und Interessante nicht. Immer nur die Sache. Wir erleben die Tristesse des Fliegens und der Flughäfen, die Tristesse des mexikanischen Niemandslandes, wo seine Maschine notlandet, die Tristesse des Regenwaldes im Grenzgebiet von Mexiko und Guatemala, die Tristesse des Zusammenlebens mit dem geistlosen Mode-Flittchen Ivy in New York, die Tristesse der Party mit Arbeitskollegen. Immer wieder werden auch ekelhafte Bilder eingestreut, so z.B. die Zerreißung eines Eselkadavers durch Zopilote-Vögel.
Die geordnete Welt von Faber bekommt aber Risse: Die Tristesse richtet sich auf Erinnerungen und wird dann melancholisch. Seinen Jugendfreund Joachim trifft er erhängt im Regenwald von Guatemala. Wie er erfährt, hatte dieser einst seine Jugendfreundin Hanna geheiratet. Es kommen ihm Erinnerungen an das Aneinandervorbeireden mit Hanna, die Philologie studierte und ihn „homo faber“ nannte. Und wie Hanna – die Irrationalität in Person – ihn nicht heiraten wollte und sie schließlich voneinander schieden mit der Entscheidung, dass das gemeinsame Kind abgetrieben werden sollte. Außerdem beginnt der zuverlässige Ingenieur Faber, vor seinen Pflichten zu fliehen: In Houston versucht er spontan, das Flugzeug absichtlich zu verpassen. In Mexiko fährt er spontan zu seinem Jugendfreund statt zur Montage. In Rom begleitet er spontan das Mädchen Sabeth auf ihrem Trip nach Südfrankreich, Italien, Griechenland, wo deren Mutter lebt. In Avignon schläft er einmal mit ihr. Faber erlebt halbwegs frohe Tage.
Das zweite große Thema des Buch ist das Altern. Faber ist 50 geworden, und versucht mit Sabeth eine Art zweiten Frühling. Doch er bemerkt, dass er die Jugend nicht mehr richtig versteht. Es gibt keinen zweiten Frühling. Zweimal heißt es: Wir können nicht unsere eigenen Kinder heiraten. Man kann nicht unverändert leben, das Altern gehört zum Leben dazu.
In Griechenland erleidet Sabeth einen unnötigen Unfall und stirbt. Es stellt sich heraus, dass sie das nicht abgetriebene gemeinsame Kind mit Hanna war, die er nun in Griechenland wiedertrifft. Hanna arbeitet als Archäologin und Faber staunt, dass man davon leben kann. Die Situation ist schal und trist: Faber war also in seine eigene Tochter verliebt. Und Faber ist zwar nicht wirklich schuld am Tod der gemeinsamen Tochter, doch sein Wiederauftauchen im Leben von Hanna fällt mit diesem Ereignis zusammen. Hanna lässt Faber trotzdem bei sich wohnen. Faber will sein Leben ändern. Es bleibt aber unklar, wie. Schließlich muss sich Faber wegen eines Magenleidens einer Operation unterziehen. Er tut dies in Griechenland, bei Hanna. Zwei gescheiterte Existenzen nähern sich einander an.
Nebenthemen
Der Deutsche Herbert blamiert sich als Nachkriegsdeutscher vor dem Schweizer. Walter Faber mag die Deutschen nicht.
Es gibt antiamerikanische Passagen: Die Amerikaner würden angeblich die Welt kolonisieren und aus allem einen Highway machen. Sie seien fett, ungebildet, und herrschten mit ihren Dollars. Amerikaner seien geschminkt, und ihre Leuchtreklame bloße Kulisse und Kitsch. „Aber wir leben von ihren Dollars.“ – Intelligente Kritik an Amerika gibt es in diesem Buch nicht.
Mindestens zweimal wird das intuitive Verhalten von Frauen „weibisch“ genannt. Für die Toilettenfrau am Flughafen in Houston und für die Huren in Havanna wird das Wort „Neger“ verwendet. Damit wäre auch Max Frisch für den aktuell herrschenden hysterischen Zeitgeist nicht mehr akzeptabel.
Kritik
Literarisch und sprachlich ist das Buch sehr gut gelungen. Jeder Satz sitzt. Jede Stimmung wird verlässlich eingefangen. Rück- und Vorblenden sind geschickt ineinander verwoben. Unpassend vielleicht, dass das Zusammentreffen mit Sabeth ein literarisch schlecht motivierter, unglaubwürdiger Zufall ist, nachdem Faber bereits zuvor durch einen ebensolchen Zufall auf seinen alten Jugendfreund gestoßen war.
Die Frage ist, was das Buch aussagen will. Die Bearbeitung des Themas Altern ist zumindest nicht originell. Besser steht es um die Kritik an der allzu praktischen, materialistischen Einstellung des Protagonisten. Aber auch hier werden Alternativen nur angedeutet. Die Irrationalität der Frauen, speziell von Hanna, wird auch keiner Lösung zugeführt. Beide sind gescheiterte Existenzen, Faber und Hanna: Der eine ist an seiner ausschließlichen Rationalität, die andere ist an ihrer ausschließlichen Irrationalität gescheitert. Ein gelungenes Leben wäre es gewesen, so liest sich dieser Roman ex negativo, wenn sie geheiratet und das gemeinsame Kind gemeinsam aufgezogen hätten. Doch das ist nicht mehr rückholbar und alle leiden nur noch melancholisch daran, anstatt konstruktiv zu werden.
Das Buch hinterlässt den Leser eher ratlos als bereichert. Da hilft auch die literarische Qualität nicht. Max Frisch scheint ein guter Beobachter aber ein schlechter Denker zu sein. Etliche Elemente des Romans sind offensichtlich autobiographisch motiviert. Das Leben von Max Frisch liefert genauso gutes Anschauungsmaterial und ist genauso wenig überzeugend wie dieser Roman.
Bewertung: 3 von 5 Sternen.
(Erstveröffentlichtung auf Amazon am 08. August 2020)

