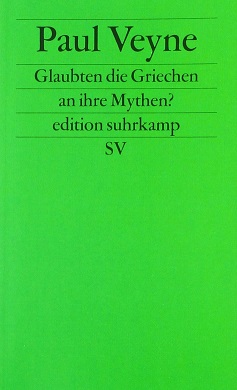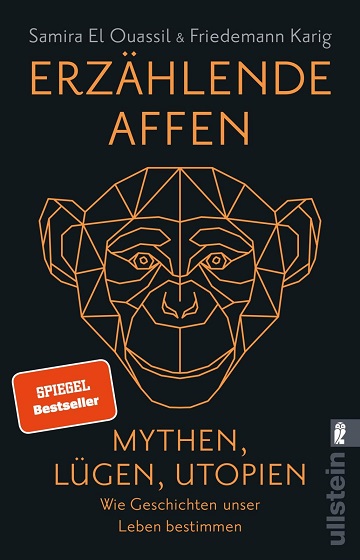Die links-ideologische Bildungsillusion hinter dem aktuellen Zeitgeist
Der Leser erwartet sich von diesem Buch – nach einem kurzen Blick auf Titel, Klappentext und Inhaltsverzeichnis – eine hilfreiche Aufklärung über das Phänomen der Narrative, d.h. über die Kraft und die Macht von Erzählungen: Wie wirken sie? Warum wirken sie? Wie können wir sie zum Guten nutzen? Was können wir gegen Missbrauch tun? Und das im Kontext der neuen sozialen Medien?
Doch das ist nur der Köder, mit dem der Leser eingefangen werden soll. Es geht um etwas ganz anderes. Weil dieses Buch auf den ersten Blick so sympathisch daher kommt, weil es den aktuellen Zeitgeist in manchen Milieus so gut trifft, und weil es eine weite Verbreitung gefunden hat – selbst Denis Scheck hat es empfohlen – lohnt es sich, dieses Buch sehr gründlich zu besprechen. Denn es ist gefährlich und böse.
Der Inhalt
Alles beginnt recht erfrischend und informativ. In der ersten Hälfte des Buches erfährt der Leser sehr viele Dinge aus der Welt der Geistes- und Naturwissenschaften über Literatur, Narrative und ihre Wirkung. Dazu gehört das Ur-Narrativ der klassischen „Heldenreise“, aber auch typische Denkfehler und Denkfallen, sowie Erkenntnisse aus Hirnforschung und Psychologie. Vieles davon hat man selbst schon irgendwo gelesen, manches aber nimmt man gerne neu in seinen Wissensschatz auf. Die Autoren schreiben aus Überzeugung und mit großer Lebendigkeit.
Etwas unangenehm fallen allerdings viele sachliche Fehler und schiefe Perspektiven auf, die jedoch vereinzelt bleiben. Befremdlich wirkt mit der Zeit auch, wie die Autoren den Leser non-stop mit vorgefertigtem Wissen füttern, Häppchen für Häppchen, wie in einem Was-ist-Was Buch: Seite für Seite werden immer neue Autoren und ihre Werke aufgezählt, und was sie zu diesem oder jenem Thema zu sagen haben. Dennoch: Die erste Hälfte des Buches kann noch viel Sympathie einfangen, und der Leser glaubt vielleicht noch, dass die Irrtümer nur unverbundene Einzelfälle wären.
Spätestens in der zweiten Hälfte des Buches wird dann klar, wohin die Reise geht, nämlich hinein in das gigantische Rabbit Hole jener irrigen Ideologien, die aktuell unseren Zeitgeist beherrschen. Der Leser soll sichtlich Schritt für Schritt in dieses Rabbit Hole hineingeführt werden. Es hat seine eigene Ironie, dass die Autoren dieses Buches selbst davor warnen, in irgendein narratives Rabbit Hole abzugleiten (S. 303), denn genau das haben sie mit dem Leser vor.
In aller Kürze geht es um folgendes (mehr dazu im Einzelnen unten): Die Menschheit befindet sich, so die Autoren, kurz vor dem Untergang. Die Klimakatastrophe wird in allerschwärzesten Farben gemalt. Hinzu kommen Rassismus und Hass. Schuld an der Misere haben der Kapitalismus und das Patriarchat. Und falsche Narrative. Deshalb werden die traditionellen Narrative analysiert und hinterfragt. Die Autoren glauben, dass eine Änderung der Narrative die Rettung in Form einer radikalen, großen Transformation der Gesellschaft bringen wird. Wir brauchen, so die Autoren, neue Erzählungen von vernetzten Heldinnen, nicht von einzelnen Helden, und wir brauchen neue Erzählungen von schlimm-schrecklichen Öko-Katastrophen aller Art, sowie natürlich neue Erzählungen von paradiesischen Öko-Utopien in der Zukunft, garniert mit sozialistischer Gleichheit für alle Menschen und „fluider“ Geschlechtsidentität für alle Kinder im Sinne der woken Identitätspolitik.
Ideologie statt Bildung
Eines fehlt in diesem Buch penetrant: Nämlich der Gedanke, wie man überhaupt erst herausfindet, welche Narrative wahr und welche falsch sind. Dabei wäre das doch die erste und entscheidende Frage, die geklärt werden müsste! Also die Frage nach der skeptischen Vernunft und nach der philosophischen Methode, mit der wir uns im Dschungel der Narrative orientieren können. Doch diese Frage wird das ganze Buch über konsequent nicht gestellt. Im Gegenteil: Die Autoren gehen Seite für Seite mit größter Autorität davon aus, dass sie immer bereits wissen, was wahr und richtig ist. In diesem Sinne werden auch die vielen Autoren und ihre Werke Seite für Seite präsentiert und ihre Thesen vorgestellt: Nämlich so, wie wenn sie uns die reine Wahrheit offenbaren würden. Nirgends findet sich eine Präsentation verschiedener Sichtweisen, nirgends eine Abwägung verschiedener Argumente, nirgends eine Einschränkung, dass man einem Autor nur teilweise folgt. Und die Antwort auf die Frage, was den Menschen vom Tier unterscheidet und ihn befähigt, Probleme zu lösen, lautet in diesem Buch explizit nicht „Vernunft“, sondern „Narrative“ (S. 471 f.).
Hier zeigt sich die ganze Bildungsillusion derer, die dem aktuellen Zeitgeist anhängen: Sie kennen so viele Autoren und haben so viele Bücher gelesen, aber sie lesen sie, als ob es scholastische Autoritäten des Mittelalters wären, denn sie haben offenbar das eigene Denken nicht gelernt. Dabei gäbe es zu jedem Thema tausend Varianten und Nuancen, wie sich eine eigene Meinung entwickeln könnte! Doch dieses Buch bleibt völlig stromlinienförmig und konform bei den Aussagen der zitierten autoritativen Autoren. Wo gibt es denn sowas?! Damit müssen wir leider das Urteil fällen, dass die Autoren dieses Buches nicht wirklich gebildet sind. Die Kenntnis von „Gelesenem“ ist immer nur Anfang und Grundlage von Bildung. Sich dazu seine ganz eigenen Gedanken gemacht zu haben, quer zu allen Autoritäten, ist jedoch die wahre Bildung. Und daran fehlt es hier dramatisch.
Andersdenkende und alternative Meinungen kommen in diesem Buch immer nur als Verführte vor, die sich von falschen Narrativen zu Verschwörungstheorien haben verleiten lassen. Das Recherchieren im Internet, ob eine Story stimmt oder nicht stimmt (wahrlich eine der Segnungen unserer Zeit für alle denkenden Menschen!), wird in diesem Buch verächtlich in Anführungszeichen geschrieben: „Recherchieren“ (S. 301). – Und wenn die Andersdenkenden keine verführten Seelen sind, dann sind es Bösewichte, die wider besseren Wissens gegen die Wahrheit reden, z.B. „Zweifelhändler“ im Auftrag der Ölindustrie gegen das Narrativ der großen Klimakatastrophe (S. 235 ff.). Auf diese Weise verschließen sich die Autoren aber gegen jede Kritik und gegen jeden Diskurs. Sie gehen nie auf Argumente ein. Das ist weder gebildet, noch aufgeklärt, noch vernünftig, noch demokratisch. So mancher Leser wird vielleicht auf Antworten gehofft haben, wie eine demokratische Gesellschaft mit dem Chaos der verschiedenen Narrative im Spannungsfeld von Freiheit und Lüge umgehen soll. Doch diese Frage erübrigt sich unter der dogmatischen Perspektive dieses Buches vollständig.
Zudem werden alle Argumente ideologisch „enggeführt“. Das bedeutet, dass alles immer dermaßen auf die Spitze getrieben wird, dass stets nur Radikalität als Ausweg bleibt. Nie ist davon die Rede, dass es sich lediglich um worst-case-Szenarien handelt, die wahrscheinlich niemals eintreten. Nie wird die alte Erfahrung reflektiert, dass nichts so heiß gegessen wird, wie es gekocht wird. Szenarien werden als Prognosen fehlinterpretiert und Risiken stets auf die Spitze getrieben. Die Unfähigkeit zum vernünftigen Umgang mit Risiken ist aus der Öko-Szene wohlbekannt. Aber auch Rechtsradikale handeln so, wenn sie z.B. mit Scheuklappen vorrechnen, dass sie „nur noch zehn Jahre Zeit“ haben, um die angeblich drohende finale Überfremdung ihres Landes zu stoppen. Doch diese auf die Spitze getriebenen worst-case-Szenarien und Risiko-Erwartungen sind grundfalsch und völlig unrealistisch. Mit diesem Mindset wird jeder Gang vor die Tür zum lebensgefährlichen Risiko. Zuletzt erlebten wir diesen irrigen Umgang mit Risiken in der Corona-Krise, wo Maßnahmen und Risiken oft in keinem guten Verhältnis mehr zueinander standen. So geht es in diesem Buch Seite für Seite zu, und nicht zufällig schlägt sich dieses Buch en passant auf die Seite derer, die überstrenge Corona-Maßnahmen befürworteten.
Unwahrhaftigkeit und Manipulation
Hinzu kommt, dass die Autoren dieses Buches immer wieder bei offensichtlichen Unwahrheiten ertappt werden können. Ob es die völlige Negierung der Wahrheit in der Geschichte der 300 Spartaner ist, oder die Verdrehung eines Zitates von Sebastian Haffner über die Selbstlosigkeit der Deutschen in sein Gegenteil (siehe Details unten): Es sind zu viele Fälle, um noch glauben zu können, dass die Autoren es ernst mit ihren Lesern meinen. Hierher gehört auch die weichgespülte Darstellung des Wokismus, der angeblich lediglich auf Gleichberechtigung und Toleranz aus sei, oder das Verschweigen der ideologischen Hintergründe dieses Buches, die nie offen angesprochen werden sondern immer nur in Andeutungen zum Ausdruck kommen, wie z.B. linksradikale politische Vorstellungen oder die postmoderne Philosophie und ihre radikalen Thesen. Nicht zuletzt ist hier auch der Aufbau des Buches als einer schrittweisen Einführung in ein ideologisches Rabbit Hole zu nennen. Es ist fast wie die Initiation in eine Geheimsekte, in der auf jeder Einweihungsstufe mehr über die wahren Inhalte der Sektenlehre verraten wird. Es ist offensichtlich, dass die Autoren die Leser nicht von Anfang an offen informieren, sondern Schritt für Schritt auf ein Ziel hin manipulieren wollen.
In Zusammenhang mit der fehlenden Vernunft und Wahrhaftigkeit wird dann auch der Titel des Buches im Laufe der Lektüre immer fragwürdiger: „Erzählende Affen“. Denn der Mensch wird in diesem Buch durchgängig als erzählender Affe angesprochen, den es zu „zähmen“ gelte (S. 480). Wie wenn der Mensch keine Vernunft hätte. Von Vernunft ist nie die Rede. Es wird immer nur über Narrative gesprochen, mit denen man die Menschen unterschwellig zu einem gewünschten Verhalten bewegen möchte. An einer Stelle ist auch von Moral und Ehre als Motivation die Rede: Aber nur im Sinne eines Gesichtsverlustes! (S. 463) Wie wenn Menschen nicht auch aus einer inneren Moral heraus richtig zu handeln imstande wären, sondern immer nur zur Vermeidung eines Gesichtsverlustes. Was für ein Menschenbild ist das? Sind wir wirklich nur Affen, die Narrative nachplappern? Die keine Moral kennen, sondern nur die Angst vor Strafe? Haben wir nicht Vernunft und können wir nicht Argumente abwägen? Sind wir nicht souveräne, verantwortungsbewusste Bürger eines demokratischen Staates?!
Gewiss, die Psychologie spielt uns manchen Streich und die Vernunft hat es oft schwer. Dennoch hat uns die Vernunft dazu geführt, solche überaus komplexen Problemlösungen wie z.B. Demokratie, Marktwirtschaft, Wissenschaft und moderne Technik hervorzubringen. Man sollte die Vernunft also nicht unterschätzen. Der Mensch ist definitiv mehr als nur ein erzählender Affe, und er verdient es, gemäß seiner Würde als Mensch ernst genommen zu werden. Die Autoren dieses Buches kritisieren den Erfinder der „Public Relations“ Edward Louis Bernays scharf, weil er ein zynisches Menschenbild hatte, demzufolge die Menschen eine Herde sind, die gelenkt werden muss (S. 222). Und sie zitieren Hannah Arendts Kritik an den Mächtigen, die glauben, die Menschen mit psychologischen Tricks manipulieren zu können (S. 231). Aber sie selbst wollen ganz offenbar nichts anderes.
Den Menschen überwinden
Zum Ende des Buches hin gehen die Autoren sogar noch einen Schritt weiter. Zum Schluss stellen die Autoren fest, dass es gar nicht darum geht, eine neue Erzählung zu finden, in der der Mensch zu einem „guten“ Protagonisten im Einklang mit seiner Umwelt wird. Sondern es gehe darum, dass der Mensch selbst der Antagonist der Natur sei, d.h. der inhärente Feind der Natur (S. 475). Damit sind wir in der tiefsten Höhle des Rabbit Hole angelangt: Denn die Überwindung des Menschen ist das Anliegen der Postmoderne, und die postmoderne Philosophie von Foucault & Co. liegt diesem ganzen falschen Denken natürlich zugrunde. Und wie immer in solchen Büchern wird das Ziel der Überwindung des Menschen nur auf den letzten Seiten angedeutet. Es wird nie ausformuliert, was es konkret heißen soll. Die Richtung ist aber klar.
Philosophisch ist die Aufgabe der menschlichen Perspektive völliger Unsinn und gefährlich. Der Mensch kann sich nicht aus seiner eigenen Perspektive lösen. Eine Landschaft wird immer nur durch das Auge des Betrachters schön. Ohne das Auge des Betrachters ist niemand da, der eine Landschaft schön finden könnte. Der Mensch kann sich nicht selbst aus dieser Rechnung herausnehmen. Diese Welt hat entweder einen Sinn mit und für den Menschen, oder sie hat eben keinen Sinn für den Menschen. Wozu sollte ein Mensch Rücksicht auf die Natur nehmen, wenn er selbst aus dem Spiel herausgenommen wird? Ohne den Menschen ist die Natur eine öde Gegebenheit ohne Sinn und Schönheit. (Zumal für unsere Autoren, die aus ihrem Materialismus keinen Hehl machen, dazu weiter unten mehr.) Und überhaupt: Wie weit will man darin eigentlich gehen, den Menschen als inhärent böse anzusehen und ihn deshalb aus dem Spiel zu nehmen?
Verdeutlicht wird dieser Schwenk in der Deutung des Menschen vom Protagonisten zum Antagonisten anhand der Ilias des Homer: Hier ginge es angeblich um Gewalt, und zwar um maßlose Gewalt. Und so sei der Mensch eben, und deshalb sei der Mensch selbst das Problem (S. 473-475). Man stelle sich vor: Homers Ilias als „Beleg“ für diese Wahnsinnsthese! Und das von Autoren, die sich für literarisch gebildet halten: Ha! Denn die Ilias ist nicht nur das erste und zentrale literarische Werk der mittelmeerischen Kulturen, sondern ein Werk, dessen Kulminationspunkt eben gerade nicht (!) die maßlose Gewalt ist, sondern die Erkenntnis – in der Begegnung von Priamos und Achill – dass auch der Feind ein Mensch ist und Empathie verdient, wie auch Hannah Arendt einst herausstrich. Wie konnten die Autoren das nur übersehen!
Damit ignorieren sie 3000 Jahre humanistische Kultivierung des Menschen hin zu Vernunft und Empathie. Statt dessen räumen sie Vernunft, Diskurs, Aufklärung, Humanismus, Empathie im Rahmen ihres postmodernen Wahnes einfach komplett ab, und setzen ganz auf die Manipulation des „erzählenden Affen“ durch Narrative, von deren „Richtigkeit“ die Autoren dogmatisch überzeugt sind. Wie jämmerlich. Fast möchte man den Umstand, dass die Autoren dieses Buches ausgerechnet an der Deutung von Homer, der Grundfeste der klassischen humanistischen Bildung, gescheitert sind, als ein prophetisches Zeichen deuten: Am Ende werden Vernunft und Bildung obsiegen, und das Reich der erzählenden Affen wird untergehen.
Es gibt keine Wahrheit
Zum postmodernen Denken gehört natürlich auch die Überzeugung dazu, dass es so etwas wie Wahrheit im Grunde gar nicht gibt, und die Frage nach der „Wahrheit“ durch Machtspiele entschieden wird: Es gilt das Recht des Stärkeren. Es gibt keine wahren Narrative, die man durch Nachdenken finden könnte, sondern nur Narrative, die sich durchsetzen. Die Autoren sprechen das nie so explizit aus, aber diese Ideologie zeigt sich in allem.
Deshalb wird in diesem Buch gar nicht erst nach Wahrheit gesucht. Deshalb wissen die Autoren immer schon autoritativ, was „richtig“ ist. Und tatsächlich schreiben die Autoren dieses Buches, dass das Erzählen des Menschen von jeher zwischen Wahrheit und Fiktion changiert habe, und sie fügen hinzu, dass wir uns im Laufe der Zeit kaum verändert hätten (S. 226). Dass sie damit ein unglaublich zynisches und antihumanistisches Menschenbild bedienen, fällt ihnen nicht auf! Ist es nicht Teil der menschlichen Bildung und Aufklärung, sich so gut es geht über die bloßen Reflexe zu erheben und nach Wahrheit zu streben, auch wenn sie nicht gefällt? Der gebildete Mensch weiß, dass es keine gute Idee ist, die Wirklichkeit zu ignorieren, weil man sonst früher oder später unsanft mit der Wirklichkeit zusammenstoßen wird. Aber schlimmer noch: Die Autoren dieses Buches zitieren selbst Viktor Klemperers Kritik am Nationalsozialismus mit den Worten: „Entthronung der Vernunft, die Animalisierung des Menschen, die Verherrlichung des Machtgedankens“ (S. 284) In diesen Spiegel sollten die Autoren dieses Buches einmal selbst schauen. Sie selbst führen auch Timothy Snyder an: „Wenn nichts wahr ist, dann kann niemand die Macht kritisieren“ (S. 293) Aber um die Frage nach der Wahrheit kümmern sich die Autoren das ganze Buch hindurch nicht.
Es ist kein Zufall, dass die Autoren am Ende ihres Buches das Bild von der blauen und der roten Pille verwenden (S. 477), das sie in vorigen Kapiteln immer als Symbol von üblen Verschwörungstheorien gedeutet hatten, deren Anhänger glauben, mehr zu wissen als andere: Denn nun sind es die Autoren dieses Buches selbst, die von ihren Lesern die Entscheidung verlangen, die rote Pille zu schlucken, ihre Ideologie zu glauben und sich „erweckt“ (woke) zu fühlen.
Fazit
Wer wissen möchte, welches falsche Denken und welche falschen Gedankeninhalte zur Zeit in den Köpfen vieler linker Zeitgenossen ihr Unwesen treiben und auf diese Weise unsere Kultur Schritt für Schritt zerstören, der ist mit diesem Buch gut bedient. Wohl kaum an einer anderen Stelle wird das ganze Spektrum dieses ideologischen Irrsinns so breit entfaltet wie hier. Thema für Thema werden viele jener Autoren aufgezählt, denen wir den jeweiligen Irrsinn zu verdanken haben. Allerdings bleiben die eigentlichen Urheber, wie z.B. Judith Butler oder die postmodernen Philosophen, unerwähnt. Hinzu kommt die Unwahrhaftigkeit der Autoren dieses Buches und ihre manipulative Absicht.
Dieses Werk ist ein eindrückliches Zeugnis jener links-ideologischen Bildungsillusion, die aktuell unseren Zeitgeist bestimmt. Und das, was in diesem Buch konsequent fehlt, macht sich dem kundigen Leser geradezu schreiend als schmerzliche Lücke deutlich: Echte Bildung! Echte klassische, humanistische, aufgeklärte Bildung. Gut, dass wir auf diese Weise daran erinnert wurden, was Bildung ist und welchen Wert sie hat.
Einzelnes
Im folgenden werden wir einzelne Aspekte aus der schier unendlichen Fülle von Irrtümern dieses Buches herausgreifen, thematisch sortieren, und mit Seitenzahlen versehen näher beleuchten, damit Interessierte es leichter haben, sich selbst ein Bild zu machen.
Die Macht der Narrative
Die Autoren überschätzen die Macht und die Kraft von Narrativen maßlos. Sie glauben allen Ernstes, dass sie durch die richtigen Narrative erreichen könnten, dass freie Menschen deutliche Wohlstandsverluste zugunsten eines fragwürdigen Klima-Narrativs hinnehmen werden (S. 398, 467, 477). Sie bemerken nicht, wie unrealistisch das ist, selbst wenn das schwarzmalerische Klima-Narrativ überzeugender wäre, als es tatsächlich ist. Gleichzeitig berichten die Autoren, dass immer noch 20-50% der Bevölkerung mehr oder weniger an Astrologie glauben (S. 427). Das ist dieselbe Bevölkerung, von der die Autoren glauben, sie wäre mit veränderten Narrativen zu großen Verzichtsleistungen bereit.
Aber die Autoren glauben ja auch, dass man das Wesen von Mann und Frau drastisch verändern könnte, wenn man nur die Narrative ändert, und so auch die Monogamie überwunden werden könnte (siehe später). Sie glauben auch, dass „selbst bisher von Ideologien unbeeindruckte Menschen“ in das Rabbit Hole einer Verschwörungstheorie hineinstolpern können (S. 303). Doch das ist nur im Einzelfall richtig, in der Tendenz jedoch falsch. Es gibt durchaus eine innere Immunität gegen falsche Narrative, nämlich Bildung und Bodenständigkeit. Aber von Bildung und Bodenständigkeit verstehen die Autoren dieses Buches nicht viel.
Die Autoren dieses Buches meinen, dass der „erzählende Affe“ lernen müsste, mit Komplexität und Uneindeutigkeit umzugehen, und Verschiedenheiten mit Ambiguitätstoleranz zuzulassen (S. 443 f.). Damit ist an dieser Stelle allerdings nicht die Toleranz in einer Demokratie gemeint. Zur Toleranz in der Demokratie haben die Autoren eine ganz andere Meinung, siehe unten. Was sie hier meinen, ist, dass der Mensch lernen muss, in unsicheren Verhältnissen zu leben, in denen es normal ist, dass alles Gewohnte wegbricht. Doch das ist utopisch. Vielmehr wird umgekehrt ein Schuh daraus: Gerade dann, wenn Menschen sich sicher fühlen, gerade dann sind sie besonders bereit dazu, sich zu öffnen und tolerant zu sein. Die Vorstellung, dass man den Menschen alles wegnimmt und ein großes Babylon erschafft, und sich daraufhin die radikal verschiedenen Menschen friedlich um ein gemeinsames Lagerfeuer scharen, ist utopisch. Babylon funktioniert nur als Diktatur. Darauf hatte schon Helmut Schmidt hingewiesen.
Die Klimakatastrophe
Die Autoren beginnen ihr Buch mit der Erklärung: „Wir sind uns darüber im Klaren, dass unsere Welt ungerecht ist und schlichtweg langsam kaputtgeht“, und: „Unsere epische Entwicklung als Spezies stellt uns vor die größte Herausforderung unserer Geschichte: die fortschreitende Zerstörung unserer Lebensgrundlagen.“ (S. 18 f., 20). An anderer Stelle werden alle möglichen Wetterkatastrophen aufgezählt und pauschal als Folgen des Klimawandels gedeutet (S. 447), so wie es uns der öffentlich-rechtliche Journalismus in seiner Qualitätslosigkeit ständig vorführt. Auch die Klima-Kipppunkte werden als wissenschaftlich gesichertes Argument genannt (S. 391), obwohl nur eine Minderheit von Wissenschaftlern vor Klimakipppunkten warnt.
Die Bilder eines brennenden Gaslecks im Ku-Maloob-Zaap-Komplex des staatlichen Energiekonzerns Pemex im Golf von Mexiko vom Juli 2021 werden hysterisch dramatisiert: „ein kreisrundes Inferno, von Menschen gemacht, aber von Menschen kaum mehr beherrschbar“ (S. 470). In Wahrheit wurde das Leck nach wenigen Stunden erfolgreich verschlossen. Niemand wurde verletzt, es musste nicht einmal jemand in Sicherheit gebracht werden. Es entstand auch kein Ölteppich. – Auch der Fleischkonsum wird ins Extrem gezogen: Tiere würden gequält, Tiere würden willkürlich getötet, und Fleischkonsum sei generell unsozial, klimaschädlich und hochsubventioniert (S. 464). Dass der Mensch für eine ausgewogene, natürliche Ernährung auch Fleisch benötigt, bleibt hingegen ungesagt.
Schließlich wird auch die These verbreitet, der Klimawandel wäre am Auftreten von Corona schuld. Angeblich würde der Klimawandel dazu führen, dass immer mehr Tiere ihren angestammten Siedlungsraum verlassen. Das würde zu Stress führen, und der Stress mache die Tiere anfälliger für Viren (S. 449-452). Obwohl die Autoren anfangs auch einen Laborursprung des Corona-Virus für möglich hielten (S. 448), schreiben sie nur wenige Seiten später über die Corona-Pandemie: „Wir wissen sehr genau, wie wir sie uns eingehandelt haben, wir kennen die Auslöser“ (S. 452), nämlich den Klimawandel. So geschieht es in diesem Buch oft: Erst wird der Anschein der Offenheit erweckt, doch dann wird rigoros auf eine dogmatische Linie eingeschwenkt.
Die These vom Klimawandel als Ursache der Corona-Pandemie ist jedenfalls Unfug. Denn der Klimawandel setzt den Tieren derzeit noch kaum zu. Vielmehr sind es Vorgänge wie z.B. Abholzung, unter denen die Tiere womöglich leiden. Schließlich kommt hinzu, dass Viren vor allem dort auf den Menschen überspringen, wo illegal Wildtiere gefangen und verzehrt werden. Diese traditionelle Sitte ist wesentlich eher verantwortlich für das Überspringen von Viren als alles andere. Schließlich gab es auch in der Vergangenheit immer wieder Pandemien, und das ganz ohne menschengemachten Klimawandel: Ob Spanische Grippe, Asiatische Grippe, Hongkong-Grippe oder Schweinegrippe, Aids nicht zu vergessen – es ist normal, dass es ab und zu eine Pandemie gibt, genauso wie es normal ist, dass es in einem naturbelassenen Wald ab und zu einen Waldbrand gibt. Aber diese einfachen Wahrheiten will man nicht hören. Die Autoren ziehen folgendes Narrativ vor: Es sei so, als hätte die „Wirtschaft“ beschlossen, „den mit Coronaviren und anderen Krankheitserregern gefüllten Behälter in die Höhe zu heben und die ganze Ladung anschließend über sich selbst zu vergießen.“ (S. 452) Das ist irrationale Panikmache pur!
Lösungsvorschläge zur Klimakatastrophe
Konkrete Lösungsvorschläge zur Klimaproblematik gibt es in diesem Buch fast keine. Der Schwerpunkt wird woanders gesetzt: Der gegenwärtige Zustand der Menschheit sei suizidal, und deshalb seien nicht irgendwelche Öko-Utopien utopisch, sondern im Gegenteil sei vielmehr der aktuelle Zustand der Menschheit die böse Utopie, die es um jeden Preis zu vermeiden gelte. Und deshalb sei jede Öko-Utopie, und sei sie noch so unwirklich, besser, als nichts zu tun (S. 468-470). Ja, in der Tat: So flach und so klischeehaft gehen die Autoren vor, man glaubt es kaum. Dieses Buch schafft es tatsächlich, dass sich jedes Vorurteil gegenüber Öko-Utopisten in ein wohlbestätigtes Urteil verwandelt.
An einer einzigen Stelle wird kurz der „endgültige Umstieg auf erneuerbare Energien“ beschworen, also Sonne und Wind allein (S. 465). Dass das aus rein technischen Gründen gar nicht geht (Dunkelflaute, Flächenbedarf, Speichermangel, Wandlungsverluste bei Wasserstoff, usw. usf.) haben die Autoren dieses Buches nicht begriffen. Es wird nirgends explizit gesagt, aber alles läuft auf ein gigantisches Degrowth-Programm von Verbot und Verzicht hinaus. Die Idee, dass Technologie uns retten könnte, wird explizit als Märchen verworfen (S. 365). Von Atomkraft ist gar nicht erst die Rede. Mit keinem Wort. Dieses viele Schweigen und die eingeschlagene Richtung lässt wenig Raum für Spekulation, was die Autoren tatsächlich wollen: Die Rückkehr in vorindustrielle Zustände. Mindestens.
Nicht zufällig wird explizit die Parallele zwischen der Corona-Pandemie und der Klimakatastrophe gezogen (S. 447, 456 f.; um S. 466). Die Autoren dieses Buches meinen, dass man in beiden Fällen der Wissenschaft hätte folgen müssen. Wie wenn sie von der Gewaltenteilung zwischen Wissenschaft und Politik nie etwas gehört hätten: Wissenschaft berät, aber Politik wägt ab und entscheidet. Dass „die Wissenschaft“, so wie sie von Politik und Medien beschworen wurde, weder die Wissenschaft in ihrer Breite war, und dass die real existierende „wissenschaftliche Beratung“ in der Corona-Pandemie mangelhaft etabliert war und eine ganze Reihe von schwerwiegenden Irrtümern beging, bleibt ebenfalls ungesagt. In beiden Fällen, Corona und Klima, sei der Rückgriff auf die Eigenverantwortung ein Märchen, meinen die Autoren. Und in beiden Fällen sei es ein Märchen, dass Einschränkungen der Wirtschaft unwirtschaftlich seien, denn ohne Überleben gäbe es keine Wirtschaft mehr: Wie wenn es bei Corona oder dem Klimawandel um das nackte Überleben der Menschheit ginge! Doch eine solche radikale Prognose hat weder Christian Drosten für Corona noch der IPCC für das Klima behauptet. Die Autoren beklagen, dass in beiden Fällen diejenigen, die das „Richtige“ fordern, als Feinde der Freiheit verschrieen würden, obwohl sie doch nur das Beste für die Menschen wollten. Ausdrücklich gelobt wird deshalb die harte Corona-Politik von Jacinda Ahern in Neuseeland. Dass es durchaus fragwürdig war, wie in der Corona-Pandemie manche Grundfreiheiten mit einem Federstrich beseitigt wurden, bleibt ungesagt. Dass Jacinda Ahern am breiten Unmut der Bürger gescheitert und zurückgetreten ist, bleibt ungesagt.
Es ist enttäuschend. Wer wirklich glaubt, dass jetzt dringend CO2 reduziert werden muss, der würde doch wenigstens priorisieren. Der würde sagen: Wir müssen jetzt in manchen Politikfeldern in den sauren Apfel beißen, damit wir in diesem einen überlebenswichtigen Punkt zu Potte kommen. Das würde z.B. bedeuten, die Atomkraft wenigstens als Übergangslösung zu akzeptieren. Oder CO2-Abscheidung an Kohlekraftwerken einzuführen. Auch mit dem Ziel, dieses Verfahren in der ganzen Welt zu praktizieren, denn die Welt wird noch lange nicht auf Kohle verzichten. Es würde auch bedeuten, sich manche abschreckende gesellschaftspolitische Pirouette zu verkneifen, um möglichst viele Menschen mit an Bord zu holen. Aber nichts davon. Die Autoren dieses Buches träumen von einer utopischen Zukunft, in der nicht nur das Klimaproblem gelöst ist, sondern alle möglichen anderen woken „Gerechtigkeitsfragen“ gleich mit, denn alles hängt hier angeblich mit allem zusammen: Das Patriarchat, der Kapitalismus, die Monogamie, die Klimakatastrophe, der Rassismus, Corona, usw.
Wer wirklich an die drohende Klimakatastrophe glaubt, der muss an diesem Buch verzweifeln, denn solche utopistischen „Klimakrieger“ wie die Autoren dieses Buches werden in jedem Fall scheitern. Das einzige, was ihnen gelingen könnte, ist die Zerstörung von Demokratie und Wohlstand.
Öko-Totalitarismus
Die Autoren sind Träumer. Träumer mit totalitären Öko-Vorstellungen. Wir sahen bereits, dass sie die totalitären Züge mancher Corona-Maßnahmen kritiklos bejubelten. Aber mehr noch: Sie beschwören doch tatsächlich das Bild einer statischen, unveränderlichen Natur, die nur durch den Menschen in Ungleichgewicht geraten würde. Über die Natur wird Unglaubliches gesagt, nämlich folgendes: „Als System ist diese ja (ohne unser Eingreifen) ein stabiles [sc. System] … In einem intakten Ökosystem stehen die dort vorkommenden Arten untereinander und die Individuen in einer Art Miteinander in Beziehung und regulieren sich gegenseitig … Je komplexer das Ökosystem … desto stabiler ist das ökologische Gleichgewicht.“ (S. 472)
Das ist natürlich völlig falsch und himmelschreiend unwissenschaftlich. Die Natur wälzt sich ständig um. Stabilität stellt sich immer nur vorübergehend ein, oder nur in komplexen Zyklen. Arten entstehen und vergehen. Auch das Klima unterliegt einem natürlichen Wandel (was nicht heißen soll, dass nicht auch der Mensch seinen Anteil daran hat). All das hätten die Autoren z.B. im Anhang des Romans „Welt in Angst“ von Michael Crichton lernen können! Doch sie zogen es vor, Michael Crichtons Roman als „berüchtigt“ zu bezeichnen und vor dessen nonfiktionalen Anhängen zu warnen (S. 381 f.). Wer so direkt gegen offensichtliche Wahrheiten spricht, wie glaubwürdig ist der eigentlich?
Aber mehr noch: Diese statische Vorstellung von Natur entspricht natürlich ganz jenem rechtsradikalen Ungeist von Unberührtheit und Reinheit, der im Nationalsozialismus ganz hervorragend mit der Naturschutzbewegung zusammenging. Ja, im Nationalsozialismus erfuhr die deutsche Naturschutzbewegung ihre erste Blütezeit. Doch davon schweigen die Autoren.
Die Idee, dass der Mensch sich die Natur nach seinen Bedürfnissen einrichtet, wird praktisch verworfen. Die Natur wird überhöht, der Mensch negiert. Explizit negiert im Sinne der Postmoderne (siehe oben), denn es heißt, die Natur kenne keine Narrative, so schreiben die Autoren, und könne sich also nicht anpassen, und deshalb müsse der Mensch seine Rolle in einer als unberührt gedachten Natur finden (S. 472). Diese Idee ist nicht nur völlig überzogen und nicht praktikabel. Sie ist auch rechtsradikal. Ja, tatsächlich: Die Postmoderne hatte ihren Ideen u.a. auch von Martin Heidegger, der für den Nationalsozialismus Partei ergriff. Bei Heidegger geriet der Mensch ebenfalls ins Abseits und der Humanismus wurde verworfen. Diese ganze philosophische Strömung ist auf einer sehr tiefen und elementaren Ebene falsch und irrig und bietet ideologisch das Potential zu den schlimmsten Entgleisungen. Was es bedeutet, vom Humanismus abzuweichen, haben wir im zwanzigsten Jahrhundert zur Genüge erfahren.
Ebenfalls totalitär ist der Umstand, dass Andersdenkende in diesem Buch immer nur als Verführte oder als Verführer wahrgenommen werden. Alternative Meinungen zur Klimakatastrophe werden üblen „Zweifelhändlern“ zugeschrieben (S. 235 ff.). Die Gegner sind laut diesem Buch „raffgierige Konzerne, verantwortungslose Politiker[…], gekaufte Wissenschaftler“, namentlich auch Ölkonzerne (S. 393, 399), die angeblich in den 1970ern und 1980ern die wissenschaftliche Erkenntnis unterdrückt hätten, dass der CO2-Ausstoß zu einer Klimakatastrophe führt. Das ist natürlich ebenfalls falsch. Denn damals existierte dieses Thema noch als Forschungsfrage, aber noch nicht als Forschungsergebnis. Die Konsolidierung zu einem Forschungsergebnis und die öffentliche Aufmerksamkeit begannen Ende der 1980er Jahre, als eine Reihe von Politikern das Thema zu puschen begannen, um damit Werbung für die CO2-freie Atomkraft zu machen. Darunter Margaret Thatcher, Franz-Josef Strauß und Olof Palme. Und die bösen Energiekonzerne sind heute ganz vorne mit dabei beim Bau von Windrädern und Solaranlagen, und ihr Führungspersonal hat heute nicht selten ein grünes Parteibuch. – Wer Andersdenkende nur noch als Dummköpfe oder Bösewichter, nicht jedoch als legitime Andersdenkende im Rahmen eines demokratischen Diskurses wahrnimmt, sollte sich fragen, wie demokratisch er noch ist. Insbesondere sollte, wer von „Zweifelhändlern“ spricht, sich die Frage stellen, ob es nicht ebenso „Gewissheitshändler“ gibt, die Propaganda für das Gegenteil machen, und zwar ebenfalls aus politischen und ökonomischen Interessen.
Öko-Propaganda
Mit „Gewissheitshändlern“ haben die Autoren dieses Buches offenbar kein Problem. Denn sie fordern Journalisten dazu auf, durch Geschichten und Bilder vor der Klimakatastrophe zu warnen (S. 384, 398), wörtlich ist von „affektgeladener Berichterstattung“ und „Einsatz von Bildern“ die Rede, also ausdrücklich nicht von sachlicher Information. Weiter heißt es: „Visuelle Eindrücke wie die vom brennenden Amazonas-Regenwald, von Bränden in Australien, Griechenland, Kalifornien und Kanada, von versehrten Tieren, Menschen und Architekturen“. Dass diese Beispiele aber keinesfalls so einfach in einen direkten Zusammenhang mit dem Klimawandel gebracht werden dürfen, bleibt ungesagt. Eine Studie wird zitiert, dass die Wahrnehmung des Wetters sich verändert, je nachdem, ob man an die Klimakatastrophe glaubt oder nicht (S. 388). Das Manipulationspotential wird also klar erkannt und benannt.
Dass man mit dieser Art von „Public Relations“ den Rubikon zu Manipulation und Propaganda überschritten hat, dass die Autoren dieses Buches damit nicht anders handeln als der von ihnen selbst scharf kritisierte Erfinder der „Public Relations“ Bernays, wird nicht reflektiert. Die Autoren beklagen auch den Betrug des Spiegel-Reporters Claas Relotius, und analysieren richtig, dass sein Betrug funktionierte, weil Relotius genau die Stories lieferte, nach denen das Publikum gierte (S. 229). Dass es sich dabei aber u.a. um genau solche Öko-Stories handelte, die es mit der Sachlichkeit nicht mehr so genau nahmen, bleibt ungesagt.
Die Autoren werden aber noch deutlicher: „Lange Zeit (und stellenweise noch heute) kam in der Berichterstattung über die menschengemachte Klimakrise auf jede Aussage eines Klimaforschers ein Vertreter der Öllobby oder ein reaktionärer Politiker zu Wort.“ (S. 390) Dieser Satz lässt den Leser fassungslos zurück. In welcher Welt leben diese Autoren? Denn es ist einfach nicht wahr, dass in den vorherrschenden Medien diese Parität vorhanden gewesen wäre. Das Gegenteil ist der Fall. Fast immer sprechen die Medien völlig einseitig zugunsten der Klima-Alarmisten. Vermutlich gilt diesen Autoren bereits ein CDU-Politiker, der dasselbe wie die Grünen will, nur langsamer, bereits als „Reaktionär“. Und dass die Ölkonzerne von einst dieselben Konzerne sind, die heute Windräder und Solaranlagen in großem Stil bauen, ist den Autoren offenbar völlig entgangen. In den großen Energiekonzernen sitzen längst Funktionäre mit grünem Parteibuch. Es ist zwar in der Theorie richtig, vor einer „false balance“ (S. 390) zu warnen, aber in der Praxis ist das genaue Gegenteil zu beobachten, nämlich eine „false balance“ zuungunsten von Kritikern: Kritiker und Zweifler sind nicht etwa gleichrepräsentiert, sondern überhaupt nicht repräsentiert. Sie werden als Schwurbler aus dem Diskurs gedrängt. Und das schon lange. Es wäre ein echter Fortschritt, wenn Kritiker überhaupt wieder einmal zu Wort kommen dürften.
Es ist deshalb eine böse Drohung, wenn die Autoren fordern, man müsse den „Vernunft“-Begriff zurückerobern (S. 393). Damit meinen sie nicht die Vernunft im demokratischen und humanistischen Sinne, sondern den Ausschluss all derer, die nicht mit den Ergebnissen ihrer „Vernunft“ übereinstimmen, also die Aufkündigung der angeblich vorherrschenden Parität, der angeblich existierenden „false balance“. Konkret würde das wohl bedeuten, dass in Zukunft dann auch kein CDU-Laschi mehr in der Talkshow sitzen darf, sondern nur noch ideologisch gefestigte Klimagläubige, für die es stets 5 vor 12 ist. Dass die Demokratie erfordert, dass auch Meinungen zu Wort kommen dürfen, die von keinem Wissenschaftler vertreten werden, und zwar in dem Proporz, den diese Meinungen im Staatsvolk haben, ist ein Gedanke, der den Autoren dieses Buches offenbar fremd ist. Sie glauben an die Heiligkeit des angeblichen „wissenschaftlichen Konsenses“ wie man im Mittelalter an die Unfehlbarkeit der kirchlichen Lehre glaubte: Wer abweicht, muss mit dem Satan im Bunde sein und als Ketzer auf den Scheiterhaufen gebracht werden.
Öko-Autoritäten
Auf welche Autoritäten berufen sich die Autoren eigentlich? Nur zwei Namen fallen auf: Maja Göpel (S. 402) und Greta Thunberg (S. 404 f.).
Maja Göpel ist eine „Klimaexpertin“ vom Schlage einer Claudia Kemfert, bei der Propaganda alles und Substanz nichts ist. Sie hat weder Klima noch Technik noch Volkswirtschaft studiert, sondern Medienwirtschaft. Eine echte Professorin ist sie auch nicht, sondern nur eine Honorarprofessorin, und zwar an der Leuphana Universität Lüneburg. Diese Universität entstand aus der Fusion einer kleinen Universität mit der lokalen Fachhochschule und gilt als Modell für die Umsetzung des Bologna-Prozesses. Was nichts Gutes heißt. Zuletzt wurde bekannt, dass Maja Göpel ihre Bücher gar nicht selbst geschrieben hat, sondern einen Klima-Journalisten als Ghostwriter engagiert hatte. Wahrlich eine wissenschaftliche Autorität, der man gerne Vertrauen schenkt. Auf dem Schutzumschlag dieses Buches befindet sich ganz groß ein Zitat von Maja Göpel, wie sie dieses Buch lobt. Eine Hand wäscht die andere, offenbar auch unter Ökos.
Greta Thunberg wird in diesem Buch romantisch verklärt. Der Leser bekommt die kitschige Erzählung serviert, dass ein einsames, kleines Mädchen eines Tages beschloss, für das Klima die Schule zu bestreiken, und damit unverhofft eine weltweite, spontane Umweltbewegung junger Menschen inspirierte. Der Leser erfährt nichts von der Agentur, die Greta Thunberg gemanagt hat, und nichts davon, dass die Fridays-for-Future-Bewegung teilweise ein exemplarischer Fall des Astroturfing ist, teilweise aber auch von Linksradikalen unterwandert wurde. Astroturfing bedeutet, dass der Anschein einer Graswurzelbewegung erweckt wird, in Wahrheit aber gewisse Kräfte zentral die Strippen ziehen.
Kennzeichen totalitärer Bewegungen ist die Beschwörung von Mythen und einsamen Helden. Allerdings nicht von irgendwelchen Mythen, sondern insbesondere von falschen Mythen. Und nicht irgendwelche Helden, sondern von Helden, die kompromisslos sagen, wo es langgeht. Lässt sich ein besseres Bild für das totalitäre Denken finden, als die Simplizität, mit der ein Kind die Welt betrachtet? Nur, dass Kinder natürlich keine Antidemokraten sind, sondern einfach nur Kinder. Aber Erwachsene, die sich auf ein kindisches Niveau begeben, die kommen dem totalitären Denken schon recht nahe.
Verantwortliche Medien hätten niemals zugelassen, dass gewisse Erwachsene einen Hype um Greta Thunberg herum aufbauen, um damit ihr Süppchen zu kochen. Greta Thunberg war fachlich zu inkompetent und als Kind menschlich zu unerfahren, um die Komplexität der Problematik auch nur ansatzweise überblicken zu können. Da sie noch nicht erwachsen war, hätte man sie vor sich selbst (und vor allem vor ihren Managern) schützen müssen.
Gegen die Marktwirtschaft
Die Autoren bringen gleich an mehreren Stellen ihres Buch zum Ausdruck, dass sie die Wahrnehmung, dass in der westlichen Welt jeder seines Glückes Schmied ist, und dass, wer sich anstrengt, auch belohnt wird, für einen großen Irrtum halten. Sie gebrauchen dafür sehr harte Worte, z.B. „Märchen“ und „Lüge“, und sehen darin nur die vorgeschobene Legitimation für ein System der Ausbeutung (S. 235 ff., 252 ff., 234 ff., 429).
Sie begreifen nicht, dass die westlichen Systeme tatsächlich viele Chancen zum Aufstieg bieten, durch Bildung und die freie Marktwirtschaft. Und dass Anstrengung sich in der Regel auch tatsächlich auszahlt. Natürlich ist das System nicht perfekt und nicht völlig gerecht. Aber es ist besser als alles andere. Und genau das haben die Autoren nicht verstanden. Deshalb ist auch das Gedankenmodell des „homo oeconomicus“ nicht falsch, wie sie meinen (S. 235 ff.), sondern ein nützliches Modell. Das seine Grenzen hat, wie jedes Modell. Es ist aber keine Lüge. Und natürlich wird auch nicht jeder Tellerwäscher zum Millionär. Das hat aber auch niemand behauptet. Sondern die bloße Möglichkeit, dass auch ein Tellerwäscher theoretisch zum Millionär aufsteigen kann, ist bereits das Wunder. Aufstiege sind möglich und sie finden auch statt. Oder eine Nummer kleiner gedacht: Dass Anstrengung in der Schule in der Regel dazu führt, dass später auch das Gehalt besser ist, ist kein Märchen, sondern eine statistisch belegte Realität. Aber die Autoren vergleichen den Glauben daran, dass man sein Los durch Anstrengung verbessern kann, mit dem Glauben an Astrologie (S. 429).
Auch andere Grundtatbestände der Marktwirtschaft werden als „Märchen“ bezeichnet, so z.B. das Prinzip der „unsichtbaren Hand“ (S. 239 f.). Es besagt, dass in einer freien Marktwirtschaft durch den Wettbewerb die Ressourcen wie durch Zauberhand halbwegs optimal allokiert werden, ohne dass es eine zentrale Planungsbehörde gibt. Vermutlich denken die Autoren dieses Buches an Fälle, wo es gar keinen Wettbewerb gibt. Aber das ist dann keine Marktwirtschaft mehr. So unterstellen die Autoren z.B. den großen Sozialen Netzwerken eine „Marktlogik“ (S. 195). Aber das ist ein Irrtum. Denn die großen Sozialen Netzwerke sind bekanntlich Monopolisten.
Auch die Finanzkrise (S. 240) und natürlich die Öko-Katastrophe werden der Marktwirtschaft zugeschrieben. Aber wurden die Grundlagen für die Finanzkrise nicht durch Politiker gelegt, deren Politik gegen die Gesetze der Marktwirtschaft verstießen? O doch! Und dass die Menschen gerade heute bemerken, dass sie am Wirtschaftswachstum nicht mehr teilhaben (S. 422), liegt das nicht vor allem an einer falschen, linken Politik? Und waren es nicht die westlichen Systeme, die ökologisch am saubersten waren, während der real existierende Sozialismus ökologische Katastrophen unvorstellbaren Ausmaßes mit sich brachte, u.a. die Austrocknung des Aralsees, den Super-GAU von Tschernobyl oder die Verschmutzung der Flüsse in der ehemaligen DDR?
Zahlreiche ökonomische Irrtümer werden begangen. So heißt es z.B., dass die Fortschrittserzählung der westlichen Welt eine Lüge sei (S. 418). Aber der Fortschritt in Technik und Wohlstand, von Demokratie und Umweltschutz, den die Marktwirtschaft seit dem 19. Jahrhundert ermöglicht hat, kann nicht geleugnet werden. Man könnte höchstens darüber philosophieren, ob der viele Wohlstand nicht zu Dekadenz-Phänomenen führt, aber das ist ein anderes Thema. Überhaupt sei auch die Idee des „Wirtschaftswachstums“ eine Lüge (S. 418). Am Ende würde das „Wachstum“ den Planeten verbrauchen (S. 420). Es ist zwar richtig, dass man „Wachstum“ auch sehr plump auffassen kann, aber dass ein nachhaltiges und qualitatives Wachstum der Wirtschaft möglich und nötig ist, ist nicht zu bestreiten. An zwei Stellen wird der Trickle-Down-Effekt als Lüge bezeichnet, die „nachgeplappert“ wird (S. 418, 460 Fußnote). Aber es ist unbestreitbar, dass es diesen Effekt gibt. Natürlich sind manche reicher als andere und es kommt nicht alles Geld „unten“ an. Aber es hat auch niemand behauptet, dass alles Geld „unten“ ankäme. Denn es kommt genug „unten“ an, damit es allen insgesamt besser geht, und darum geht es. Wieder haben die Autoren nicht verstanden, dass es nicht darum geht, eine perfekte Welt zu schaffen, sondern einfach nur die praktisch bestmögliche Welt.
Schließlich träumen die Autoren von einem Bruttonationalglück-Index und meinen, dass Wohlstand nicht alles sei, denn auch Gesundheit gehöre dazu (S. 420, 403). Aber wie misst man Glück? Ein Bruttonationalglück-Index öffnet der politischen Manipulation Tür und Tor. Wohlstand hingegen kann man in Währungseinheiten messen. Auch das ist nicht optimal, aber auch hier gilt: Es ist das beste, was wir haben. Und vor allem: Das persönliche Glück hängt zu einem guten Teil eng mit dem Wohlstand zusammen. Die Gesundheit, von der die Rede war, kann in einer Welt mit einem gut finanzierten Bildungs- und Gesundheitssystem viel besser erhalten werden, als in Armut. Und am Ende ist letztlich jeder Herr seiner eigenen Definition von Glück. Es ist richtig, darauf zu achten, dass jeder zu seinem verdienten Geld kommt. Wie aber der Einzelne sein Geld einsetzt, um sein Glück zu machen, das sollte doch besser jedem selbst überlassen bleiben. Aber auch das haben die Autoren nicht verstanden, denn sie beklagen den Konsum von Luxusgütern, die man nicht bräuchte (S. 422). Aber was sind Luxusgüter? Gehören warme Winterstrümpfe, die nicht kratzen, auch schon dazu, oder sind die „erlaubt“? Und wenn jemand ein schnelles Auto zu seinem Seelenheil benötigt, darf der das dann? Die Autoren haben ganz grundsätzliche Verständnisprobleme, was Freiheit, Markt, und persönliches Glück anbelangt.
Kryptowährungen werden als anarchischer Widerstand der „digital natives“ gefeiert (S. 460). Seltsam. Denn Kryptowährungen sind harte, kalte Marktwirtschaft ohne jede soziale Abfederung. Und der Widerstand der Krypto-Fans ist doch wohl Widerstand gegen einen Staat, der aus sozialen und ökologischen Gründen vieles falsch macht mit dem Geld seiner Bürger, bis hin zur Staatsfinanzierung durch die Druckerpresse. Der Widerstand, den die Autoren dieses Buches da feiern, ist ein Widerstand gegen sie selbst! Auch das haben sie also nicht verstanden. Zudem: Auch die Mafia mag Kryptowährungen sehr. Und woher kommt eigentlich der viele Strom, der zur Generierung von Kryptowährungen benötigt wird? Auch davon schweigen die Autoren eisern.
Über einen Gedanken lässt sich reden: Menschen neigen dazu, sich die Verhältnisse schön zu reden. Weder sehen sich Ausbeuter als Ausbeuter, noch Ausgebeutete als Ausgebeutete (S. 419). Wenn man diesen Gedanken von der Radikalität der Systemkritik befreit, macht er Sinn. Im Rahmen des Systems der Marktwirtschaft gibt es natürlich viele kleine Ungerechtigkeiten, an deren Verbesserung ständig gearbeitet werden muss. So könnte man z.B. die Bezahlung von Pflegekräften und den Personalschlüssel in der Pflege erhöhen. Aber das ist keine Systemkritik. Und kommt deshalb in diesem Buch nicht vor. Unterhalb von Systemkritik machen es die Autoren nicht. Weil sie glauben, dass mit dem Umsturz des Systems alles besser würde. Wie naiv.
Für Marxismus
Eine linke Grundausrichtung des Buches wird allein schon anhand der Sprache erkennbar. Die Autoren reden nie von „Marktwirtschaft“, sondern immer nur von „Kapitalismus“. Dass die Marktwirtschaft in der westlichen Welt zudem in einen demokratischen und sozialen Staat eingebettet ist, erwähnen sie ebenfalls nicht. Und sie reden ständig vom „Faschismus“. Wer immer nur gegen den „Faschismus“ wettert, ist als Demokrat definitiv zu einseitig unterwegs. Der Demokrat wendet sich gegen jede totalitäre Ideologie, ob von rechts oder von links. Der Demokrat bekennt sich zum „antitotalitären Grundkonsens aller Demokraten“. Doch nicht die Autoren dieses Buches. Außerdem ist die pauschale Bezeichnung „Faschismus“ für die verschiedenen Formen von Rechtsradikalismus etwas fragwürdig, denn es war die kommunistische Propaganda des Kalten Krieges, die den westlichen „Kapitalismus“ gerne als „faschistisch“ bezeichnete und mit dem Nationalsozialismus in einen Topf warf. Doch das nur am Rande.
Im Zusammenhang mit ihrer Kritik an der Vorstellung, dass man sein Los durch eigene Anstrengung verbessern könnte, sprechen die Autoren explizit aus, was ihrer Kritik zugrunde liegt: „Karl Marx“ (S. 429). So knapp, so deutlich. Und auch dieses sagen sie: „die schönste und wichtigste Erzählung der Menschheit besagt: Alle Menschen sind gleich“ (S. 438). Hier wird also die Gleichheit gefeiert, ohne die Freiheit auch nur zu erwähnen. An anderer Stelle schreiben die Autoren, dass eine ungleiche Verteilung des Vermögens ungerecht sei, und deshalb durch Lügen legitimiert werden müsse, z.B. durch Religion und Monarchie (S. 247).
Ganz offensichtlich haben die Autoren grundsätzlich nicht verstanden, dass Gleichheit und Freiheit zwei Prinzipien sind, die zueinander in einem Spannungsverhältnis stehen. Man kann nicht beides zugleich in vollem Umfang haben. Radikale Gleichheit zerstört Freiheit. Radikale Freiheit zerstört Gleichheit. Die westliche Welt beruht auf einer Balance von beidem. Aber die Autoren reden, wie wenn sie von diesen Überlegungen nie gehört hätten, und setzen radikal und einseitig auf die Gleichheit. Das ist sehr bedenklich, und insofern die Autoren die Leser nicht auf die dahinter liegende Problematik aufmerksam machen, ist es auch manipulativ.
Im Zusammenhang mit ihrer Kritik an der Marktwirtschaft (s.o.) sprechen die Autoren von einer Reihe von großen Lügen, die sie auch „Märchen für Erwachsene“ nennen (S. 234 ff.). Doch einige der größten Lügen fehlen auf dieser Liste: Sozialismus, Kommunismus, Marxismus, Postmoderne, Identitätspolitik. All das sind für die Autoren also keine Lügen. Demgegenüber könnte man eine Liste von großen Wahrheiten aufmachen: Demokratie, Menschenrechte, Marktwirtschaft, Sozialstaat, Humanismus, Aufklärung. Aber diese Dinge kommen in diesem Buch nicht vor oder werden abgelehnt: Marktwirtschaft? Lüge und Ausbeutung. Humanismus? Der Mensch muss überwunden werden. Aufklärung? Nicht Vernunft, sondern Narrative kennzeichnen den Menschen. So sehen es die Autoren dieses Buches.
Teilweise wird ein sozialistischer Hintergrund der vorgestellten Ideen verschwiegen. Bei der Vorstellung des Gründungsdokumentes der Identitätspolitik, dem Manifest des sogenannten Combahee River Collective von 1977 (S. 442), wird unterschlagen, dass es sich um eine erklärtermaßen sozialistische Organisation handelte, die sowohl Patriarchat als auch Kapitalismus überwinden wollte.
Mit Bezug zum Kalten Krieg sprechen die Autoren von „vermeintlichen Einflussnahmen“ der Sowjetunion überall auf dem Planeten (S. 219). Wieso „vermeintlich“? Dass der Westen und der Kommunismus in einem Systemwettbewerb standen und beide Seiten versuchten, ihren Einfluss überall auf der Welt geltend zu machen, ist doch wohl bestens bekannt. Was gibt es hier zu zweifeln?! Wollen die Autoren den Kalten Krieg etwa ein zweites Mal durchfechten? Finden sie es etwa schade, dass der Westen gewonnen hat?
Im Zusammenhang mit der Geschichte von Edward Bernays, dem zynischen Erfinder der „Public Relations“, wird auch die Geschichte des „Bananenstaates“ Guatemala erzählt. Angeblich hätte Bernays den Präsidenten von Guatemala, Jacobo Árbenz Guzmán, fälschlicherweise als Kommunisten dargestellt, um einen von der CIA 1954 orchestrierten Putsch zu rechtfertigen (S. 218 f.). Dabei werden aber eine Reihe von Informationen unterschlagen, die man höchst einfach bei Wikipedia finden kann: Biographisch ist bekannt, dass die Ehefrau von Árbenz Guzmán einen großen Einfluss auf ihn hatte. Sie gab ihm das Kommunistische Manifest zu lesen, und Árbenz Guzmán sei davon „bewegt“ gewesen. Beide glaubten, dass es viele Dinge erklären würde. Daraufhin begann Árbenz Guzmán, Werke von Marx, Lenin und Stalin zu lesen. In den späten 1940ern tauschte er sich regelmäßig mit einer Gruppe Guatemaltekischer Kommunisten aus. 1952 legalisierte er die kommunistische Guatemaltekische Arbeiterpartei, wodurch die Kommunisten Einfluss auf Bauernverbände, Gewerkschaften und die regierende Partei bekamen. Árbenz Guzmán versuchte, die amerikanische United Fruit Company zu enteignen. Die dem Konzern zustehende Entschädigung für die Enteignung wurde aber viel zu niedrig angesetzt. Dass der Konzern den Wert des Landes selbst zu niedrig ansetzte, entschuldigt das nicht. Einige Berater dieser Agrarreform waren Kommunisten. Doch von all dem hört man nichts in diesem Buch.
Statt dessen setzen die Autoren noch eins drauf und berichten von dem späteren Bürgerkrieg in Guatemala, der 200.000 Tote forderte (S. 221). Auch hier unterschlagen sie wesentliche Dinge. So z.B., dass der „Widerstand“ der Guerilla gegen die Regierung u.a. von Kuba unterstützt wurde. Die Kommunisten waren sehr wohl präsent und können keinesfalls als demokratischer Widerstand bezeichnet werden, aber der Leser dieses Buches erfährt nichts davon.
Generell sind die Autoren der Auffassung, dass die USA durch „brutale Kriege, Sanktionen und Geheimdienstoperationen gegen fremde souveräne Staaten“ Schuld auf sich geladen hätten (S. 220). Neben Guatemala wird auch Vietnam als Paradebeispiel genannt. Es geht also immer um den Kampf gegen die Ausbreitung des Kommunismus. Das ist es offenbar, was die Autoren stört. Über Kriege und Geheimdienstoperationen der Sowjetunion zur Zerstörung demokratischer Staaten beklagen sich die Autoren hingegen nicht. Hannah Arendt wird als Gewährsfrau angeführt, die angeblich der Meinung war, dass die „Domino-Theorie“, derzufolge ein Land nach dem anderen dem Kommunismus anheim fallen wird, wenn man nicht Einhalt gebietet, falsch war (S. 220). Wir haben nicht überprüft, ob Hannah Arendt dies wirklich gesagt hat. Fast immer wird Hannah Arendt von interessierter Seite falsch zitiert. Aber selbst wenn: Auch eine Hannah Arendt ist nicht unfehlbar. Schließlich aber nennen die Autoren die Domino-Theorie eine „Halb-, vielleicht auch eher Viertelwahrheit“ (S. 220). Der Leser fragt sich überrascht: Was denn nun? Eben noch völlig falsch und jetzt doch ein wenig wahr?!
Es wird auch das ewig falsche Märchen verbreitet, dass der Vietnamkrieg ein verlorener Krieg war (S. 220 f.) bzw. dass er nicht zu gewinnen war (S. 231). In Wahrheit war der Vietnamkrieg mit der TET-Offensive militärisch gewonnen. Es war die Heimatfront, die genau in diesem Moment wegbrach. Die Manipulation der öffentlichen Meinung in den USA zur Beendigung eines im Grunde gewonnenen Krieges, als ob der Krieg verloren wäre, und die Überlassung des Landes Vietnam an den Kommunismus war einer der größten Propagandasiege des Kommunismus. Die Linken zehren bis heute davon. Auch dieses Buch reproduziert diesen Propagandasieg.
Zuguterletzt wird der Marxismus noch einmal deutlich als Ziel ausgegeben, aber für ungenügend erklärt: „Für Karl Marx etwa war die Utopie gleich ‚Uchronos‘, die Zeit nach dem Kapitalismus, in der man seine Stunden und Tage nicht mehr verkaufen muss, wie das im Kapitalismus der Fall ist. … Die Voraussetzungen dafür seien im Schoße der Gesellschaft vorhanden und müssten nur vom Schleier der kapitalistischen Herrschaft befreit werden“ (S. 469). Die Autoren fahren fort: „Die ökologische Krise hat den Marxismus wenn nicht widerlegt, so doch zumindest vor neue Aufgaben gestellt: Nur die Produktionsmittel zu vergesellschaften kann nicht die Lösung sein“. – Das ausgegebene Ziel ist also noch radikaler als der klassische Marxismus. Na denn, Prost Mahlzeit!
Anti-Konservativismus
Wir sahen bereits oben, wie die Autoren dieses Buches die klassische Bildung in Form der Ilias des Homer ablehnten, in dem sie darin eine einzige Orgie der Gewalt sahen. Was falsch ist. Noch deutlicher wird es, wenn sie von der „sogenannten klassischen Bildung“ reden (S. 43). Die Autoren haben nicht begriffen, dass die klassische Bildung wirklich klassisch, also zeitlos und tiefgründig, ist. Und damit natürlich auch konservativ im besten Sinne. Konsequenterweise schweigen die Autoren über die Odyssee als dem großen Urbild jeder Heldenreise, obwohl das ganze Buch voll ist mit Besprechungen und Anwendungen der Heldenreise. Aber Mentor erwähnen sie doch (S. 31), denn es ist nicht möglich, über die Heldenreise zu sprechen und sich völlig an der Odyssee vorbeizumogeln.
Griechenland wird als die Entdeckung des Individuums und der Selbstverwirklichung dargestellt, die griechische Demokratie als die maximale Freiheit, die zu diesem Zweck ersonnen wurde (S. 126 f.). Das ist natürlich eine Geschichtsklitterung, die die Autoren begehen, um den westlichen Menschen als egoistischen Zerstörer darstellen zu können. Was die Autoren bei Griechenland unerwähnt lassen, ist die Entwicklung der Philosophie, insbesondere der Rationalität, als der Methode zur Wahrheitsfindung. Aber mit der Auffindung der Wahrheit halten sich die Autoren bekanntlich nicht auf. Was fehlt ist auch die Kulmination des antiken politischen Denkens nicht etwa in der Demokratie Athens, sondern in der Staatsform der Republik, wie sie von Platon vorgedacht und in Ciceros Rom praktische Anwendung fand. Dass die Antike eine Balance zwischen Individuum und Kollektiv suchte, und nicht die radikale Selbstverwirklichung des Egos, bleibt ungesagt. Den Autoren fehlt es ganz offensichtlich an klassischer Bildung. Oder sie stellen es bewusst falsch dar.
Konsequenterweise machen die Autoren wenige Seiten später eine völlig falsche Alternative zwischen dem griechisch geprägten Westen und Konfuzius auf: Hier der angeblich aufdringliche, egoistische, prahlerische Westen, dort der achtsame, zurückhaltende Weise, der eine Balance zwischen Individuum und Kollektiv kennt (S. 130). Quatsch mit Soße.
Dort, wo das Wechselverhältnis von Mensch und Technik diskutiert wird (S. 212), hätte man erwarten können, dass Neil Postman zitiert wird. Aber über Neil Postman wird eisern geschwiegen. Der war ja auch konservativ.
Der Generation der „Boomer“ wird ein unterkomplexes, tendentiell konservatives Weltbild unterstellt (S. 434). Und zwar deshalb, weil sie aus einer Zeit kommen, in der geordnete Verhältnisse herrschten. Deshalb seien sie nicht flexibel genug zur Bewältigung der Herausforderungen unserer unübersichtlichen Welt. – Die Autoren sollten sich fragen, ob sie da nicht einem gewaltigen Denkfehler aufsitzen. Denn die „Boomer“ wissen um den Wert einer geordneten Welt, und sie wissen auch, wie man Ordnung herstellt. Dass die Welt heute so unübersichtlich geworden ist, verdankt sich nicht zuletzt dem rücksichtslosen Wirken vieler Linker, die überall in der Gesellschaft heilsame Gewissheiten über Bord geworfen haben: An den Grenzen wird nicht mehr richtig kontrolliert, in den Schulen nicht mehr richtig unterrichtet, in den Medien nicht mehr richtig informiert, in der Zentralbank nicht mehr richtig auf Geldwertstabilität geachtet, in der Bundeswehr nicht mehr richtig für den Ernstfall geplant, usw. usf.
Konservative solle man lieber „Destruktive“ nennen, meinen die Autoren (S. 468). Die Autoren schreiben „Konservative“ in Anführungszeichen, denn ihr Vorgehen sei eine einzige, große Lebenslüge (S. 469). Doch dass Menschen, die im 21. Jahrhundert immer noch an den Unsinn von Karl Marx aus dem 19. Jahrhundert festhalten, und die es nicht verwinden können, dass der Kommunismus im 20. Jahrhundert krachend gescheitert ist, vielleicht ebenfalls auf eine gewisse Weise „konservativ“ sein könnten und vielleicht ihrerseits nicht flexibel genug sein könnten, um eine Gesellschaft zu ordnen und Probleme zu lösen, auf diese Idee kommen die Autoren nicht.
Religionsfeindlichkeit
Es ist nichts dagegen einzuwenden, dass die Autoren nicht religiös sind. Es ist auch in Ordnung, wenn ein Buch wie dieses konsequent säkular bleibt. Politik und Wissenschaft sind in der westlichen Welt per se säkular, und das ist auch gut so. Aber dabei bleibt es nicht. Dieses Buch zeigt immer wieder seine Religionsfeindlichkeit.
Sehr deutlich zeigt sich die Religionsfeindlichkeit z.B. in der Bezeichnung des bekannten Songs „Imagine“ von John Lennon als „einem der wichtigsten Songs der Musikgeschichte“ (S. 357). Der Text sagt alles: „Imagine there’s no heaven / It’s easy if you try / No hell below us / Above us only sky / Imagine all the people living for today / Imagine there’s no countries / It isn’t hard to do / Nothing to kill or die for / And no religion too / Imagine no possessions / I wonder if you can / No need for greed or hunger / Our brotherhood of man / Imagine all the people sharing all the world“.
Nationen und Religionen und das Privateigentum werden in diesem Lied nur als störende Elemente wahrgenommen, ohne die sich ein paradiesischer Weltfrieden einstellen würde, in dem alle mit allen teilen. Das ist ungefähr dasselbe intellektuelle Niveau, das von jenen markiert wird, die sagen: Lasst uns das Geld abschaffen, dann ist niemand mehr arm!
Religionen, namentlich auch Götter, werden als mythische Vorstellungen unwissender Menschen gedeutet, die zudem die wichtige Aufgabe haben, die Herrschaftsverteilung unter den Menschen zu kontrollieren (S. 241-243). Die Hölle wird als eine bloße Erfindung bezeichnet, um damit den Menschen Angst zu machen und sie so zu beherrschen (S. 250 f.). – Religions- und Kirchenkritik in Ehren, aber das sind doch allzu weit reichende Aussagen. Für Religion gibt es durchaus auch andere Antriebe als nur die Bemäntelung von Machtverhältnissen. Und die Hölle als bloße Erfindung zur Herrschaftssicherung zu deuten, ist doch etwas einfältig. So primitiv kam die Religion nicht in die Welt. Es gibt einen Unterschied zwischen der Religion und ihrem Missbrauch. Die Autoren lassen bewusst offen, wie weit sie gehen wollen, aber man ahnt es. Ironischerweise halten die Autoren an dieser Stelle Vernunft und Aufklärung als Kräfte gegen religiösen Aberglauben hoch, während sie mit Vernunft und Aufklärung sonst nicht viel am Hut haben.
Wiederholt kommen die Autoren auf den bekannten Satz „Macht Euch die Erde untertan“ aus dem ersten Buch der Bibel zurück (z.B. S. 16, 400 f.). Darin sehen die Autoren eine (Selbst-)Beauftragung des biblisch geprägten Menschen, die Erde rücksichtslos auszubeuten und sich verfügbar zu machen. Doch diese Deutung ist falsch. Sie entspringt jener modernen Unbildung, die sich Königsherrschaft nur als Tyrannei und Religion nur als Machtsicherungsinstrument denken kann. Doch historisch gesehen hat ein König natürlich die Aufgabe, sein Land zu hegen und zu pflegen und das Wohl seiner Untertanen zu mehren. Die Bibel beauftragt den Menschen also keineswegs mit der rücksichtslosen Ausbeutung der Erde. Im Gegenteil. Nur dass unsere pseudogebildeten Autoren das nicht verstehen.
Der Leser fragt sich, ob sich die Autoren im klaren darüber sind, dass ihre tappsige Religionskritik nicht nur das Christentum trifft, sondern auch den Islam und am Ende natürlich auch das Judentum? Auch jegliche nicht-traditionell und philosophisch motivierte Theologie ist bei diesem Rabulismus außen vor. Der Leser fragt sich auch, ob die Autoren noch nie etwas von religiösen Reformen gehört haben? Dass Religionen im Laufe der Jahrhunderte und durch den Einfluss von Macht deformieren, und von Zeit zu Zeit neu justiert, d.h. reformiert, werden müssen? Und wie realistisch ist es eigentlich, die Rettung des Planeten organisieren zu wollen, wenn man gleichzeitig derart plumpe und radikale Religionskritik übt? Denn immerhin ist die übergroße Mehrzahl der Menschen auf dem Planeten religiös.
Es werden auch viele weitere Fehler im Umgang mit Religion begangen. Die Autoren machen einen Gegensatz auf zwischen einer „hedonistischen, freien, griechischen Narrativik“ und einem mittelalterlichen, sündenbeschwerten Christentum (S. 127). Aber weder kann die griechische Antike auf Hedonismus reduziert werden, noch war das frühe Christentum mittelalterlich. – Von Petrus heißt es, er hätte den Christen befohlen, den römischen Kaiser zu ehren (S. 248). Kein Wort davon ist wahr. Man kann nur raten, welchem Irrtum die Autoren aufgesessen sind. Meinten sie etwa das Jesuswort „Gebt dem Kaiser …“? Es ist die Religionsfeindlichkeit, die die Autoren blind dafür gemacht hat, ihren Irrtum zu erkennen. – Die Autoren glauben auch, die katholische Kirche hätte die Monarchie erfunden (S. 248), schreiben dann aber selbst nur eine Seite später, dass Monarchie eine Konstante in der Menschheitsgeschichte ist. Gesellschaften hätten erst vor 200 Jahren damit begonnen, die Monarchie infrage zu stellen (S. 249). Auch das ist Unsinn, denn hier wird die Antike ausgeblendet. Und die Monarchie wurde in England schon vor 350 Jahren infrage gestellt und sogar vorübergehend abgeschafft.
Ersatzreligion
Die Autoren bemerken gar nicht, wie sie selbst mit ihrem Buch eine wahre Ersatzreligion zu etablieren begonnen haben. Sie schreiben, dass heute jede Meta-Erzählung entzaubert und gescheitert sei (S. 418), aber in Wahrheit entwerfen sie mit diesem Buch natürlich selbst eine einzige, große Meta-Erzählung. Am Ende des Buches wird jeder Leser durch die symbolische Entgegennahme der roten Pille aufgefordert (S. 477), diese Meta-Erzählung als seine Wahrheit anzunehmen, was selbst fast schon wie ein religiöser Akt wirkt.
Die Autoren beklagen auch, dass die Religion früher manche Ungerechtigkeit aufgefangen hätte, während man heute Sündenböcke sucht (S. 431 f.). Aber das ist doch genau das, was die Autoren selbst tun: Sündenböcke suchen! Der Kapitalismus, das Patriarchat, die Religion, die raffgierigen Konzerne usw. usf.: Sie alle seien schuld, so schreit es einem aus diesem Buch entgegen, und dass man all das beseitigen und durch ein öko-marxistisches Wokeness-Paradies ersetzen müsse, weil sonst die Klimahölle droht. Wenn das keine Sündenbocksuche mitsamt Hölle und Paradies ist …
Das Flow-Erlebnis wird von den Autoren zu „unserem sichersten Glücksspender“ hochstilisiert (S. 413). Dass das Glück aber vor allem auf einem geordneten Weltbild beruht, in dessen Rahmen man sich dann produktiv entfalten kann, bleibt unerwähnt. Vermutlich deshalb, weil für die Autoren völlig klar ist, wie ihr Weltbild aussieht. So klar, dass sie gar nicht in der Lage sind, das zu reflektieren.
Der Höhepunkt des religionsfeindlichen Denkens ist jedoch die Feststellung, dass der Mensch eine Maschine sei, und dass diese Maschine ihre Lebenswelt kollektiv erfindet (S. 471). Auch diese Aussage wird, wie fast alles in diesem Buch, nach irgendeinem Autor zitiert. Unwidersprochen, und damit zustimmend, natürlich. Der Mensch sei also nur eine seelenlose Maschine: das war die Idee des Buches „L’homme machine“ von Julien Offray de La Mettrie im Jahre 1748. Dafür wurde er von den meisten Aufklärern, u.a. auch von Voltaire, scharf kritisiert. Die Idee, dass die Aufklärung gottlos ist, ist völlig falsch.
Wir haben es also mit Autoren zu tun, die kein Problem mit dem Gedanken haben, dass der Mensch nur eine Maschine ist, und die ganz offen sagen, dass der Mensch überwunden werden muss: Warum also nicht der „Maschine Mensch“ den Stecker ziehen? Wir hatten bereits das zweifelhafte Vergnügen mit solchen Ideen im 20. Jahrhundert. Die marxistischen Schreckensherrschaften lassen grüßen. Die Autoren fragen (in Bezug auf den Nationalsozialismus), wie es möglich war, dass „die Menschlichkeit“ vergessen wurde? (S. 312) Die Antwort ist einfach: Natürlich durch eine Ideologie, die die Menschlichkeit vergessen machte! Die Autoren müssten einfach mal in den Spiegel schauen.
Aber auch der postmoderne Gedanke, dass der Mensch seine Lebenswelt kollektiv „erfindet“, ist gefährlich. Der Mensch gestaltet seine Umwelt, das ist wahr, und manchmal befindet er sich auch in Illusionen über seine Umwelt, aber dass der Mensch seine Umwelt „erfinden“ (!) könnte, ist ein postmoderner Gedanke, der für Mensch und Umwelt nur ins Verderben führen kann. Die christliche Religion mit ihrem „Macht Euch die Erde untertan“ war hier eindeutig realistischer und maßvoller.
Deutsche Schuld
Die Autoren behaupten immer wieder, „die Deutschen“ hätten bei den nationalsozialistischen Verbrechen bereitwillig mitgemacht (S. 283, 333, etc.). Sie schreiben hemmungslos immer wieder „die Deutschen“. Spätestens im Sommer 1943 hätte die große Mehrheit der Deutschen „damit gerechnet“, dass die Juden ermordet werden (S. 337). Das alles wäre aber nach dem Krieg verdrängt worden (S. 333), und daraus resultiere dann die gebrochene Selbsterzählung der Deutschen (S. 328).
Es ist die ewig falsche Erzählung von „den“ Deutschen als einem Volk von Verbrechern. Man kann den meisten Deutschen gewiss eine schuldhafte Naivität zuschreiben, aber keine verbrecherische Gesinnung. Bei den letzten freien Wahlen erhielt die NSDAP jedenfalls 33%, und nicht 100%. Und was soll das heißen, dass die Deutschen spätestens im Sommer 1943 von der Ermordung der Juden wussten (oder „rechneten“, wie es hier heißt)? Von welcher Qualität war dieses „Wissen“? Die gerüchteweise durchsickernde Information, dass eine völlig aberwitzige, millionenfache Mordaktion an Unschuldigen, Frauen und Kindern eingeschlossen, vor sich ging, kann man kaum als „Wissen“ bezeichnen. Selbst Hannah Arendt hielt die ersten Berichte von US-Korrespondenten aus deutschen KZs für alliierte Propaganda. Wie sollen dann erst die „normalen“ Deutschen es „gewusst“ und geglaubt haben, als es nur ein Gerücht war? Und darüber hinaus: Selbst wenn man im Sommer 1943 verlässlich davon erfahren hätte, dass die Juden ermordet werden, was hätte daraus für eine Konsequenz folgen sollen? Demonstrationen, Aufstand, Verweigerung? Nicht in einer Diktatur, in der Menschenleben nicht zählen. Das Narrativ, dass „die Deutschen“ es wussten und dass „die Deutschen“ es wollten, ist einfach falsch. Allen Ernstes behaupten die Autoren, dass Theodor Heuss, Richard von Weizsäcker und Helmut Schmidt schlicht gelogen hätten, als sie sagten, die NS-Führung hätte die Verbrechen erfolgreich geheim gehalten (S. 336). Das seien nur Schutzbehauptungen gewesen, meinen sie. Doch das ist naseweiser Unfug.
Die Autoren verschweigen völlig, dass es natürlich die linksradikalen 68er waren, die das Narrativ in die Welt setzten, dass die Deutschen es wussten und die Deutschen es wollten. Diese ungerechte These von der Kollektivschuld, diese ungerechte und unwahrhaftige Selbstanklage, die aus rein politischen Motiven erfolgte und im Kalten Krieg durch die kommunistischen Geheimdienste unterstützt wurde, um den Westen und den „Kapitalismus“ moralisch als durch und durch „faschistisch“ zu diffamieren, ist es, die zu der gebrochenen Selbstwahrnehmung der Deutschen geführt hat. Dass der Nationalsozialismus möglich war, stellt einige berechtigte Anfragen an das nationale Selbstverständnis. Aber das hemmungslose Pauschalurteil, dass „die“ Deutschen es wussten und wollten, lässt keinen Raum mehr für ein selbstkritisches, nationales Selbstbewusstsein. Es zerstört zwingend jede Form von Selbstbewusstsein, denn „der“ Deutsche und „das“ Deutsche wird damit zum Bösen schlechthin erklärt. Unter dieser Prämisse ist einzig die Abschaffung von allem Deutschen die Lösung. Und darauf wollen die Autoren dieses Buches auch hinaus. Das ist doch klar, auch wenn sie es nicht so offen sagen.
Deutsches Pflichtgefühl
Es sei das Pflichtgefühl gewesen, das „die Deutschen“ zu Tätern werden ließ, schreiben die Autoren. Durch einen Appell an ihr Pflichtgefühl, das in der Tiefengeschichte Deutschlands wurzele, hätte Heinrich Himmler seine SS-Männer zum Morden gebracht, dokumentiert in seiner Posener Rede vom 04.10.1943 (S. 312, 329). Und nach 1945 hätten sich die Täter dann alle auf ihre Pflicht, Befehlen zu gehorchen, herausgeredet (S. 343). – Auch das ist großer Unfug.
Denn es war gerade das Pflichtgefühl, das viele in den Widerstand gegen Hitler trieb. Es war auch das Pflichtgefühl, das dazu führte, dass mörderische Befehle Hitlers in der Wehrmacht nicht ausgeführt wurden. Das Pflichtgefühl, das auf den antiken Humanismus zurückgeht, namentlich auf Cicero, das Pflichtgefühl, das auf den christlichen Protestantismus zurückging, das Pflichtgefühl, das von Friedrich dem Großen, Immanuel Kant oder den Gebrüdern Humboldt vertreten wurde, verpflichtete gewiss nicht zu Kadavergehorsam und erst recht nicht zum millionenfachen Massenmord.
Die Autoren dieses Buches übernehmen bereitwillig das nationalsozialistische Konzept des Kadavergehorsams, das den Pflichtbegriff völlig pervertierte und bedingungslosen Gehorsam dem Führer gegenüber verlangte, wie wenn es sich um den Inbegriff des deutschen Pflichtbegriffs handeln würde. Das war aber niemals der preußische und deutsche Pflichtbegriff! Damit bewegen sich die Autoren dieses Buches ungefähr auf demselben Niveau wie deutsche Rechtsradikale, wenn diese sagen, dass Präsident Erdogan und sein Regime der Inbegriff des Türkentums sei. Quatsch natürlich. Die Idee, man habe einem Deutschen nur einen Mord befehlen müssen, und schon habe er gemordet, weil er Kadavergehorsam für seine Pflicht gehalten hätte, ist einfach aberwitzig und lächerlich falsch. Und dass sich Täter – Täter! – hinterher unter Verweis auf ihre angebliche Gehorsamspflicht herauszureden versuchten, ist kein Beweis dafür, dass dies tatsächlich ihre wahre Motivation war. Im Gegenteil.
Unfreiwillig enthüllen die Autoren dieses Buches den wahren Grund für den Massenmord: Es war natürlich nicht das historisch gewachsene Pflichtgefühl, sondern die Ideologie des Nationalsozialismus, die zum Morden motivierte. Es war diese Ideologie und ihre radikale Engführung, dass es nur einen Ausweg gäbe, nämlich die Juden zu ermorden. Die Autoren wissen das ebenfalls, wie sie in diesen Worten unfreiwillig zeigen: „… eine Erzählung, die ihnen das Morden leichter machte, ja, ihnen sogar als einzig denkbarer Weg erscheint.“ (S. 312) Nur, dass diese Erzählung natürlich nicht die deutsche Erzählung von der Pflicht war, wie die Autoren behaupten, sondern die nationalsozialistische Erzählung von der angeborenen Schlechtigkeit der Juden, die angeblich aus der Welt geschafft werden müssten, damit Deutschland und die Welt leben können. Die Autoren verwechseln hier Pflichtbewusstsein und Ideologie als Motivation zum Morden. Man möchte fast meinen, dass sie das mit Absicht tun.
Ob sich die Autoren niemals gefragt haben, wie es eigentlich möglich war, dass im kommunistischen Machtbereich ebenfalls viel gemordet wurde? Denn dort gab es kein ausgeprägtes deutsches Pflichtgefühl. Aber was es dort ebenfalls gab, das war eine Ideologie! Die Ideologie des Marxismus-Leninismus. Und es war die Ideologie, die zu den Morden führte, in Deutschland wie in der Sowjetunion. Nicht das Pflichtgefühl. Das Pflichtgefühl führte im Gegenteil eher zu Widerstandshandlungen. Widerstand gab es in Deutschland einigen, von Stauffenberg über die Weiße Rose bis hin zum Verstecken und Decken einzelner Juden. Doch im kommunistischen Machtbereich hört man von Widerstand nicht viel. Denn dort gab es vor allem Ideologie, aber kaum ein ausgeprägtes Pflichtgefühl im deutschen Sinne.
Deutsche Tiefengeschichte
Um ihren Irrtum von einem deutschen Pflichtverständnis, das schon immer dem nationalsozialistischen Kadavergehorsam entsprochen habe, zu untermauern, breiten die Autoren ein Panorama der deutschen „Tiefengeschichte“ vor 1933 aus, das gruseln lässt. Deutschland sei vor allem durch die Institutionen des Militärs und der Universität geprägt gewesen (S. 327). Auf diese Weise waren Frauen immer außen vor, was angeblich zu einer Milderung der Sitten hätte beitragen können. – Wie Autoren, die selbst dem Wokismus anhängen und zwischen Männern und Frauen keine Unterschiede sehen, eine solche Aussage formulieren können, bleibt rätselhaft. Frauen haben jedenfalls im 19. Jahrhundert in vielfacher Weise das gesellschaftliche Leben in Deutschland mitbestimmt, von Königin Luise über Bettine von Arnim bis Bertha von Suttner. Neben dem Militär und der Universität wären außerdem mindestens auch noch Adel und Kirche als Institutionen zu nennen gewesen. Und Literatur und Theater bleiben auch unerwähnt. Und was ist eigentlich mit Handel und Wandel? Kaufleute, Industrielle? Und wie passen Wilhelm von Humboldt und seine Ehefrau Caroline von Dacheröden in dieses Schema? Ach, diese Einseitigkeit ist wirklich gruselig.
Jedenfalls glauben die Autoren, die deutsche Seele wäre damals auf eine Weise geprägt worden, dass niemand sich vor anderen hervortun solle (S. 327) und dass alle nur aus Angst vor sozialer Sanktion ehrgeizig gewesen wären (S. 328). Was für ein Zerrbild! Gab es damals nicht einen höchst individualistischen Goethe- und Genie-Kult? Und überhaupt: Sind denn Offiziere und Professoren dafür bekannt, sich nicht hervorzutun?! Natürlich wollten sich die Menschen hervortun und Orden und Ehren einheimsen, die andere nicht haben! Und dass man im Deutschland des 19. Jahrhunderts nicht aus innerer Überzeugung, nicht aus echtem Pflichtgefühl (!) im Sinne Ciceros, sondern nur aus Angst vor sozialer Sanktion ehrgeizig war, ist auch Unsinn. Die Leute damals lasen, im Gegensatz zu heute, Goethe, Kant und Cicero. Abgesehen davon, dass ein „Pflichtgefühl“, das nur auf Angst vor sozialer Sanktion beruht, kein solches ist. Die Autoren verwickeln sich mit ihrer Theorie vom bösen deutschen Pflichtgefühl in heillose Widersprüche.
Zur Zeit der Weimarer Republik habe dann eine „produktive Tiefengeschichte“ der Deutschen gefehlt (S. 330). Doch haben die Autoren jemals einen Gedanken darauf verschwendet, warum die Weimarer Republik Weimarer Republik hieß? Es ist einfach vollkommener Blödsinn, dass es an einer solchen Tiefengeschichte gefehlt hätte. Es fehlte durchaus an manchem, damals, denn die Geschichte ging bekanntlich nicht gut aus. Aber mit ihrer Analyse verfehlen die Autoren vollkommen den Punkt.
Schließlich begehen die Autoren auch noch eine üble Zitatverbiegung, um ihre These vom Pflichtbewusstsein als dem zentralen Problem zu untermauern. Sie zitieren Sebastian Haffner auf folgende Weise: „Dass der Nationalismus …die Deutschen letztlich ins Bestialische führt, erklärt sich Haffner mit ihrer besonderen „Selbstlosigkeit“, einer ethikfreien Beflissenheit, die man auch mit Pflichtbewusstsein übersetzen könnte.“ (S. 331) Soweit die Autoren über Haffners angebliche Meinung.
Das Originalzitat von Sebastian Haffner sieht aber wie folgt aus: „Nationalismus als nationale Selbstbespiegelung und Selbstanbetung ist sicher überall eine gefährliche geistige Krankheit, … Aber nirgends hat diese Krankheit einen so bösartigen und zerstörerischen Charakter wie gerade in Deutschland, und zwar, weil gerade Deutschlands innerstes Wesen Weite, Offenheit, Allseitigkeit, ja in einem bestimmten Sinne Selbstlosigkeit ist. Bei anderen Völkern bleibt Nationalismus, wenn sie davon befallen werden, eine nebensächliche Schwäche, neben der ihre eigentlichen Qualitäten erhalten bleiben können. In Deutschland aber, wie es sich trifft, tötet gerade Nationalismus den Grundwert des nationalen Charakters. Dies erklärt, warum die Deutschen – in gesundem Zustand zweifellos ein feines, empfindungsfähiges und sehr menschliches Volk – in dem Augenblick, wo sie der nationalistischen Krankheit verfallen, schlechthin unmenschlich werden und eine bestialische Hässlichkeit entwickeln. Ein Deutscher, der dem Nationalismus verfällt, bleibt kein Deutscher mehr.“ (Haffner, Geschichte eines Deutschen, S. 210)
Was Haffner hier beschreibt, ist nicht Pflichtbewusstsein, sondern vielmehr Selbstvergessenheit als Zug deutschen Wesens. Man könnte auch Naivität sagen. Es ist genau jene Naivität, mit der die Deutschen kreuzbrav einer Angela Merkel gefolgt sind und heute lauter Sonderwege in Europa gehen, ob bei Migration oder Energie, wodurch Deutschland zur „loose canon“ in der EU geworden ist. Hier geht es nicht um Pflichtbewusstsein, auch nicht um Gehorsam, sondern es ist willige Selbstaufgabe, es ist Naivität. Es ist der naive und willige Glaube daran, dass das, was vor sich geht, gut und richtig ist, weil es einem so erzählt wird, auch wenn man es vielleicht nicht richtig versteht. Es ist der naive Glaube, dass das, was die Obrigkeit tut, schon wohlgetan sein wird. Echtes Pflichtbewusstsein finden wir auch hier wieder nicht im willigen Mittun, sondern gerade im Widerstand, der aus Pflichtbewusstsein erwächst. Dass die Autoren dieses Buches die Deutung dieses Haffner-Zitates in ihrem Sinne verbogen haben, ist ein weiteres Indiz dafür, dass sie es nicht gut mit ihren Lesern meinen.
Deutsche Tiefengeschichte dieses Buches?
Die Ideologie, die in diesem Buch vertreten wird, hat selbst so manche deutsche Vorgeschichte, wie wir bereits sahen. So vertreten die Autoren dieses Buches z.B., dass der Mensch in der großen Klimaerzählung nicht Protagonist sondern Antagonist sei. Dahinter steht die postmoderne Theorie, dass der Mensch überwunden werden muss. Und hinter dieser postmodernen Theorie steht wiederum der Philosoph Martin Heidegger, der den Nationalsozialismus unterstützte und bei dem der Mensch ebenfalls ins Abseits geriet und der Humanismus verworfen wurde.
Zudem haben die Autoren dieses Buches eine statische Vorstellung von Natur, wie sie ganz dem rechtsradikalen Ungeist von Unberührtheit und Reinheit entspricht, siehe oben. Nicht zufällig hatte die Naturschutzbewegung im Nationalsozialismus ihre erste große Blütezeit.
Und schließlich steht dieses Buch natürlich in einer langen Tradition von linkem und ökologischem Denken, wie sie sich in Westdeutschland seit 1968 entfaltet hat. Man könnte sogar die These wagen, dass wir es mit einer Spätfolge des Kalten Krieges zu tun haben, dessen ideologisches Schlachtfeld nicht zuletzt Westdeutschland war.
Aber die Autoren dieses Buches schweigen über die deutsche „Tiefengeschichte“ ihrer eigenen Ideologie. Die Autoren bekritteln lieber das deutsche Pflichtbewusstsein oder sie beklagen sich darüber, dass die USA versuchten, andere Länder vor dem Kommunismus zu bewahren, anstatt dass sie einmal vor ihrer eigenen Türe kehren würden.
Deutschland heute
Die Autoren beobachten richtig, dass die Selbstwahrnehmung der Deutschen heute massiv gestört ist. So wurde in der BRD z.B. der ökonomische Erfolg zur nationalen Ersatzerzählung (S. 328). Die Leitkultur-Debatte findet keinen gemeinsamen Nenner und ist gerade auch deshalb typisch deutsch (S. 339). Teilweise wird gerade das Negative, das man am eigenen Land finden kann, als „typisch deutsch“ bezeichnet (S. 339 f.), wie wenn es nichts Gutes am deutschen Wesen gäbe. – Der Grund dafür ist natürlich die bereits erwähnte, allzu pauschale Verurteilung der eigenen Vergangenheit. Doch diesen Grund erwähnen die Autoren dieses Buches nicht, denn sie betreiben diese pauschale Verurteilung kräftig mit. So behaupten sie z.B., der Rechtsradikale Bernd Höcke hätte sich eines „faschistischen Narrativs“ bedient, als er eine Erinnerungskultur forderte, die uns Deutsche mit den Leistungen der Vorfahren in Berührung bringt (S. 297). Aber damit verfehlen sie den Punkt, wo das Problem bei Höckes Aussage liegt. Denn die Erinnerung an die Leistung der Vorfahren ist keinesfalls „faschistisch“. Problematisch ist vielmehr, dass Höcke zugleich die Erinnerung an die Verbrechen der Vergangenheit austilgen wollte. Indem sie diesen Punkt verfehlen, und die bloße Erinnerung an die Leistungen der Vorfahren für „faschistisch“ erklären, stricken die Autoren erneut kräftig mit an der nationalen Selbstverklemmung.
Zuguterletzt schlagen die Autoren vor, Angela Merkels „Wir schaffen das“ zur Grundlage einer deutschen Leitkultur zu machen (S. 342, 340). Die Autoren schätzen an Merkel vor allem ihre Zuversicht. Doch diese Zuversicht war naiv und unbegründet. Denn Merkel steht für eine Politik des geringsten Widerstandes, die nicht nach dem Morgen fragt, sondern sich radikal darauf beschränkt, Probleme für den Moment aufschiebend zu „lösen“. Probleme, die dann späteren Zeiten schwer auf die Füße fallen. Angela Merkel steht überdies für die asymmetrische Demobilisierung des demokratischen Wettstreites von Links und Rechts und für ein Handeln im Quasi-Notstand. Dadurch wurde die Demokratie durchaus beschädigt (Euro-Krise, Atomausstieg, Corona-Krise, u.a.). Diese naive Politik führte Deutschland in eine babylonische Verwirrung, die bis heute anhält. „Typisch deutsch“ sei neben Demokratie und Frieden auch Angela Merkel, meinen die Autoren.
Die Idee der Leitkultur sei von Bassam Tibi zudem nie national gemeint gewesen (S. 341). Es geht den Autoren dieses Buches also nicht um eine deutsche Leitkultur, sondern um eine Leitkultur für ein Land, das zwar noch Deutschland heißt, aber nicht mehr deutsch sein soll. Das sagen die Autoren nicht so deutlich, aber darum geht es. Im Grunde sind sie damit genau bei jener gefährlichen „Selbstlosigkeit“ der Deutschen angelangt, die Sebastian Haffner beklagt hatte. Nur, dass die Deutschen diesmal nicht für eine rassistische Ideologie naiv in Dienst genommen werden sollen, sondern für eine öko-marxistische Ideologie. Die Autoren wissen schon, warum sie das Zitat von Haffner nicht im Volltext gebracht haben.
Tiefengeschichte der USA: Trottel und Egomanen
Nachdem sich die Autoren an der Tiefengeschichte Deutschlands versucht haben, zeichnen sie auch die Tiefengeschichte der USA nach, so wie sie es sehen. Die Flachheit der Darstellung ist erbärmlich.
Der typische Anti-Amerikaner glaubte schon immer, dass nur Gauner, Taugenichtse und Tagediebe nach USA ausgewandert seien, und die USA deshalb eine von Grund auf kriminelle Gesellschaft seien. Die Autoren dieses Buch bieten nun eine „intellektuelle“ Variante dieses antiamerikanischen Narrativs: Die ersten Einwanderer nach (Nord-)Amerika waren diesem Buch zufolge hyperreligiöse Feinde der Naturwissenschaft, goldsuchende Glücksritter, und nicht zuletzt viele gutgläubige „Vertragsknechte“, die so dumm waren, sich von den Kolonialgesellschaften für eine Auswanderung anwerben zu lassen (S. 321). Dazu zitieren die Autoren unwidersprochen ihre autoritativen Quellen: Diese sagen z.B., dass „die amerikanische Gesellschaft dadurch geformt [wurde], dass eine Art natürliche Auslese derjenigen Menschen stattgefunden hat, die bereitwillig an Werbung glaubten“, und: „Die erste große angelegte Werbekampagne der westlichen Welt zielte somit darauf ab, für die Gründung Amerikas genug Trottel und Träumer anzulocken.“ (S. 321 Fußnote) – Ein Blick in Wikipedia widerlegt das Bild schnell: Die ersten Siedler der Kolonie Jamestown waren Adelige, zweitgeborene Söhne und deutsche Handwerker.
Weiter meinen die Autoren, dass das Streben nach individuellem Glück, das als höchstes Menschenrecht in den Verfassungstexten der USA verbrieft ist, die Zerstörung des Glücks anderer inhärent bedingen würde. Nämlich das Glück der Indianer und der schwarzen Sklaven (S. 322). Auch das ist ganz großer Blödsinn, oder „ganz großes Kino“, um den Autoren einmal den narrativen Narrenspiegel vorzuhalten. Denn das Streben nach individuellem Glück geht natürlich nicht automatisch einher mit der Zerstörung des Glückes anderer. Zudem waren es diese protestantischen, gläubigen und arbeitssamen Amerikaner, die die Sklaverei schließlich abschafften. Es waren die industrialisierten Nordstaaten unter Führung der Republikanischen Partei, die die Sklaverei abschafften, nicht die rückständigen, agrarisch geprägten Südstaaten unter Führung der Demokratischen Partei.
Und die Indianerfrage ist wiederum ein Kapitel für sich. Die größte Zahl der Indianer kam durch Krankheiten aus Europa ums Leben, auf die ihr Immunsystem nicht vorbereitet war. Das aber kann man niemandem zum Vorwurf machen. Ebenfalls schicksalhaft ist der Umstand, dass die Europäer kulturell unendlich viel weiter entwickelt waren als die Indianer. Ein Zusammenleben war nur möglich, wenn die Indianer den Entwicklungsabstand im Zeitraffer nachvollzogen hätten. Aber wie bewerkstelligt man das, ohne den Indianern ihre Identität zu nehmen? Wie überzeugt man auf die Schnelle eine gewachsene Stammeskultur, sich in die Moderne zu transformieren? Es wäre viel geholfen, wenn die Autoren dieses Dilemma anerkannt hätten, und wenn sie zugeben würden, dass ein guter Ausgang auch ohne einen Präsidenten Andrew Jackson keineswegs eine ausgemachte Sache gewesen wäre. Bereits die ersten Seiten von Karl Mays „Winnetou“ markieren ein bedeutend höheres Reflexionsniveau der Indianerfrage als dieses Buch.
Tiefengeschichte der USA: Fake News
Weiter stellen die Autoren die USA als das Land der Fake News schlechthin dar. Eine magische, naturwissenschaftsfeindliche Vorstellung sei den hyperreligiösen Pilgervätern eigen gewesen (S. 321). Der Zirkusdirektor P.T. Barnum wird als Erschaffer von Illusionswelten dargestellt. Folgender Satz von P.T. Barnum würde perfekt zusammenfassen, dass die USA ein „Fantasyland“ seien: „Weist eine erfundene Aussage ausreichend Spannung auf, und kann niemand beweisen, dass sie nicht stimmt, dann ist es mein Recht als Amerikaner, daran zu glauben.“ (S. 323 Fußnote) Die Autoren dieses Buches bemerken nicht, dass sie mit dieser Kritik an den Grundrechten von Meinungs- und Religionsfreiheit sägen. Was P.T. Barnum hier sagt, ist keineswegs die Deklaration eines Fantasylandes, sondern schlicht die Deklaration eines freien Landes. Man möge zur Probe einmal die Verneinung des Zitats von P.T. Barnum formulieren, und man landet direkt im Totalitarismus.
Die Autoren zeigen sich der Aufgabe eines adäquaten Umgangs mit dem Phänomen „Fake News“ generell nicht gewachsen. Denn dazu müsste man Fake News auf ihre Wahrheit hin überprüfen. Aber genau das tun die Autoren dieses Buches nie: Etwas auf Wahrheit überprüfen. Denn es gibt ihrer Meinung nach ja gar keine Wahrheit bzw. sie tun ständig so, als seien sie selbst stets im Besitz derselben. Deshalb haben sie auch nicht begriffen, dass die „alternativen Fakten“ von Kellyanne Conway keineswegs als Fake News zu verstehen waren (S. 326). Kellyanne Conway hatte tatsächlich eine alternative Quelle anzubieten, die eine alternative Geschichte erzählte (nämlich die Zahlen der Metrofahrgäste des Park Services, im Streit um die Frage, wieviele Gäste zu Trumps Inauguration anwesend waren). Darüber, was ein „Fakt“ ist, muss in einem freien Land durchaus diskutiert werden dürfen. Sonst hätte ja derjenige tyrannische Macht, der festlegt, was ein Fakt ist. Mit einigem Recht sagte schon Nietzsche: „Fakten existieren nicht“, denn für uns Menschen existiert jedes Faktum immer nur unter der Perspektive einer gewissen Interpretation. Oder mit Kant gesprochen: Das „Ding an sich“ ist für uns Menschen nicht wahrnehmbar. Aber ein solches Reflexionsniveau darf man sich von diesem Buch nicht erwarten.
Für die Autoren dieses Buches sind Querdenker einfach nur Corona-Leugner, die „Protofaschismen“ reproduzieren (S. 307). „Protofaschistisch“ unterwegs sei auch, wer glaube, dass die demokratisch legitimierten Eliten korrupt seien (S. 308). Mit solchen steilen Thesen lehnen sich die Autoren sehr weit aus dem Fenster, denn zu den Themen Corona und Korruption von Demokraten könnte manche wahre Geschichte erzählt werden. – Gleichzeitig erlauben sich die Autoren, Wahrheiten auszusprechen, die sonst als rassistisch galten: So schreiben die Autoren seelenruhig die simple Wahrheit, dass chinesische Billigarbeiter in Norditalien dort zur schnellen Verbreitung des Coronavirus beigetragen haben (S. 451). Damals „durfte“ man das aber nicht sagen, erst recht nicht als Konservativer! Hans-Werner Sinn wurde dafür z.B. in einer Talkshow gerüffelt. Man erinnert sich auch noch, wie Donald Trump als „rechts“ verschrieen wurde, weil er den Coronavirus auch den „Chinese virus“ zu nennen wagte. Die Autoren bemerken offenbar nicht, dass sie hier selbst tun, was gestern noch verschrieen war, und wie willkürlich das alles ist. Aber das ist typisch für Ideologen: Sie denken nie darüber nach, dass sie sich auch selbst an das halten müssen, was sie von anderen verlangen.
Zuguterletzt produzieren die Autoren selbst Fake News: Angeblich hätte nämlich der US-Sender Foxnews die sogenannte Pizzagate-Verschwörung aufgegriffen und weiterverbreitet: Kern dieser Verschwörungserzählung ist die These, dass sich hochrangige Politiker im Keller einer Pizzeria in Washington an Kindern vergehen würden (S. 207). Aber hatte der Sender Foxnews das wirklich getan, diese Geschichte als wahr verkauft?! Nein. Eine Recherche fördert keinen Beleg zutage. Im Gegenteil: Auf Wikipedia wird Foxnews in die Reihe derjenigen Medien gestellt, die die Story als falsch entlarvt hatten. Damit haben die Autoren dieses Buches selbst Fake News verbreitet. – Hinzu kommt: Mit dem Skandal um Jeffrey Epstein ist die Pizzagate-Geschichte der Wahrheit näher gekommen, als es uns allen lieb sein kann. Hochrangige Politiker, vielleicht auch Bill Clinton, haben sich tatsächlich an Minderjährigen vergangen, nur eben nicht in dieser Pizzeria. – Überhaupt meinen die Autoren dieses Buches, dass die Vorwürfe, die Trump gegen Hillary Clinton richtete, alle Fake News waren (S. 206 f.). Und Barack Obama würde aus „bescheidenen Verhältnissen“ stammen, schreiben sie, ohne rot zu werden (S. 318).
Die Autoren haben das Thema „Fake News“ sichtlich nicht im Griff. Sie haben mit diesem Buch leider nichts zur Lösung des Problems beigetragen. Die Autoren und ihr Buch sind selbst Teil des Problems.
Tiefengeschichte der USA: „Faschismus“
Überall lauere in den USA der „Faschismus“. Gerade auch in der Pop-Kultur. Dort würde eine „faschistische“ Ästhetik positiv dargestellt (S. 289). Das mag so sein. Aber im Allgemeinen sind es gerade Linke, die eine totalitäre Ästhetik immer wieder mahnend und warnend reproduzieren. Wer hat sich denn in Hollywoodfilmen für diese Ästhetik entschieden, wieder und wieder und wieder? Auch in Deutschland ist die häufigste Person auf dem Cover des linken Nachrichtenmagazins „Der Spiegel“ Adolf Hitler. Botho Strauß schrieb in seinem „Anschwellenden Bocksgesang“: „Überhaupt ist pikant, wie gierig der Mainstream das rechtsradikale Rinnsal stetig zu vergrößern sucht, das Verpönte immer wieder und noch einmal verpönt, nur um offenbar immer neues Wasser in die Rinne zu leiten, denn man will’s ja schwellen sehen, die Aufregung soll sich ja lohnen. Das vom Mainstream Missbilligte wird von diesem großgezogen, aufgepäppelt, bisweilen sogar eingekauft und ausgehalten.“
Was die Autoren nicht verstanden haben: Wenn eine Ideologie penetrant wird, dann verliert sie jede Glaubwürdigkeit und wird durch ihre eigene penetrante Symbolik ironisiert. Die Autoren haben richtig erkannt, dass der Christchurch-Attentäter nur aus böser Ironie Computerspiele als Ursache seiner Radikalisierung angibt (S. 290). Auch die Ikonographie von Pepe dem Frosch ist so zu verstehen (S. 291). Was die Autoren aber nicht begreifen ist, dass es die propagandistische Penetranz ihres eigenen politischen Lagers ist, die diese Dinge hervorbringt.
Völlig ohne jede Ironie sehen die Autoren überall eine „Hundepfeifenkultur“ (dogwhistle culture) (S. 290). Überall gäbe es rassistische Codes. Völlig harmlose Worte, ja, auch völlig offene und ehrliche Worte werden von ihnen rassistisch umgedeutet. So würde Trump z.B. alle Latinos diskriminieren, wenn er von „bad hombres“ spricht. Blödsinn. Trump spricht damit einfach die simple Tatsache an, dass die unkontrollierte Massenzuwanderung aus Lateinamerika auch viele Bösewichter mit ins Land bringt. Wie verbohrt muss man sein, um in dieser klaren und wahren Aussage einen rechtsradikalen Code erkennen zu wollen?
Die Geschichte der 300 Spartaner, die bisweilen von Rechtsradikalen missbraucht wird, wird von den Autoren als eine „von vorne bis hinten erfundene“ Geschichte dargestellt (S. 274 f.). Dazu werden eine ganze Reihe von Eigenschaften der Geschichte explizit durchgesprochen und für unwahr erklärt. Doch ein Blick in die Historien des Herodot lehrt: Im großen und ganzen ist die Geschichte eben doch wahr und nicht erfunden. Sie wird zwar von Rechtsradikalen missbraucht, das ist wahr, aber sie ist nicht „von vorne bis hinten erfunden“. An dieser Stelle fragt man sich als Leser zum soundsovielten Mal: Warum machen die Autoren das? Warum sprechen sie so direkt und leicht nachprüfbar die Unwahrheit? Auf diese Weise bekämpft man doch keinen Rechtsradikalismus, sondern füttert ihn!
Die Autoren behaupten zudem, dass das Kennzeichen einer rechtsradikalen „Heldenreise“ darin bestünde, dass sich der Held nicht ändern muss, während eine „echte“ Heldenreise eine Transformation des Helden beinhalte. Das habe Umberto Eco beobachtet (S. 276 ff.). – Wir erlauben uns, daran zu zweifeln. Denn gilt nicht dasselbe für die „Heldenreise“ des Sozialismus? Zunächst ist im Sozialismus jeder ein Held: Alle Räder stehen still, wenn Dein starker Arm es will. Das Ziel des Sozialismus besteht aber nicht darin, sich selbst zu verändern. Sondern das Ziel des Sozialismus ist die Wiedergewinnung der Gleichheit, die angeblich einst in der Urgesellschaft geherrscht hätte. Nicht der Mensch soll sich verändern, sondern das System. Und dafür wird in der Internationale zur „letzten Schlacht“ aufgerufen. – Aber auch Demokraten kämpfen oft mit Recht darum, dass es keine schädliche Veränderung gibt. Die Bewahrung der natürlichen Umwelt, die Bewahrung von historischer Bausubstanz, die Bewahrung von sozialen Rechten, und nicht zuletzt die Bewahrung der Demokratie vor ihren Feinden: All das sind „Heldenreisen“, in denen es nicht um Transformation geht, sondern darum, dass sich nichts verändert. Und auch Odysseus kämpft nicht für eine bessere Zukunft, sondern um seine Heimkehr in das altgewohnte Ithaka. – Insofern ist die ganze Idee, die hier präsentiert wird, unsinnig. Auch wenn sie von Umberto Eco stammen sollte.
Ironischerweise unterstellen die Autoren der Trump-Bewegung, es sei „faschistisch“, zurück zu den guten alten Zeiten zu wollen (S. 296). Aber auch die Sozialisten wollen zurück zur Gleichheit der Urgesellschaft. Andererseits ist auch ein Zurück eine Art der Transformation. Und warum sollte es falsch sein, sich nach besseren Zeiten zurück zu sehnen, wenn die Zeiten tatsächlich besser waren? Diese ganze Idee, dass eine „faschistische“ Heldenreise angeblich nicht in Selbsttransformation bestehen würde, ist offensichtlich falsch und wird hier willkürlich eingesetzt, um missliebige Ideen zu diskreditieren. Nicht zuletzt wollen auch die Autoren dieses Buches zurück, nämlich zurück in die Zeit, als es noch keine Monogamie gab (S. 353). Und keine industrielle Umweltverschmutzung. Aber das gilt dann nicht als „faschistisch“. Tja.
Tiefengeschichte der USA: Schluss
Soweit die Sicht auf die „Tiefengeschichte“ der USA. In Wahrheit war es eher ein tiefer Blick in die Untiefen der Seelen der Autoren dieses Buches. Was haben sie nicht alles falsch analysiert! Und mehr noch: Was haben sie nicht alles unterschlagen! Das,was sie nicht sagen, wollen wir jetzt noch kurz etwas beleuchten.
Die USA sind keinesfalls ein Fantasyland, sondern im Gegenteil das Land der harten Realitäten. Hier mussten die Siedler sich alles selbst aufbauen. Was sie nicht selbst erschufen, das gab es auch nicht. Und es gab auch keine Monarchie, keinen Adel und keine beherrschenden Kirchen wie in Europa. Etwas böswillig und ungerecht, aber nicht völlig falsch, könnte man sagen: Dieser ganze Fantasy-Firlefanz, den es in Europa gab, den gab es in Amerika nicht. Und Disney spielt vor allem mit Phantasien, die es in Amerika eben gerade nicht gibt, symbolhaft verkörpert im Disney-Schloss. Es gibt keine Schlösser in Amerika.
Aber vor allem ist Amerika das Land der Freiheit. Die ganzen Bedrückungen durch Staat, Religion und Tradition aus dem alten Europa schüttelte man hier ab. Hier wurde nicht jeder Tellerwäscher zum Millionär, aber anders als in Europa hatte jeder Tellerwäscher hier tatsächlich die Chance, zum Millionär aufzusteigen, ohne von gewachsenen gesellschaftlichen Strukturen daran gehindert zu werden. Dieses Versprechen der Freiheit war es, das viele Zuwanderer anlockte. Und dieses Versprechen der Freiheit haben die USA auch gerne an andere weitergereicht. Nicht zuletzt auch durch die Befreiung Europas 1945 vom Nationalsozialismus und 1989 vom Kommunismus, und durch den Aufbau der Demokratie in Deutschland. Davon schweigen die Autoren aber. Es kommt in ihrem Buch nicht vor. Es hätte nicht in ihr Narrativ gepasst.
Donald Trump
Die Autoren dieses Buches sehen in Donald Trump die fleischgewordene amerikanische Tiefengeschichte, so wie sie es verstehen: Trump ist für sie ein Trottel, ein Rassist, ein „Faschist“, ein notorischer Lügner. Ganze 30573 Lügen soll Trump erzählt haben, zitieren sie die Washington Post (S. 293). Und sie glauben den Unsinn natürlich. Doch wer je einen „Faktencheck“ zu Trump gelesen hat, weiß, dass hier politisch unliebsame Meinungen kurzerhand zur „Lüge“ erklärt wurden. Oder Trumps ironisches Sprechen wurde als „Lüge“ gewertet.
Trump sei „gegen Ausländer“, und er habe seine Anhänger angewiesen, das Kapitol zu stürmen, schreiben die Autoren dieses Buches (S. 319). Auch das ist alles Unsinn. Es waren die Proud Boys und Oathkeepers und andere böse Buben, die sich am 06. Januar 2021 nicht bei Trumps Rede am Weißen Haus, sondern direkt am Kapitol versammelten und dieses gezielt stürmten, während Trump noch eine halbe Stunde lang redete. Als dann ein kleiner Teil der Zuschauer von Trumps Kundgebung zum Kapitol herübergelaufen kam, war der Durchbruch durch die Polizeiabsperrung schon geschehen, und die Trump-Anhänger wunderten sich, warum sie von der Polizei durchgewunken wurden. Und während Trump twitterte „Respect the police“ schrieen einige Radikale im Kapitol „Fuck the police“. Aber die Autoren dieses Buches meinen, dass es die Verkörperung von Trumps Amerika nur für weiße Proud Boys gäbe (S. 295). Doch gerade von den Proud Boys hat sich Trump explizit distanziert. Davon berichten die Medien aber nicht. Die Autoren dieses Buches auch nicht. Wer verbreitet hier eigentlich Fake News?
Die Autoren zitieren eine ihrer vielen Autoritäten, natürlich wie immer unwidersprochen und damit zustimmend, dass die Wähler Trumps mit ihrer Wahl gegen ihre eigenen ökonomischen Interessen gehandelt hätten (S. 312). Man muss allerdings sehr linksradikal denken, um das so sehen zu können. Denn ist es nicht wahr, dass die USA viele Industriearbeitsplätze an andere Länder abgegeben hatte? Ist es nicht wahr, dass die internationalen Handelsabkommen oft nicht fair waren? Ist es nicht wahr, dass unkontrollierte Masseneinwanderung gerade den kleinen Leuten besonders viel zu schaffen macht? Ist es nicht wahr, dass die linksradikalen Vorstellungen von Klimaschutz Industrie und Wohlstand zerstören? Auch Julian Nida-Rümelin kam zu dem Schluss, dass die Trumpwähler keineswegs gegen ihre eigenen Interessen verstießen („Die gefährdete Rationalität des Denkens“, S. 76 f.). Und last but not least: Es gibt nicht nur ökonomische Interessen, sondern z.B. auch kulturelle Interessen. Aber um solche Interessen erkennen und anerkennen zu können, müsste man mehr als nur ein Materialist sein.
Die Autoren versuchen den Zorn der Trumpwähler mit einem „Warteschlangenmodell“ zu erklären (S. 315-317). Demzufolge würden die Trumpwähler glauben, sie würden in einer langen Warteschlange stehen, die nach Verdienst geordnet ist, und wer am meisten Verdienst hat, rückt nach vorne auf und wird am meisten belohnt. Wenn dann Schwarze und Latinos u.a. vor ihnen bevorzugt werden und an der Warteschlange vorbeiziehen, um im Sinne des Wokismus historische Ungerechtigkeiten auszugleichen, würden sie das als ungerecht empfinden. Insbesondere den Aufstieg Obamas hätten die Trumpwähler in diesem Sinne nicht akzeptieren können.
Diese Theorie ist auf vielen Ebenen Unsinn. Erstens ist der Aufstieg eines Einzelnen wie Obama für niemanden ein Problem, gerade auch in USA nicht. Das Problem mit Obama war nicht seine Hautfarbe, sondern seine linke Politik. – Hingegen ist die woke Mode, Minderheiten überproportional zu bevorzugen, um damit angeblich historische Ungerechtigkeiten wiedergutzumachen, tatsächlich völlig falsch und ungerecht, denn es gibt keine Kollektivschuld und auch keine historische Schuld, die sich vererbt. Selbstverständlich ist es ungerecht, wenn man nicht nach Verdienst belohnt wird. – Drittens dürfte genau dieses woke Phänomen aber 2016 noch nicht den Ausschlag für Trump gegeben haben, sondern einfach der Niedergang der Industriearbeitsplätze und die linke Politik Obamas. – Mit anderen Worten: Die Autoren glauben, eine Wirkung ihrer woken Gesellschaftspolitik zu sehen, die so aber noch gar nicht vorlag, und sie unterstellen den Trumpwählern außerdem, zu dumm zu sein, um die Richtigkeit ihrer woken Gesellschaftspolitik zu verstehen, obwohl diese woke Politik völlig irre ist. Aber in Wahrheit ging es gar nicht um die woke Gesellschaftspolitik, sondern um etwas ganz anderes, und die Autoren dieses Buches sind dermaßen in ihrer Ideologie gefangen, dass sie es nicht sehen können.
Gegen Monogamie
Die Autoren wettern wiederholt gegen die Monogamie, also gegen das Ideal der Liebesbeziehung von zwei Personen (z.B. 353-355, 375). Die Menschen würden von diesem falschen Narrativ beherrscht und dadurch in unnötige Probleme geraten. „Treue“ wird in Anführungszeichen geschrieben. Man belüge sich nur selbst. – Damit bleiben die Autoren sich treu. Denn bei Marx und Engels las man es nicht anders. Marx und Engels wollten außerdem die Eltern von der „Last“ ihrer Kinder „befreien“: Dieser Gedanke bleibt hier jedoch ungesagt.
Weiter schreiben die Autoren: Die biologische Realität habe mit der Monogamie nichts zu tun. Angeblich wäre der Mensch ursprünglich polygam gewesen. Erst mit der Sesshaftwerdung sei die Monogamie entstanden. Zu diesen Urzuständen wollen die Autoren dieses Buches zurück.
Dem ist zu entgegnen: Ist Liebe und Treue wirklich nur Lug und Trug? Wenn es so wäre, die Menschheit wäre längst den Kältetod gestorben. Natürlich: Das reine Ideal ist schwer zu verwirklichen. Aber dass Ideale schwer zu verwirklichen sind, war noch nie ein Grund, sie fallen zu lassen. Familie hält und bewährt sich, trotz allem, immer wieder. Weiter gilt: War der Übergang von der Horde zur Einehe nicht ein zivilisatorischer Fortschritt? Man bedenke: In der Zeit der Horde hat der Hordenführer alle Frauen für sich gehabt, und vielleicht noch einige Günstlinge partizipieren lassen. Der Übergang zur Einehe ist eindeutig ein großer Schritt in Richtung Freiheit und Gerechtigkeit gewesen, sowohl für Männer als auch für Frauen. Und warum loben islamische Frauenrechtlerinnen den Westen für die Einehe? Vielleicht ist die Vielehe für Frauen doch nicht so erstrebenswert. Hinzu kommt, dass es auch für die Erziehung der Kinder ein entscheidender Unterschied ist, ob sie in einer intakten, „klassischen“ Familie aufwachsen oder nicht. Menschenkinder sind keine Affenkinder, die einfach in der Horde mitgeschleift werden können. Auch die davor genannten Punkte lassen sich bereits mit Biologie untermauern, denn auch unsere Gehirne sind evolutionär fest verdrahtet, aber vielleicht ist es dieser letzte Punkt der Kindesentwicklung, der am ehesten sinnfällig werden lässt, dass es um biologische Realitäten geht, die man nicht hintergehen kann.
Es sind die Strukturen der Wirklichkeit selbst, die dazu führen, dass traditionelle Ideale eben doch tendentiell zum Glück führen, während alternative Modelle häufig scheitern. Einzig, dass man das nicht holzschnittartig sehen darf, und jeder Mensch im Einzelfall für sich selbst entscheiden muss. Aber die Idee, dass die menschliche Gesellschaft großflächig polygam leben könnte und dadurch glücklicher wäre als jetzt, ist wieder einmal „ganz großes Kino“.
Gegen Männer
Wir schicken voraus, dass es richtig ist, dass sich im Rahmen der sogenannten Manosphere und der Incel-Bewegung gewisse Tendenzen zeigen, die rechtsradikal sind, abgesehen davon, dass es dort offenbar an klassischer Lebensweisheit fehlt. Doch natürlich treiben die Autoren auch dieses Thema ideologisch auf die Spitze.
Männer werden in diesem Buch nach Strich und Faden kritisiert (vor allem S. 367-374). Männerrechte und „Faschismus“ werden in einem Atemzug genannt (S. 372). Hier wie überall verschwenden die Autoren keine einzige Sekunde auf den Gedanken, dass die Radikalität der eigenen, linken Seite, maßgeblich mitschuld daran sein könnte, dass sich die Gesellschaft in so seltsamen Gruppen wie Manosphere und Incel polarisiert hat. Die Autoren sehen dort mit einigem Recht viel Zynismus, Nihilismus, Sarkasmus und Resignation (S. 373). Aber sind die Autoren nicht selbst zynisch? Sie beschreiben den Menschen als eine Maschine oder als „erzählenden Affen“. Sie glauben, die Menschen mit Narrativen manipulieren zu können und zu dürfen. Sie sind Marxisten und Materialisten. Sie machen rücksichtslos von der Unwahrheit Gebrauch. Und diese Autoren beklagen sich, dass sich die Gesellschaft polarisiert und zynische und nihilistische Gegenbewegungen entstehen?!
Aber mehr noch: Der Gipfel ist, dass die Autoren der Kernthese der Incel-Bewegung sogar ausdrücklich Recht geben und diese Zustände gutheißen! (S. 373 f.) Demzufolge würden heute in der westlichen, aufgeklärten Welt 20% der Männer 80% der Frauen absahnen, wie im Tierreich. Wir wissen nicht, ob das stimmt, aber es ist etwas Wahres daran. Jedenfalls bestätigen die Autoren dieses Buches diese These und finden es: Gut! Und sie rechtfertigen diesen Zustand: Mit dem Tierreich! Der Gedanke der Incels, dass in einer idealen Welt jeder eine Frau abbekommen sollte, wird „autoritär“ genannt, denn niemand habe Anspruch auf eine Frau. – Dieselben Autoren, die gegen das Patriarchat sind und (mindestens) für die Gleichberechtigung der Frau, haben also kein Problem damit, dass sich Zustände einstellen, in denen ein paar Machos die Mehrzahl der Frauen abbekommt?! Und sie vergleichen das Kulturwesen Mensch mit Tieren?! Und wer die Zustände beklagt und zu äußern wagt, dass er auch gerne eine Frau haben würde, der sei „autoritär“?! Das alles muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Da ist es durchaus verständlich, wenn auch nicht billigbar, wenn manche sarkastisch werden und sich als Incel in der Manosphere radikalisieren. Dieser Vergleich mit dem Tierreich ist keinen Deut besser als der typische Macho-Vergleich mit dem Tierreich, demzufolge nämlich Männer angeblich von Natur aus danach streben würden, ihren Samen möglichst breit auszustreuen, weshalb sie das natürliche Recht auf Promiskuität hätten – Frauen jedoch nicht. Auf diesem Niveau bewegen sich die Autoren dieses Buches hier.
Und was die Autoren ebenfalls völlig unbedacht lassen: Jede Zivilisation steht und fällt mir ihrer Reproduktion in der nächsten Generation. Wenn eine Kultur, und sei sie noch so erstrebenswert, an dieser Aufgabe scheitert, dann geht sie unter, und es wird unweigerlich eine andere Kultur übernehmen. Meistens wird es eine Kultur sein, die bei weitem nicht so aufgeklärt ist. Diese Problematik wird in diesem Buch völlig übergangen. Fortschritt ist in jedem Fall nur dann nachhaltig, wenn er für mehr als nur für eine Generation erkämpft wurde. Aber der Leser möge nicht vergessen: Der Mensch selbst gilt in diesem Buch als der große Antagonist, und es gilt, den Menschen zu überwinden … aha!
Auch das Narrativ der „Heldenreise“ sei inhärent sexistisch, meinen die Autoren dieses Buches. Die Heldenreise würde patriarchales Anspruchsdenken codieren, denn am Ende bekommt der Held immer seine Frau (S. 363). Die Heldenreise wäre inhärent heteronormativ, ginge also von der Einteilung der Menschen in Mann und Frau aus (S. 361). Und die Heldenreise würde auf dem Kapitalismus als kultureller Norm beruhen, denn allein schon das Konzept eines Gewinns als Ziel der Heldenreise zeige das (S. 361). Die Heldenreise sei wie ein männlicher Orgasmus strukturiert (S. 362). Alternativ wird eine feministische Heldenreise vorgeschlagen, mit vernetzten Heldinnen (S. 365).
Wer wie unsere Autoren mit allen Traditionen und Werten brechen will, die in Jahrtausenden gewachsen sind, der hat mit der „Heldenreise“ natürlich so seine Probleme. So große Probleme, dass er sich dabei in Selbstwidersprüchen verstolpert. Denn auch die vorgeschlagene feministische Heldenreise zielt auf einen Gewinn ab, wenn auch einen gemeinsamen Gewinn unter Freundinnen. Wieso das nicht mehr „kapitalistisch“ sein soll, bleibt unerfindlich. Abgesehen davon, dass z.B. auch Odysseus immer auch mit und um das Leben seiner Gefährten ringt und Hilfe durch die Götter erfährt, also ebenfalls „vernetzt“ ist. Und um überhaupt feststellen zu können, dass die Heldenreise angeblich patriarchalisch ist, und um überhaupt einen feministischen Gegenentwurf präsentieren zu können, müssen die Autoren ihrerseits eine heteronormative Weltsicht annehmen. Das alles geht nicht wirklich schlüssig auf, und am Ende bleibt die banale Erkenntnis, dass die Heldenreise vielleicht tatsächlich patriarchale und kapitalistische Aspekte hat, über die man reden kann, aber im Kern ist sie doch einfach ein zutiefst menschliches Narrativ, das alle Menschen anspricht.
Für Frauen
Frauen werden in diesem Buch praktisch nirgends auch nur annähernd kritisch in den Blick genommen. Warum eigentlich nicht? Sind Frauen denn unfehlbar? So stellt es sich dar. Und sind die Autoren nicht für Gleichberechtigung? Offenbar nicht, sondern im Rahmen des Wokismus wird offenbar versucht, die historisch angeblich benachteiligten Frauen mehr als nur gleichzuberechtigen.
Es wäre interessant gewesen zu erfahren, was die Autoren dieses Buches z.B. zu den Thesen von Esther Vilar sagen würden, die in ihrem Buch „Der dressierte Mann“ schon 1971 feststellte, dass Männer in der modernen Gesellschaft inzwischen schlechter gestellt sind als ihre Ehefrauen. Doch die Autoren müssen gedacht haben, dass solche Gedanken die „erzählenden Affen“ nur verwirren würden. Also schweigen sie dazu.
Die Autoren beklagen, dass in alten Mythen und auch in den Texten der Weltliteratur aller Zeiten immer wieder zum Ausdruck komme, dass die Frau schuld sei (S. 346 ff.). Es handele sich um „misogyne Propaganda“. – Doch so einfach ist es nicht. Denn obwohl in alten Mythen und Texten vieles recht holzschnittartig dargestellt wird, sind darin doch womöglich tiefere Wahrheiten verborgen, die man nicht so einfach los wird, indem man die Texte zensiert. Es gibt einen Grund, warum sich solche Themen in allen Kulturen und in allen Zeiten herausgebildet haben. Wenn es alles reine Erfindung wäre, die den Menschen nichts zu sagen hätte, wie hätten sich solche Themen dann halten können? Die Idee, dass das alles nur „misogyne Propaganda“ wäre, erscheint doch recht einfältig. Die wahre Aufgabe bestünde doch eher darin, die alten Texte von ihrer Holzschnittartigkeit zu befreien und die bleibende Substanz freizulegen. Psychologie und Geschlechterforschung haben dazu viel zu sagen. Auch Frauen haben ihre ganz eigenen, typischen Fehler. Und über diese müsste gesprochen werden. Doch nicht in diesem Buch.
Die Autoren leugnen, dass im Drama um Prinz Harry und Meghan Markle die Frau schuld sei (S. 356). Doch natürlich ist sie schuld. Meghan Markle hat nicht verstanden, welchen Sinn und Wert die britische Monarchie hat. Und sie hat nicht verstanden, dass ihre ideologisch getriebene Hypersensibilität in Sachen Rassismus völlig abgehoben und unmenschlich ist. Doch die Autoren dieses Buches behaupten, es wäre die Presse gewesen, die ein misogynes Narrativ auswählte.
Die Autoren dieses Buches behaupten frech, dass die Helden in den klassischen Heldenreisen praktisch immer Männer wären (S. 359). Doch dieser Unfug lässt sich durch Gegenbeispiele leicht widerlegen. Da ist z.B. die Heldenreise der Penelope, die ebenfalls auf ihre Weise kämpfen und leiden muss, bis Odysseus nachhause zurückkehrt. Oder Helena, die sich entscheidet, mit Paris aus ihrer Ehe nach Troja zu fliehen und dadurch eine Katastrophe heraufbeschwört. Oder Medea, die am Ende ihre eigenen Kinder tötet. Oder Iphigenie auf Tauris. Oder Kleopatra, die ihr Leben lang in immer neuen Wendungen um Ägypten kämpfte. Oder die Königin Zenobia von Palmyra, die Rom die Stirn bot. Oder die Philosophin Hypatia von Alexandria. Und was ist eigentlich mit Kallirrhoë in dem Roman „Chaireas und Kallirrhoë“ von Chariton von Aphrodisias? Sie ist die Hauptperson in diesem epochemachenden antiken Romanwerk, doch unsere angeblich literarisch beschlagenen Autoren wissen davon nichts.
Rassismus
Die Autoren verbreiten das Narrativ, dass Menschenrassen dazu erfunden wurden, um weiße Privilegien zu legitimieren. Die Portugiesen, die im 15. Jahrhundert an der westafrikanischen Küste entlangsegelten, hätten alle Schwarzafrikaner wie ein Volk, eine Rasse, angesehen, und sie für primitiv gehalten – indem man sie versklavte, befreite man sie von ihrer Primitivität (S. 259 ff.). Dieses Narrativ stellt die Dinge allerdings grob vereinfacht dar und verfälscht sie damit. Denn die portugiesischen Seefahrer, die als erste Europäer den schwarzen Menschen Afrikas südlich der Sahara direkt begegneten, benannten diese (natürlich) nach ihrem hervorstechendsten Merkmal, nämlich ihrer schwarzen Hautfarbe. Das ist nur zu verständlich. Auch die amerikanischen Indianer nannten die weißen Europäer „Bleichgesichter“. Das ist zwar etwas pauschal, aber noch nicht rassistisch. Die Portugiesen des 15. Jahrhunderts hatten noch keine Rassetheorien. Diese entstanden erst im 18. Jahrhundert. Die Primitivität, die man den Schwarzen unterstellte, war noch keine rassistische Unterstellung einer angeborenen Primitivität, denn man glaubte immerhin, dass die Schwarzen aus ihrer Primitivität befreit werden können. Und es ist auch falsch, dass die Portugiesen die ersten gewesen wären, die schwarze Menschen versklavt hätten. Es ist auch falsch, dass alle schwarzen Menschen als Sklaven angesehen wurden. Die Handelspartner im Sklavenhandel waren meist selbst Schwarze. Und es ist falsch, dass nur Schwarze versklavt wurden. Die Araber versklavten lange vor den Portugiesen sowohl schwarze als auch weiße Menschen. Auch die Leibeigenschaft im Feudalsystem des christlichen Mittelalters war eine Form von Sklaverei. Ganz ohne Schwarze. Im antiken Athen oder Rom waren die meisten Sklaven sowieso Weiße.
Es ist eigentlich unerträglich, dass die Autoren dieses Buches ein so sensibles Thema so holzschnittartig präsentieren. Sie berufen sich dafür natürlich wieder auf eine Autorität, nämlich den Historiker Ibram X Kendi (S. 258 ff.). Doch Ibram X Kendi ist kein Historiker. Er studierte African American Studies und ist ein linksradikaler Aktivist. Ja, er hat tatsächlich Professuren für Geschichtswissenschaften an den Universitäten in Washington und Boston erhalten, aber wohl kaum, weil er ein solider Historiker ist, sondern weil er auf der Welle des Zeitgeistes schwamm.
Einige Seiten später wird unter Berufung auf einen gewissen El-Mafaalani behauptet, dass die Denker, die den Humanismus entwickelt hätten, dieselben Denker gewesen wären, die den Rassismus entwickelt hätten (S. 263). El-Mafaalani ist ein deutscher Soziologe und Integrationswissenschaftler, aber kein Historiker. El-Mafaalani koordinierte u.a. im grün-geführten Integrationsministerium des Landes Nordrhein-Westfalen die grüne Integrationspolitik. Doch zurück zum Thema: Die aufgeklärten, weißen Menschen hätten den Rest der Welt für ihren Reichtum schuften lassen. Und auch die geistige Bewegung der deutschen Romantik, die Wendung nach innen, wäre nur möglich gewesen, weil es eine Ausbeutung nach außen gegeben habe: Sklaven. – All das ist natürlich wieder „ganz großes Kino“ und einfach nur blanker Unsinn. Die Denker des Humanismus und der Aufklärung waren natürlich keine Rassisten, sondern wandten sich vielfach explizit gegen Rassismus und Sklaverei. Und der Wohlstand „der Weißen“ verdankte sich nicht der Sklaverei, sondern der gesellschaftlichen Entwicklung hin zu mehr Freiheit, die wiederum eine technologische Entwicklung ermöglichte: Es war die Erfindung der Druckerpresse und der Dampfmaschine, die den Wohlstand begründete, um es plakativ zu sagen, nicht die Sklaverei. Wenn es die Sklaverei gewesen wäre, dann hätten die Araber lange vor den Europäern dieses Wohlstandsniveau erreicht. Das haben sie aber nicht.
Das Buch schneidet das folgende Thema nicht an, aber wir erwähnen es dennoch, weil es eng damit zusammenhängt und heute immer wieder falsch verstanden wird: Die Portugiesen nannten die schwarzen Menschen Afrikas „Schwarze“, und das ist in ihrer Sprache: „negro“. Daraus entwickelte sich das englische „negro“, das französische „nègre“ und das deutsche „Neger“: Alle diese Worte bedeuten ebenfalls einfach nur „Schwarzer“. Damals konnten alle gebildeten Menschen Latein und jeder wusste: Dahinter steht das lateinische Wort „niger“ = schwarz. Mit dem abfällig gemeinten, amerikanischen N-Wort hat das alles nichts zu tun. Dennoch begann man in Deutschland (um 1980?) auf den Gebrauch des Wortes „Neger“ immer mehr zu verzichten, weil es eine lautliche Ähnlichkeit von „Neger“ zum amerikanischen N-Wort gab. Man wollte Missverständnisse vermeiden. Der Grund war aber nicht, dass das Wort „Neger“ selbst ein Problem gewesen wäre. – Leider gibt es heute viele Menschen, auch in der Wissenschaft, die von „N-Wort“ sprechen, obwohl nur von „Neger“ die Rede ist. Diese Leute wollen bewusst Verwirrung stiften: Sie wollen die Mär in die Welt setzen, dass das deutsche Wort „Neger“ abfällig gemeint gewesen wäre, wie einst das amerikanische N-Wort, weshalb es praktisch dasselbe sei. Damit werden dann alle Menschen, die jemals von „Neger“ geschrieben oder gesprochen haben, posthum zu Rassisten oder wenigstens zu unsensiblen Menschen erklärt. Auf diese Weise soll gezeigt werden, dass die ganze Gesellschaft schon immer rassistisch gewesen wäre. Aber all das ist natürlich großer Unfug. Wenn ein Wolfgang Koeppen oder eine Anna Seghers „Neger“ schrieben, dann zeugt dies nicht von einem fahrlässigen Umgang mit rassistischen Worten, sondern es zeugt davon, dass das Wort „Neger“ damals keine rassistische Konnotation hatte. Sonst hätten sie dieses Wort nicht benutzt. Spätestens, wenn man bedenkt, dass Aufklärer und Humanisten wie Johann Gottfried Herder oder Alexander von Humboldt sich gegen die aufkommenden Rassetheorien wandten und Schwarze vor Vorurteilen in Schutz nahmen, zugleich aber bedenkenlos von „Negern“ sprachen, wird klar, dass „Neger“ historisch kein rassistisch konnotiertes Wort war. Es bedeutete schlicht genau dasselbe wie heute „Schwarzer“. Man stelle sich vor, in 50 Jahren würde irgendein naseweiser Professor Anklage erheben, dass alle, die heute von „Schwarzen“ reden, Rassisten seien …
Toleranz?
Die Intoleranz der Autoren dieses Buches zeigt sich u.a. darin, dass sie um das bekannte, Voltaire zugeschriebene Wort herumeiern: „Ich mag verdammen, was Du sagst, aber ich werde mein Leben dafür einsetzen, dass Du es sagen darfst.“ (S. 435 Fußnote) – Die Autoren schreiben, dass sie das jetzt sagen „müssten“. Doch es bleibt bei dem Konjunktiv. Und es ist nur in einer Fußnote. Also haben die Autoren diesen Satz am Ende nicht wirklich gesagt. Es sieht nur so aus. Der Eindruck des Herumeierns verstärkt sich, wenn die Autoren dieses Buches davon sprechen, dass man auch Narrative zulassen müsse, die den eigenen widersprechen, aber nur, solange sie nicht die Toleranz selbst angreifen, weshalb „protofaschistische“ und „verschwörungstheoretische“ Narrative zu „problematisieren“ seien (S. 437 f.). Wir wissen aber als Leser dieses Buches, was die Autoren dieses Buches für „protofaschistisch“ und „verschwörungstheoretisch“ halten, nämlich leider sehr vieles. Allzu viel Toleranz darf man sich von diesen Leuten nicht erwarten.
Die Intoleranz der Autoren dieses Buches zeigt sich ebenfalls an der These, dass es in Wahrheit gar keine Cancel Culture gäbe (S. 435 f.). Cancel Culture gäbe es nur in der Wahrnehmung der „autoritären“ Vorstellung, dass es ein Recht gäbe, gehört zu werden. Da es völlig legitim sei, Autoritäres vom Diskurs auszuschließen, gäbe es demzufolge nur aus einer autoritären Sicht eine Cancel Culture. – So einfach und elegant kann man sich unliebsamer Andersdenkender entledigen. In Wahrheit agieren die Autoren hier selbst autoritär, denn sie maßen sich ja die Entscheidung darüber an, was autoritär ist und deshalb aus dem Diskurs ausgeschlossen werden darf. Indem sie unliebsamen Andersdenkenden vorwerfen, autoritär zu sein, handeln sie selbst autoritär.
Immer wieder sprechen die Autoren von der „liberalen Demokratie“ (z.B. S. 438). Aber Demokratie benötigt kein Adjektiv, auch nicht das Adjektiv „liberal“. Demokratie ist entweder demokratisch oder es ist keine Demokratie. Ein Adjektiv wird nicht benötigt. Demokratie ist ihrer Verfasstheit nach per se liberal, insofern alle Meinungen, die die demokratischen Spielregeln einhalten, in der Demokratie mitspielen dürfen. Demokratie ist ihrer Verfasstheit nach aber zugleich auch nichtliberal, insofern auch konservative Kräfte Wahlen gewinnen dürfen. Deshalb ist der Zusatz „liberal“ so gefährlich. Es ist ein Versuch, konservative Kräfte aus dem demokratischen Spektrum auszuschließen. Das ist sehr antidemokratisch. Hinzu kommt, dass das Wort „liberal“ sehr vieldeutig ist. Liberalität bedeutet Freiheit, doch Freiheit für wen?
Mit Recht wird Viktor Orban für seine „illiberale Demokratie“ in Ungarn kritisiert. Auch das Adjektiv „illiberal“ gehört nicht zu einer echten Demokratie. Das größte Problem in Ungarn ist, dass die Medien immer mehr auf die Linie von Viktor Orban gebracht wurden. Es wird mit Recht kritisiert. – Doch halt! Wie sieht es eigentlich bei uns in Deutschland mit den Medien aus? Gibt es nicht auch hier beherrschende, etablierte Medien, nämlich die öffentlich-rechtlichen Sender, die längst zur Beute der etablierten politischen Parteien geworden sind? Die längst nicht mehr ihrem demokratischen Auftrag gerecht werden? Die längst von Journalisten betrieben werden, deren politische Einseitigkeit vielfach festgestellt wurde? Hätte ein Buch über die Macht der Narrative nicht vielleicht auch etwas zu unserem Mediensystem sagen müssen? Ob es gerecht organisiert ist, und wie man es gerecht organisieren könnte? Immerhin werden Narrative heute vor allem durch Medien verbreitet! Doch dieses Buch schweigt dazu eisern. Wie wenn es damit keine Probleme gäbe. Offenbar sind die Autoren mit den gegenwärtigen Zuständen ganz zufrieden.
Radikaler Wokismus, verschleiert
Der Wokismus, das ist eine Ansammlung von holzschnittartigen, linksradikalen Ideen: Von der Critical Race Theory, derzufolge die Weißen eine historische Kollektivschuld gegenüber Schwarzen hätten, die abzutragen ist, über die Idee, dass das Geschlecht reine Definitionssache sei und deshalb gewechselt werden könnte, bis hin zur Gendersprache. – Doch die Autoren dieses Buches verharmlosen den Wokismus als „gesellschaftlichen Wandel“ (S. 296), wie wenn es um den allmählichen, von selbst geschehenden, gesellschaftlichen Wandel ginge. Identitätspolitik, das sei einfach „Liberalisierung, Antidiskriminierung und Ermächtigung von Marginalisierten“ (S. 439). „Empathie“ sei nötig (S. 441), und eine wahrhafte Gleichberechtigung der Menschen wäre gegeben, wenn keiner aufgrund seiner Unterschiede benachteiligt würde (S. 442). In der Welt der Wirtschaft müsse man zudem ein umweltverträgliches Wirtschaften zu einer Frage der Ehre machen (S. 462). Soweit hört sich das alles ganz nett an. Aber diese Verharmlosung verbirgt nur die Radikalität der Autoren dieses Buches.
Das Problem sei, so die Autoren, dass die klassische Gleichberechtigung angeblich nicht zu dem erwünschten Ziel geführt habe, nämlich zur Beendigung von Benachteiligungen (S. 440). Dieser Zustand der echten Gleichberechtigung sei erst dann erreicht, so meinen die Autoren, wenn jede gesellschaftliche Gruppe auf allen Ebenen gemäß ihrem Anteil an der Bevölkerung vertreten sei. Wo dies nicht der Fall ist, wird dies als ein Zeichen von Diskriminierung gewertet. Und deshalb fühlen sie sich dazu berechtigt, positive Diskriminierung durchzuführen. Männer, Weiße usw. müssten gezielt benachteiligt werden, bis zu dem Tag, an dem Frauen und Schwarze usw. überall gleich repräsentiert sind.
Damit begehen die Autoren aber eine lange Reihe von schwerwiegenden Denkfehlern. Erstens ist der Grund, warum Frauen, Schwarze usw. nicht überall gleich repräsentiert sind, nicht unbedingt eine historische oder heutige Benachteiligung. Sondern es führen natürlich auch individuelle, freie Entscheidungen und Präferenzen zu diesen Unterschieden. Es ist wissenschaftlich bewiesen, dass die Präferenzen von Frauen und Männern nicht identisch sind. Deshalb ist es auch nur logisch, dass Männer und Frauen nicht überall paritätisch vertreten sind. – Der zweite Denkfehler besteht darin, zu glauben, man dürfe zum Ausgleich für Unrecht selbst Unrecht anwenden. Das ist natürlich verboten! Es handelt sich um einen derart elementaren Verstoß gegen die Grundlagen jeder vernünftigen Moral, dass gar nicht absehbar ist, zu was für moralischen Monstrositäten die Autoren sonst noch bereit wären, um ihre Ziele durchzusetzen. Die Autoren führen hier einen direkten Angriff gegen das Wahre, das Schöne und das Gute. Erlaubt wäre höchstens die Förderung von mutmaßlich historisch benachteiligten Gruppen, etwa durch Schulungen oder dergleichen, aber keinesfalls die Diskriminierung von Unschuldigen. – Ein dritter Denkfehler besteht definitiv im utopischen Denken: Die Idee, wirklich alle (!) Benachteiligungen aus der Welt schaffen zu wollen, ist grotesk. Es gibt nämlich unendlich viele davon, und die meisten davon sind sehr unterschwellig und sehr individuell. Man spricht nicht umsonst von „Mikroaggressionen“. Wie kann ein gebildeter Mensch auf die Idee kommen, die Welt von den vielen kleinen Beschwernissen, die uns allen begegnen, frei machen zu wollen? Das geht doch gar nicht! Es wäre vielleicht nicht einmal wünschenswert, denn wer will schon ein Leben in Watte eingepackt führen? Die richtige Strategie wäre eine ganz andere: Resilienz aufzubauen und mit Mikroaggressionen leben zu lernen.
Die Autoren verschweigen komplett das woke Stichwort „Equity“, das als Gegensatz-Wort zu „equality“ zu verstehen ist: Das Ziel ist nicht etwa Chancengleichheit mit unterschiedlichem Ausgang, sondern das Ziel ist, dass am Ende alle Menschen gleich gut in der Gesellschaft abschneiden. Wo immer sich Unterschiede im Lebenserfolg von Menschen zeigen, wird die Ursache in Benachteiligungen gesehen, die es auszugleichen gelte. Das ist eine fürchterliche Ideologie! Denn die Unterschiede im Lebenserfolg kommen nicht nur durch mutmaßliche Benachteiligungen zustande, sondern auch durch unterschiedlichen Fleiß und unterschiedliche Begabung und unterschiedliche Präferenzen. Die Vorstellung, die verschiedenen Lebenserfolge der Menschen mit dem Rasenmäher zu einer großen Gleichheit zu vereinheitlichen, ist grotesk. Die Autoren dieses Buches unterschlagen völlig, dass Freiheit und Gleichheit in einem Spannungsverhältnis zueinander stehen. Deshalb haben sich die westlichen Gesellschaften darauf geeinigt, eine gewisse Balance zwischen beiden zu wahren, auf keinen Fall aber eines von beidem einseitig zu bevorzugen. Das ist keine neue Erkenntnis. Jeder Schüler sollte von diesem Thema schon einmal im Politikunterricht gehört haben. Aber die Autoren dieses Buches ignorieren die Problematik völlig und setzen voll auf Gleichheit. Das ist radikal.
Die Autoren verharmlosen den Wokismus auch durch die Aussage, es ginge nicht darum, verschiedene Gruppen gegeneinander auszuspielen (S. 440). Doch genau darum geht es. Denn dieses Gegeneinanderausspielen beginnt exakt in dem Moment, wo man die Menschen nicht mehr unabhängig von ihren Unterschieden wahrnimmt, sondern die verschiedenen Gruppen in den Fokus setzt. Und das wollen die Autoren dieses Buches zweifelsohne. Sie beklagen z.B., dass es ein enormes Problem sei, dass Nichtakademiker in Politik und Medien unterrepräsentiert seien (S. 440). Doch nein, das ist es nicht. In Politik und Medien und auch überall sonst in der Gesellschaft sollten die fähigsten Leute an vorderster Stelle stehen, und das sind nun einmal in der Regel, wenn auch nicht immer, Akademiker. Deshalb ist es völlig in Ordnung, wenn sie überrepräsentiert sind. (Wobei man die vielen Studienabbrecher unter den links-grünen Politikern nicht als „Akademiker“ zählen sollte. Und das sind nicht wenige.)
Auch das Thema des umweltverträglichen Wirtschaftens wird vollkommen verharmlost dargestellt. Die Autoren unterschlagen das Stichwort „ESG“. ESG bedeutet, dass Unternehmen dazu gezwungen (!) werden, sich woken Regeln zu unterwerfen, Gendersprache einzuführen usw., weil sie sonst einfach keinen Kredit mehr von ihrer Bank bekommen. Die Autoren dieses Buches schreiben, es müsse zu „einer Frage der Ehre“ werden (S. 462), doch dass es in Wahrheit einfach eine Frage des Überlebens ist, wird verschwiegen.
Die Autoren führen Gendersprache exemplarisch in ihrem eigenen Buch vor. So arbeiten sie abwechselnd mit einem generischen Maskulinum oder generischen Femininum. Doch ein generisches Femininum gibt es nicht. Dazu ist unsere Sprachwahrnehmung nicht trainiert. Nur das generische Maskulinum ist bekannt und wird deshalb (weitgehend) nicht als Maskulinum wahrgenommen. Das ständige Wechseln zwischen beiden ist erst recht nicht intuitiv. Die Lektüre dieses Buches changiert auf diese Weise zwischen Qual und Farce. – Die Autoren bestehen darauf, dass diese sprachlichen „Kleinigkeiten“ (Sternchen, „Schokoküsse“, usw.) in der Sprache sehr wichtig seien und umgesetzt werden müssten (S. 442 f.), wegen der narrativen Manipulation der „erzählenden Affen“ natürlich. An einer Stelle kommt auch die woke Redewendung von einer „als Frau gelesenen Person“ vor (S. 61). – Dieselben Autoren, die in diesem Buch mit Sprache massiv manipulieren, unterstellen gleichzeitig den Rechtspopulisten, dass sie sich die Wirklichkeit mit ihrer Sprache untertan machen würden (S. 294). Merken die Autoren nicht, dass sie genau dasselbe tun?!
Schließlich steigen die Autoren dieses Buches in die tiefste Höhle des Wokismus hinab: Sie wollen die Geschlechter „fluide erzählen“ (S. 376) und unsere Kinder sexuell manipulieren und ihnen die Heteronormativität austreiben. Wörtlich heißt es: „Wie Studien und die pädagogische Praxis zeigen, sind Kinder offen und tolerant für alle Bedürfnisse und Orientierungen jenseits der heteronormativen Logik, die ihnen meist vorgesetzt wird, so dass man davon träumen kann, alle in diesem Kapitel beschriebenen Probleme könnten irgendwann der Vergangenheit angehören.“ (S. 377)
Kurz: Die Autoren dieses Buches wollen, dass es nicht mehr der Normalfall ist, dass sich Kinder als Mädchen und Jungen im klassischen Sinne begreifen und später Paare aus Mann und Frau bilden, wobei die Gesellschaft offen und tolerant dafür ist, wenn sich eine andere sexuelle Orientierung quasi von selbst einstellt. Nein. Toleranz und Offenheit sind den Autoren nicht genug. Sie wollen die Heteronormativität flächendeckend beenden. Und zwar durch aktive Manipulation der Kinder. Jedes Kind soll sein Geschlecht problematisieren und „fluide“ wahrnehmen. Kinder sollen sich in der Regel überhaupt nicht mehr klassisch als Junge oder Mädchen begreifen, denn eine solche Einseitigkeit und Eindeutigkeit ist für die Autoren dieses Buches der neue Ausnahmefall von der gender-fluiden Regel.
Weitere grobe Fehler
Wiederholt zitieren die Autoren fiktionale Werke als Belege. Das erscheint doch recht seltsam, denn die Beweiskraft von Fiktion ist nicht gerade sehr hoch. Einmal wird eine Romanfigur als Beleg angeführt, um zu zeigen, wie Rassisten früher angeblich dachten (S. 322). Ein andermal wird der Spielfilm „Wallstreet“ mit Gordon Gekko angeführt, um zu belegen, dass es in der Wirtschaft nur um Gier ginge (S. 418).
Die Autoren führen das berühmt-berüchtigte Werk „Glaubten die Griechen an ihre Mythen?“ von Paul Veyne an. Sie meinen, das die Antwort auf die Frage im Titel dieses Buches „Jein“ lauten würde: „Grundsätzlich war ihnen sehr bewusst, dass es Zeus, Hera, Herakles und Psyche nicht im wörtlichen Sinne gab. Aber sie waren praktische Symbole, um sich über Werte und Normen auszutauschen.“ (S. 226) – Doch das ist falsch. Paul Veyne ist ein Klassiker der Postmoderne. Seiner Meinung nach glaubten die Griechen wirklich an ihre Mythen. Jeder und jede Zeit glaubte dies oder das, völlig losgelöst von der Wirklichkeit. Zudem glaubten ein und dieselben Menschen Dinge, die sich gegenseitig widersprachen. Aber sie glaubten sie. Zugleich benutzte Paul Veyne die griechischen Mythen, um zu demonstrieren, dass es angeblich keine Wahrheit gäbe. Ob Mythos oder Wissenschaft, das alles stünde auf demselben Niveau und über die Wahrheit könne man nichts sagen. Und der Bezug zur Wirklichkeit sei auch egal. – Die Autoren dieses Buches haben einen recht modernen Umgang mit Mythen in das Buch von Paul Veyne hineinprojiziert, das sie offenbar nie richtig gelesen haben. Insofern könnte man die Vermutung aufstellen, dass die Autoren postmoderne Thesen lediglich nachplappern, aber nie verstanden haben, was sie wirklich bedeuten.
Die Autoren glauben, dass das Königtum eine Erfindung der Bibel sei (S. 246 ff.). Doch das ist falsch. Das Königtum ist natürlich im Laufe der Zeit aus dem Patriarchat heraus entstanden. Aus dem Hordenführer wurde der Clan-Chef, darüber gab es den Chef mehrerer Clan-Chefs, usw. Das Königtum wurde nicht erfunden, es war schon immer da. Und es war auch immer schon mit religiösen Weihen verbunden. (Weiter oben sahen wir bereits, dass die Autoren die Monarchie als Erfindung der katholischen Kirche bezeichneten. Auch das ist falsch.)
Zum Judentum finden sich einige seltsame Thesen in diesem Buch. So wird z.B. die These aufgestellt, dass die Unterstellung von Blutrünstigkeit an die Adresse der Juden psychologisch darauf zurückzuführen sei, dass Christen beim Gedanken daran, das Blut Christi zu trinken, einen unbewussten Ekel empfunden hätten (S. 269). Denn angeblich wäre diese Lehre vom Blut Christi im Jahr 1215 neu gewesen. Doch das ist Unsinn. Sie war nicht neu, sondern wurde 1215 lediglich geklärt. Es wäre irritierend für die damaligen Christen gewesen, so meinen die Autoren, den Leib Christi „zu verdauen und wieder auszuscheiden“ (S. 269) Was für ein uninformiertes Reden über christliche Lehren und Kirchengeschichte, kann man da nur sagen!
Zugleich lassen die Autoren als mögliche Ursache für Judenhass völlig außer Acht, was bei Hannah Arendt gründlich analysiert wurde: Dass nämlich den Juden im Mittelalter das Gewerbe des Geldverleihs zugeschoben wurde, weshalb sie der übliche Hass traf, der Banker zu allen Zeiten trifft. Warum haben sie diese wichtige Erkenntnis weggelassen? Irritierend auch, dass die Autoren bis S. 272 von Judenhass sprechen, woran sich eine neue Kapitelüberschrift anschließt: „Vordringen zur tiefsten Höhle“. Nanu? Geht es denn noch tiefer als bis zum Judenhass?
Kleine Fehler
Es nervt, dass viele Aussagen in Fußnoten verpackt worden sind. Es wäre besser gewesen, diese in den Haupttext mit einzubinden. Zudem beginnt die Nummerierung der Fußnoten in jedem Kapitel wieder mit 1. Das erschwert das Nachschlagen der Fußnoten im Anhang erheblich.
Zu der statistischen Aussage des Hedonometers (S. 46) hätte gesagt werden müssen, dass das Hedonometer nicht die Gesamtbevölkerung abbildet, sondern nur die Twitter-Nutzer, die bekanntlich ein Paralleluniversum für sich sind. Oder war den Autoren nicht klar, dass Twitter nicht die Realität ist?
Die literarische Wendung „falsche Nonne“ wird als antiklerikal gedeutet (S. 58 Fußnote). Das ist falsch. Eine falsche Nonne ist einfach eine Nonne, die gegen Gelübde und Gebote unmoralisch handelt. Mithin eine Heuchlerin. Sie steht nicht stellvertretend für Kirche und Klerus. Im Gegenteil. Wo es „falsche“ Nonnen gibt, gibt es logischerweise auch „echte“ Nonnen, und die sind dann glaubwürdig.
Angeblich hätten die australischen Ureinwohner das Wunder vollbracht, eine historische Überlieferung über 37.000 Jahre auf rein mündlichem Weg zu bewahren (S. 74). Doch nein. Auch wenn die Behauptung tatsächlich von Wissenschaftlern stammt, es ist Unfug. Und jeder denkende Mensch kann das erkennen.
Die lateinische Übersetzung von „erzählender Affe“ ist nicht „pan narrans“, wie fälschlich behauptet wird (S. 81), sondern „simia narrans“. Ein „pan“ oder „satyrus“ ist ein Schimpanse, kein Affe im allgemeinen.
Angeblich lassen die Algorithmen sozialer Netzwerke ganz bewusst Teilnehmer verschiedener Blasen aufeinander treffen, um Provokationen zu erzeugen (S. 208). Das ist zwar möglich, aber man hat doch eher den Eindruck, dass die Trennung der Blasen das Problem ist, nicht deren Aufeinandertreffen.
Zwei Zitate von Heinrich Himmler aus dessen Posener Rede werden nicht korrekt wiedergegeben (S. 297, 311). Die Abweichungen vom Original sind zwar nicht sinnentstellend, aber dennoch falsch. Es ist irritierend, dass zwei belesene Autoren mit literarischem Anspruch Originalzitate fehlerhaft wiedergeben, und das nicht nur einmal.
Rechtsradikale, die angeben, dass sie durch das Ansehen von Youtube-Videos ihren „red pill“-Moment erlebten, geben als häufigstes Video angeblich eine sechsstündige, pseudowissenschaftliche Dokumentation über Adolf Hitler an (S. 305). Das ist wenig glaubwürdig. Denn so „überzeugend“ dieses Video auch sein mag, ein sechsstündiges Video schauen sich nur die allerwenigsten an. Die meisten werden schon davor solche Meinungen gehabt und nur deshalb dieses Video angesehen haben. Überhaupt ist der Nachrichtenwert dieser Information, dass Rechtsradikale durch rechtsradikales Material zu Rechtsradikalen wurden, eher gering.
Schließlich heißt es, dass die Russen an Bord des Sputnik den ersten Menschen ins All beförderten (S. 476). Doch das ist falsch. Der erste Mensch im All war Juri Gagarin an Bord der Wostok 1 mehrere Jahre später.
Bewertung: 1 von 5 Sternen.