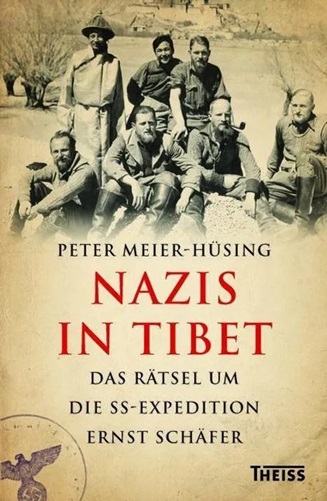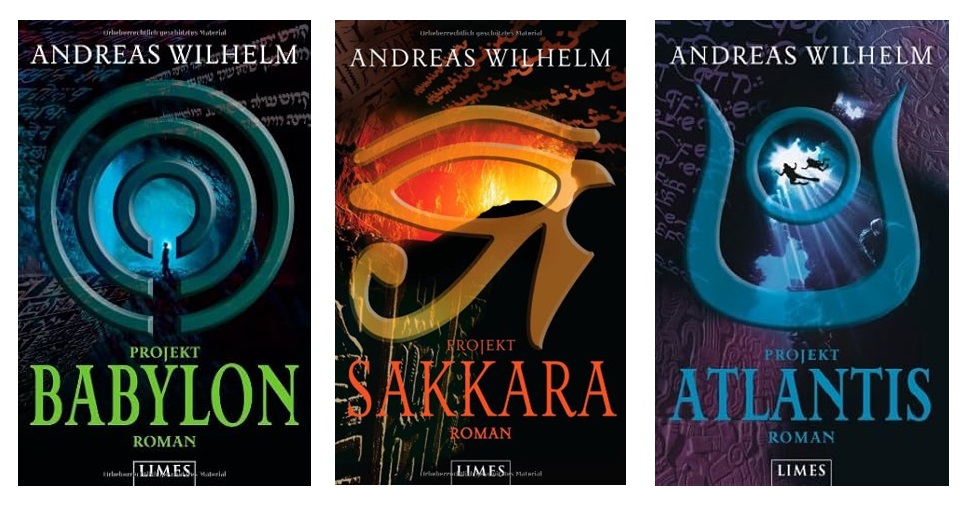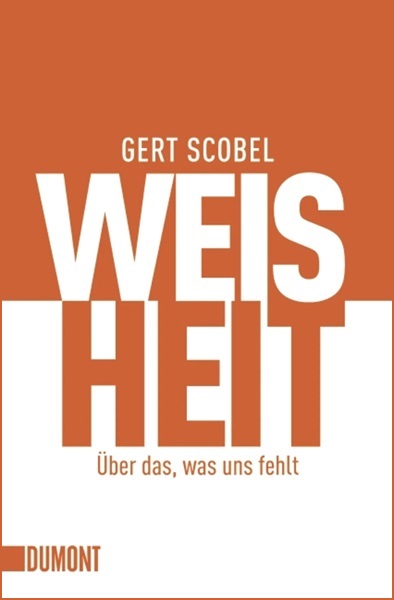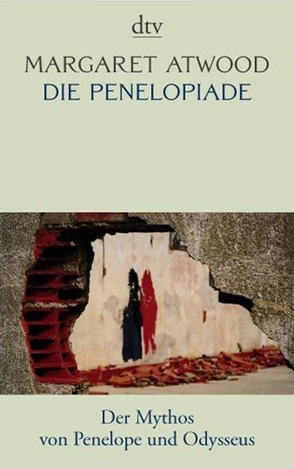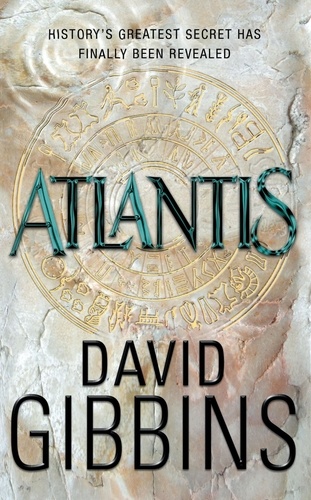
Archaeo-Fantasy um die Sintflut im Schwarzen Meer und Platons Atlantis
Der Roman „Atlantis“ von David Gibbins (2005) – deutsch: „Mission Atlantis“ – ist leider misslungen. Er funktioniert weder literarisch noch historisch noch archäologisch, wie im folgenden Punkt für Punkt gezeigt wird.
Story und Erzählweise
Als Thriller ist der Roman „Atlantis“ von David Gibbins eine Enttäuschung. Das klassische „treasure hunting“, das historischen Romanen oft ihren Thrill gibt, ist bereits nach dem ersten Drittel des Romans beendet, und auch die beiden Hauptpersonen haben zu diesem Zeitpunkt bereits intim zueinander gefunden. Es geht im darauf folgenden Hauptteil des Romans nur noch darum, den Ort von Atlantis aufzusuchen und dabei künstlich in die Story eingebrachte Schwierigkeiten zu überwinden. Eine weitere Entwicklung der Charaktere bleibt aus.
Zu diesen künstlichen Schwierigkeiten gehört vor allem ein eindimensional böse gezeichneter Raubgräber mit der finanziellen Macht und der militärischen Ausrüstung eines ganzen Staates, der zufällig immer an der passenden Stelle auf den Plan tritt. Zudem ist ebenfalls rein zufällig direkt vor dem Eingang von Atlantis ein sowjetisches Atom-U-Boot mit Nuklearsprengköpfen gesunken, um das sich seitdem niemand mehr kümmert. Die Protagonisten leiden im Verlauf der Handlung unter Blutverlust, immer knapper werdender Atemluft, Kerosinmangel oder schwächer werdenden Batterien, und doch erreichen sie immer wieder kurz vor dem Exitus das erwünschte Ziel.
Weitere unglaubwürdige Zufälligkeiten sind drei gleichzeitige archäologische Funde an drei verschiedenen Orten, die sich natürlich alle drei auf dieselbe Sache beziehen. Unglaubwürdig auch, dass es auf einer kleinen, einsamen Vulkaninsel im Schwarzen Meer einen offenen Zugang in die Unterwelt von Atlantis geben soll, der über viele tausend Jahre unentdeckt blieb. Der Vulkan wird dann natürlich punktgenau zum Ende des Buches ausbrechen, nachdem er viele tausend Jahre lang ruhig blieb.
Den ganzen Roman über quält der Autor seine Leser mit technischen Begriffen aus der Welt der Schiffahrt, des Tauchens und der Waffentechnik. Zahlreiche technische Abkürzungen verwirren. Vielleicht könnte man als Taucher und Waffennarr dem Roman etwas abgewinnen? Mehr als die Hälfte der Zeit befinden sich die Protagonisten unter Wasser und kämpfen mit der Technik, den Elementen und menschlichen Feinden.
Völlig unnötig sind die vielen archäologischen Sensationsfunde und Entdeckungen, die die Protagonisten im Vorfeld der Romanhandlung gemacht haben wollen, mit denen die unglaubliche Story zusätzlich gestützt werden soll:
- Ein Fund von verbrannten Schiffen der Griechen vor Troja.
- Die Entzifferung des minoischen Linear A.
- Der Fund eines zweiten Diskus von Phaistos.
- Die Entdeckung eines Archivs in der Athener Akropolis.
- u.v.a.m.
Zur Schwarzmeer-These im Allgemeinen
Ja, es ist zunächst richtig, dass das Schwarzmeerbecken einst besiedelt war. Ja, es ist richtig, dass das Wasser am Bosporus irgendwann durchbrach und das Schwarzmeerbecken flutete. Ja, es ist plausibel, dass die indogermanische Sprachfamilie von dort ihren Ursprung hat. Ja, es ist immerhin nicht unmöglich, dass in den Flutsagen des Gilgamesch und der darauf aufbauenden Bibel eine dunkle Erinnerung an dieses Ereignis enthalten ist. Ja, auf dem Grund des Schwarzen Meeres wird man noch manche steinzeitliche Siedlung finden, die das Bild der Steinzeit revolutionieren wird. Soweit so gut.
Es ist aber falsch, von diesem Ereignis eine direkte Verbindung zu späteren Hochkulturen wie z.B. Mesopotamien oder Ägypten zu ziehen; die Gründe dafür sind folgende:
- Die zeitliche Lücke zwischen dem Untergang der Schwarzmeerkultur und dem Aufstieg der späteren Hochkulturen umfasst mehrere tausend Jahre. Solange lässt sich keine detaillierte Überlieferung mündlich weitergeben und schon gar nicht geheimhalten. Mehr als dunkle und grobe Erinnerungen an ein Ereignis sind ohne Schrift nicht überlieferbar. Selbst mit Schrift wäre es schon schwierig genug.
- Die Schrift entwickelte sich in Ägypten und Mesopotamien eigenständig und unabhängig voneinander und bei Völkern, die nicht der indogermanischen Sprachgruppe angehörten. Wenn die Schwarzmeer-Kultur über eine Schrift verfügte, so war sie schon Jahrtausende zuvor verloren gegangen. Indogermanische Völker wie z.B. die Hethiter oder Griechen übernahmen die Schrift vielmehr aus dem Orient.
- Es ist offensichtlich, dass sich die späteren Hochkulturen eigenständig und angemessen langsam entwickelt haben, ohne einen Vorläufer, der ihnen einen Entwicklungsschub gegeben hätte.
- Die späteren Hochkulturen weisen keine Gemeinsamkeiten auf, die auf einen gemeinsamen Ursprung hindeuten würden; nur die indogermanischen Völker weisen natürlich gewisse Gemeinsamkeiten auf; Ägypten und Mesopotamien gehören aber z.B. nicht dazu.
Kurz und gut: Die These von der Überbrückung dieser zeitlichen Lücke hat keine Chance.
Die Schwarzmeer-These bei David Gibbins
Gibbins behauptet nicht nur eine Überbrückung der großen zeitlichen Lücke, sondern dehnt das Erbe der Schwarzmeerkultur auch auf spätere Hochkulturen aus, die a) definitiv nichts mit einem indogermanischen Ursprung zu tun haben, b) zeitlich in ihrem Auftreten sehr variieren, c) in ihrer kulturellen Entwicklung sehr stark auseinanderliegen. Gibbins nennt u.a. Ägypten, Mesopotamien, die Kelten, die Indus-Valley-Kultur, die Israeliten und auf den letzen Seiten sogar die amerikanischen Indianerkulturen. Die Minoer, die bei Gibbins im Zentrum stehen, treten in Wahrheit erst vergleichsweise spät in Erscheinung. Auch ist die Idee, dass die Priesterkaste der Schwarzmeerkultur sich über Jahrtausende die Weltherrschaft gesichert hätte und die kulturelle Entwicklung steuerte, nichts als eine Verschwörungstheorie, die für damals noch unhaltbarer ist als für die Gegenwart.
Das untergegangene Atlantis wird von Gibbins als eine ziemlich befremdliche Kombination von steinzeitlicher, minoischer und ägyptischer Kultur geschildert: Gebäudekomplexe wie in Catal Hüyük, eine Sphinx in Stiergestalt, gewaltige Stufenpyramiden usw. Es ist ein archäologisches Walt-Disney-Land in Form eines völlig anachronistischen Potpourris der bekannten Hochkulturen.
Atlantisforschung
Der Roman „Atlantis“ von David Gibbins bewegt sich leider auf dem Niveau der üblichen pseudo-wissenschaftlichen Thesen rund um das Atlantis des Platon: Am Ende sei Atlantis die uralte Wiege der Zivilisation, was es im Original bei Platon eben nicht ist. Der Leser bekommt keinen realistischen Einblick in die Fragestellungen und die wirklichen Möglichkeiten der wissenschaftlich fundierten Atlantisforschung. Wer Platons Atlantiserzählung gelesen hat, findet seine Vorstellungen von Platons Atlantis in dem „Atlantis“ des Romans von Gibbins nicht wieder.
Die Begegnung von griechischer und ägyptischer Kultur, die eine der Kernfragen der Atlantisforschung ist, wird ganz falsch dargestellt: In Ägypten wurde kein nennenswertes Wissen ausschließlich der mündlichen Überlieferung vorbehalten, die Priester hüteten auch keine Geheimnisse und erst Recht keine Kenntnisse, die weit vor 3000 v.Chr. hinausgereicht hätten. Es ist auch nicht wahr, dass die höheren Priester höhere Weisheiten gewusst hätten; eher im Gegenteil wussten Priester von niederen Graden oft mehr, weil sie spezialisiert waren. Auch logen die ägyptischen Priester griechische Besucher nicht einfach an; die Gründe für Falschinformationen greifen häufig viel tiefer und sind eher als ein Missverstehen zu deuten, wie man bei Herodot sehr gut studieren kann. Gerade von Herodot zeichnet Gibbins ein ziemlich simplifizierendes Bild, u.a. auch im wissenschaftlich gemeinten Nachwort.
Solons Aufenthalt in Ägypten wird leider völlig anders dargestellt als bei Platon. Wie Gibbins im Nachwort einräumt, geschah dies mit der Absicht, den Besuch des Solon in Sais mit dem Atlantis-Konzept des Romans in Einklang zu bringen. Es ist auch nicht wahr, wie Gibbins im Nachwort meint, dass der Name des Priesters, mit dem Solon sprach, mutmaßlich bekannt ist. Überliefert ist nur der Name Sonchis in der Solon-Biographie des Plutarch. Diese Angabe ist allerdings wenig glaubwürdig, gerade auch deshalb, weil der Priester, der von Atlantis weiß, bei Platon nicht als besonderer, „hoher“ Priester dargestellt wird. Platon wird von Gibbins freies Erfinden und grobes Anpassen historischer Stoffe unterstellt; kein vernünftiger Platonforscher würde das so unterschreiben. Die Frage, wie Platon seine Atlantiserzählung konstruierte, ist in der Tat eine der Kernfragen der Atlantisforschung, und kann nicht so beiläufig und einfach abgetan werden.
Fazit
Der Roman „Atlantis“ von David Gibbins ist literarisch und historisch eine Enttäuschung. Wenn der Roman auch literarisch nicht gelungen ist, so hätte man sich von einem Unterwasserarchäologen doch wenigstens in historischer Hinsicht mehr versprochen. Aber der Autor zerstört konsequent den Thrill, der sich aus der Möglichkeit entfalten würde, dass eine Geschichte wahr sein könnte, indem sie sich möglichst eng an die reale Welt und die reale Historie anlehnt. Die Versprechungen des Covers: „only this time, it really could be true“, oder die Behauptung im Nachwort: „the archaeological backdrop is as plausible as the story allows“ werden schlicht nicht eingehalten. Beim Roman „Atlantis“ von David Gibbins handelt es sich wohl eher um Archaeo-Fantasy mit Taucher-Thrill als um einen Historien-Thriller.
Alternative Buchempfehlungen
Wer sich auf wissenschaftliche Weise mit dem Atlantis des Platon beschäftigen möchte, dem seien folgende Bücher empfohlen (teilweise nur antiquarisch zu haben):
Contra Existenz:
- Heinz-Günther Nesselrath: Platon und die Erfindung von Atlantis.
- Pierre Vidal-Naquet: Atlantis – Geschichte eines Traumes.
Pro Existenz:
- John V. Luce in: E.S. Ramage: Atlantis – Mythos, Rätsel, Wirklichkeit?
- Thorwald C. Franke: Mit Herodot auf den Spuren von Atlantis – Könnte Atlantis doch ein realer Ort gewesen sein?
Bewertung: 1 von 5 Sternen.
(Erstveröffentlichung auf Amazon am 28. Juli 2012)