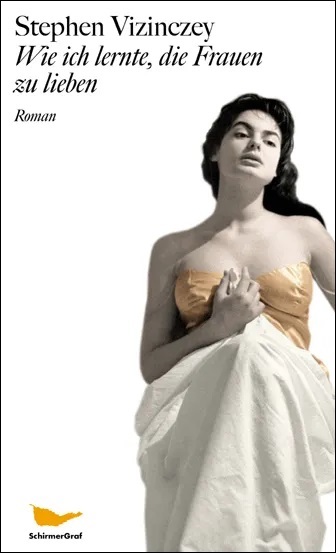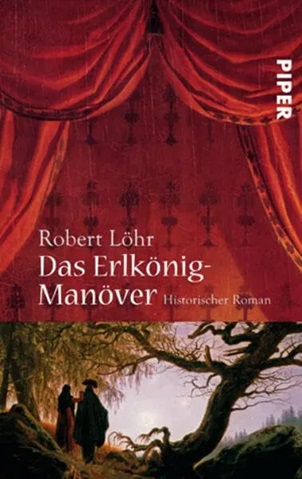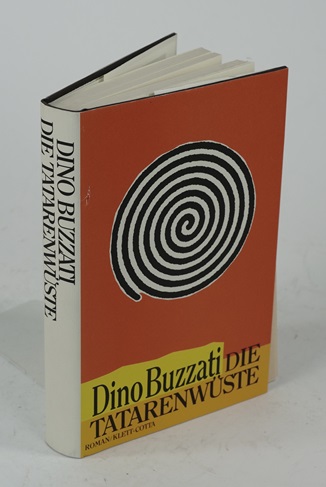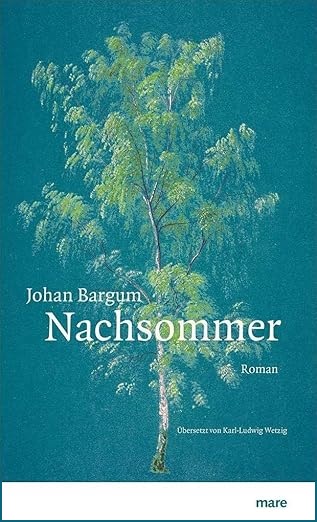Skurriler und phantastischer Klassiker der Romantik – Großartiger Kunstmythos
Die Geschichte beginnt grau in grau im Dresden der Gegenwart (1814), doch nach und nach schleichen sich skurrile und phantastische Elemente in die Geschichte ein, die fast schon psychedelischen Charakter haben. Die Übergänge sind fließend und der Text ist voller Symbole, Anspielungen und Rückbezüge, so dass die Lektüre den Leser in eine reichlich seltsame Welt versetzt, in der er sich erst zurechtfinden muss. Auch das Aufeinandertreffen von skurrilen und läppischen Aspekten mit phantastischen und erhabenen Momenten trägt zur einzigartigen Atmosphäre dieser Geschichte bei. Ebenso die Sprache, die zunächst umständlich altertümlich erscheint, dann aber als stilistisch durchgearbeitet erkennbar wird, bis man sich zum Ende hin daran gewöhnt hat und sich gar nicht mehr vorstellen kann, dass diese großartig-phantastische Erzählung in einer anderen Sprache hätte geschrieben werden können.
Die Handlung: Der Student Anselmus wird durch den Archivarius Lindhorst und durch die Liebe zu dessen Tochter Serpentina in die Wunderwelt der Poesie eingeführt, das hier als eigenständige Parallelwelt zur wirklichen Welt gestaltet ist. Ihnen gegenüber stehen die spießigen Philister, der Konrektor Paulmann mit seiner Tochter Viktoria, die unbedingt einen Hofrat heiraten möchte, sowie der Registrator Heerbrand. Es zeigt sich, dass der Archivarius Lindhorst einst aus dem Wunderreich der Poesie verbannt wurde, weil er den Funken des Gedankens in die Welt brachte, womit er die geliebte Lilie im Garten des Zauberreiches der Poesie verdarb, und erst zurückkehren kann, wenn er seine drei Töchter an poetisch gesinnte Jünglinge verheiratet haben wird. Jede Tochter bringt als Mitgift eine goldenen Topf mit in die Ehe, aus dem dann wieder eine Lilie erwächst. Derweilen trägt Lindhorst in dieser Welt einen Kampf mit dem sogenannten Äpfelweib aus, einer Hexe, die junge Leute vom Zugang ins Reich der Poesie abhalten möchte. Anselmus gerät zwischen die Fronten und muss sich entscheiden. Am Ende steht der Eingang und die endgültige Rückkehr ins Wunderreich der Poesie, wo alle Wesen im Einklang mit der Natur leben.
Ziel des Werkes ist es, die Wunderwelt der Poesie als einer Welt von eigenem Recht neben der schnöden Wirklichkeit darzustellen, die Abkehr von der einen und die Rückkehr zur anderen Welt zu propagieren, und die Spießer in ihrer Blindheit für das Schöne und Wahre kenntlich zu machen.
Der Text wird vom Autor selbst ein Märchen genannt, und die moderne Literaturwissenschaft spricht von einem Kunstmärchen. Doch ist diese Bezeichnung unzutreffend. Schließlich will der Text den Leser davon überzeugen, dass es tatsächlich eine dichterische Parallelwelt gibt, die ebenso Wirklichkeit für sich beanspruchen kann wie die Wirklichkeit der Philister. Dieser Anspruch bezieht sich natürlich selbstreflexiv auch auf den Text selbst, der das behauptet. Beweisbar ist das natürlich nicht, und die Wunderwelt wird reichlich mit dichterischer Phantasie ausgeschmückt. Aber das ist in diesem Fall kein Gegenargument, denn gerade das ist es ja, was die behauptete Parallelwelt ausmacht. Kurz: Hier liegt das Prinzip eines erdichteten „Platonischen Mythos“ vor, der mehr als eine bildhafte Allegorie ein tatsächlich Wahres darstellen will, aber nicht mit Argumenten und Belegen aufwartet, und die Wahrheit des Behaupteten letztlich offen lässt. Es ist also in Wahrheit kein Märchen, sondern ein Platonischer Kunstmythos.
Kritik
Zentrales Problem ist die scharfe Abgrenzung des Reiches der Poesie von dieser Welt. Die hohe Kunst wäre es gewesen, Wirklichkeit und Poesie zu einer Synthese zu bringen. Doch das Gegenteil geschieht. Damit verfehlt E.T.A. Hoffmann beides, die Poesie und die Wirklichkeit. Denn hier wird das Reich der Poesie zu einer weltfremden Zufluchtsstätte, in die sich der Poet flüchtet, statt sich der Realität zu stellen. Und zugleich wird der Realität jede Fähigkeit zur Poesie abgesprochen.
Das wird auch in der Darstellung der spießigen Philister deutlich. Ein Kennzeichen des Philistertums bei E.T.A. Hoffmann sind ihre Lateinkenntnisse, und dass sie Ciceros „De Officiis“ lesen. Damit wird aber die humanistische Bildung und die Philosophie verspottet. Doch ist es nicht gerade die humanistische Bildung und die Philosophie, auf deren Grundlage die Synthese von schnöder Realität und Poesie am ehesten gelingen kann? Die Verherrlichung des „kindlich poetischen“, „kindlich frommen“ Gemütes, verstanden als Gegensatz zur „sogenannten Weltbildung“ des „entarteten Menschengeschlechtes“ ist jedenfalls eine grob verfehlte Vorstellung von gelungener Menschenbildung. Beides zu synthethisieren, ohne dass das eine oder das andere zu kurz kommt, wäre die Kunst.
Ebenfalls kritikwürdig ist die Vorstellung von der höchsten Erkenntnis als dem „Innersten der Natur“, dem „tiefsten Geheimnis der Natur“, nämlich des „heiligen Einklangs aller Wesen“. Denn wieso gerade die Natur? Wenn es um den Einklang mit sich selbst gegangen wäre, was bereits ein hoher Anspruch ist, oder um den Einklang der Menschen untereinander, wäre das Anspruch genug, ohne gleich die ganze Natur einzubeziehen. Aber die Menschen werden zur Natur offenbar nicht dazugezählt. Ein Einklang mit der ganzen Natur ist also recht hoch gezielt. Zugleich ist Natur aber wieder zu wenig. Denn dieser pantheistische Einklang aller Wesen schreit geradezu nach einer Antwort auf die Frage nach einem gemeinsamen geistigen Bande, letztlich nach Gott. Aber zu solchen Fragestellungen dringt der Text nicht vor. Die Erkenntnis vom Einklang mit der Natur ist gewissermaßen eine seltsam blinde Erkenntnis, die sich mit diesem gefühlten Einklang begnügt, und dann nicht weiterdenkt und weiterfragt.
Hier wie bereits oben wird deutlich, dass die Rationalität dem spießigen Philistertum zugeordnet wird, während der Dichter sich in die reine Gefühligkeit flüchtet. Philosophie wird verspottet (Cicero) und das Wesen der Natur verabsolutiert und nicht hinterfragt. Der Funke des Gedankens gilt als verderblich, Vernunft und Gefühl sind hier Gegensätze. Schließlich wird vor allem auch die Welt der Menschen als Gegensatz zur Natur begriffen, obwohl die Menschen zweifelsohne Teil derselben sind. Damit haben wir so ziemlich alle Irrtümer beisammen, an denen die Romantik krankt.
Der humanistisch gebildete Klassiker Goethe kritisierte E.T.A. Hoffmann scharf, der gefährlich romantische Traumtänzer Karl Marx hingegen liebte ihn.
Fazit
Es ist trotzdem ein großartiges Werk, das mit seiner Phantastik und seiner Skurrilität einen ganz eigenen Charme entfaltet, und das insofern seine Berechtigung teilweise behält, als die Menschen leider tatsächlich überwiegend allein der „sogenannten Weltbildung“ zuneigen und tatsächlich ein „entartetes Menschengeschlecht“ sind, vor dem man sich nur allzu oft und allzu gerne in das Refugium des Geistes flüchtet. Auch wenn die Zuordnung von Vernunft und Gefühl zu diesen beiden Welten anders ist bzw. sein sollte, als dargestellt, und Flucht letztlich keine Lösung ist. Und was die poetischen, schwärmerischen, gefühligen Aspekte eines erhabenen geistigen Lebens anbelangt, so erinnert einen dieses Werk wohltuend an diese vernachlässigte Seite unseres Daseins. Man sollte allerdings nicht bei diesen Einseitigkeiten stehen bleiben.
Atlantis
Die phantastische Wunderwelt der Poesie wird von E.T.A. Hoffmann kurzerhand Atlantis genannt. Das verwundert, denn mit Platons Atlantis hat Hoffmanns phantastische Wunderwelt der Poesie rein gar nichts zu tun. Platons Atlantis spielt eine radikal andere Rolle als E.T.A. Hoffmanns Atlantis. Hier gibt es keinen tragfähigen Vergleichspunkt. Zudem dürfte Platon über die allzu freie Phantasie in Hoffmanns Zauberreich wenig erbaut gewesen sein, denn Platon wollte eine an die Rationalität gebundene Dichtung. Aber das nur am Rande.
Der Name Atlantis wird hier als bloße Chiffre für ein dichterisches Sehnsuchtsland benutzt, und das, obwohl zu Beginn des 19. Jahrhunderts Atlantis noch keineswegs gemeinhin als eine Erfindung galt. Es gab damals immer noch zahlreiche Wissenschaftler, die verschiedene Existenzhypothesen vertraten. Erst im Verlauf des 19. Jahrhunderts kippte die Meinung unter dem Eindruck neuer wissenschaftlicher Erkenntnisse gegen die Existenz von Platons Atlantis.
Es wäre interessant nachzuvollziehen, wie E.T.A. Hoffmann dazu kam, den Namen Atlantis als eine Chiffre für ein Wunderland der Poesie zu benutzen, das als Parallelwelt gedacht ist. Wären andere Namen nicht näher gelegen, insbesondere z.B. Arkadien oder das Goldene Zeitalter? – Bekannt ist, dass E.T.A. Hoffmann durch die „Ansichten von der Nachtseite der Naturwissenschaft“ des romantischen Naturforschers Gotthilf Heinrich Schubert von 1808 beeinflusst war. Dort ist Atlantis im Sinne neuerer französischer Theorien ein Ort im hohen Norden, wo die Menschheit noch im Einklang mit der Natur gelebt haben soll. Allerdings ist das immer noch ein realer Ort. Schubert entnahm seine Thesen offenbar der 1781 von Michael Hißmann übersetzten „Neuen Welt- und Menschengeschichte“ von Delisle de Sales, wie sich an der Wortwahl zeigen lässt. – Eine weitere Möglichkeit wäre, dass E.T.A. Hoffmann Atlantis mit dem Adjektiv „verloren“ in Verbindung brachte, das auch damals vielfach durch die Literatur über Atlantis geisterte. Und bei Hoffmanns Reich der Poesie handelt es sich in der Tat um ein „verlorenes“ Reich, das es wiederzufinden gilt. – Eine sehr interessante Möglichkeit wäre eine direkte Reaktion auf den Göttinger Materialisten und Empiristen Michael Hißmann. Michael Hißmann hatte 1781 in seiner Übersetzung der „Neuen Welt- und Menschengeschichte“ eine sehr gehässige Darstellung von Platons Atlantis als einer bloßen Erfindung eingefügt, in der auffällig viele Worte Verwendung finden, die wir im „Goldenen Topf“ von E.T.A. Hoffmann so oder so ähnlich wieder antreffen, z.B. Atlantis als „Wunderwelt“ oder „Feenwelt“. Indem er orientalisch inspirierte Träumereien und Erdichtungen als „lächerlich und abgeschmackt“ verurteilte, handelte Hißmann gerade so wie die spießigen Philister in E.T.A. Hoffmanns „Goldenem Topf“, für die Poesie als „orientalischer Schwulst“ gilt. Und „die Träumereien über Platons Traum“ seien „weit erbärmlicher und unterträglicher“ als die Fabel selbst, meinte Hißmann. Hißmann entwarf zudem eine Theorie der schönen Künste und der Poesie, die sich ganz auf materialistische Antriebe stützte, und jede Schwärmerei verurteilte. Es scheint, als habe E.T.A. Hoffmann den „Goldenen Topf“ auch als eine Antwort auf diese Anschläge Hißmanns auf die dichterische Phantasie verfasst, denn er gestaltete sein poetisches Reich Atlantis präzise so, dass es jede Verurteilung und jeden Vorwurf von Hißmann aufgriff. Damit hätte das spießige Extremurteil des geistlosen Materialisten Hißmann die Überreaktion des dichterischen Phantasten Hoffmann provoziert. – Diese Thesen wären allerdings noch im Einzelnen nachzuweisen.
Jedenfalls hat E.T.A. Hoffmann durch die Wahl des Namens Atlantis für sein Wunderland der Poesie mit dazu beigetragen, Platons Atlantis in der allgemeinen Wahrnehmung den Ruf einer phantastischen und rein dichterisch zu verstehenden Welt zuzuschreiben. Das ist bedauerlich. So verwendete noch 1939 Hermann Rauschning in seinem Werk „Gespräche mit Hitler“ den Namen Atlantis in unmissverständlicher Anspielung an E.T.A. Hoffmann als Chiffre für alle möglichen Phantastereien. Manche haben Rauschnings Worte als Beleg dafür verstanden, dass die Nationalsozialisten an die Existenz von Atlantis glaubten – eine Deutung, die falscher nicht sein könnte.
Der goldene Topf
Der Titel des Werkes ist ein Missgriff. Der goldene Topf ist in diesem Kunstmythos nur eine phantastische Requisite neben anderen, seine Symbolik überflüssig oder mindestens nebensächlich. Die Geschichte hätte auch ganz ohne goldenen Topf funktioniert. Es ist nicht recht verständlich, warum der goldene Topf also den Titel der Erzählung ausmacht. „Das Wunderland Atlantis“ wäre ein sehr viel zutreffenderer Titel gewesen, oder auch „Wiederfindung des verlorenen Wunderlandes Atlantis“.
Bewertung: 4 von 5 Sternen.
(Erstveröffentlichung auf Amazon am 01. August 2020)