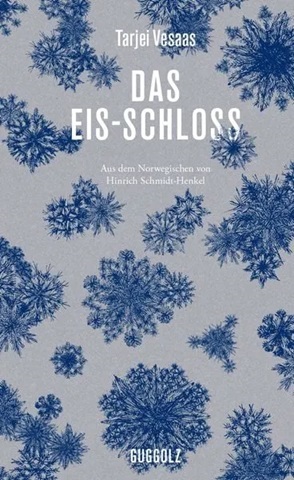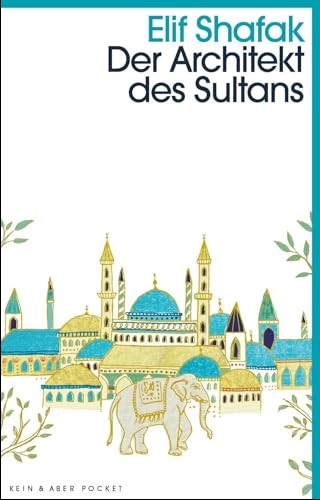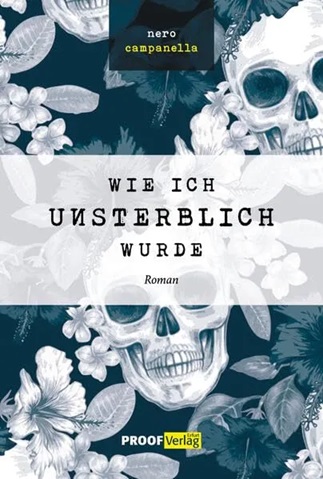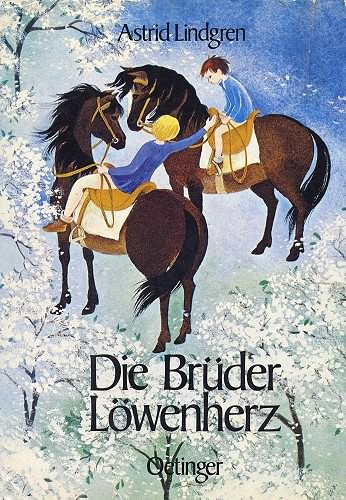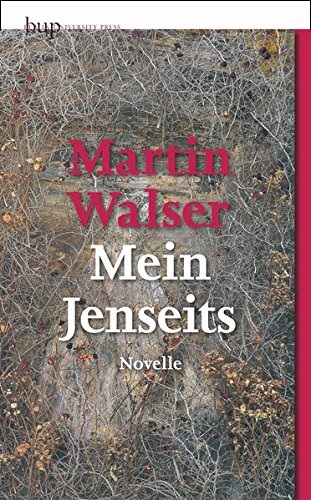Kein Jenseits, kein Glaube, sondern nur die üblichen inneren Kämpfe
Die Handlung des Büchleins ist kurz erzählt. Es geht um Augustin Feinlein, der einst verliebt und verlobt war mit Eva Maria. Doch dann wurde ihm die Freundin von einem Bekannten (Wagner-Fan, NS-Familie mit Schloss) im Handstreich ausgespannt und vor der Nase weggeheiratet. Eva Maria schreibt ihm dann noch Postkarten: „in Liebe“. Später dann, als Feinlein Direktor des Psychiatrischen Landeskrankenhauses Scherblingen war, heiratete Eva Maria zum zweiten Mal, aber wieder nicht ihn, sondern ausgerechnet Dr. Bruderhofer, einen Arzt am selben Krankenhaus, der Augustin Feinlein als Direktor beerben möchte und Schritt für Schritt gegen ihn arbeitet. So macht sich Dr. Bruderhofer lustig über die Reliquienforschung von Feinlein. Als Maßnahme gegen Dr. Bruderhofer (verwirrt im inneren Kampf) stiehlt Feinlein eine Reliquie, wird überführt, und überlässt Dr. Bruderhofer, entlarvt als verwirrter alter Mann, schließlich seinen Posten: Die Niederlage ist komplett.
Wie bei Martin Walser üblich geht es um die inneren Kämpfe, die der Protagonist gegen einen Kontrahenten führt, dem er hoffnungslos unterlegen ist. Der Kampf findet kaum auf der Handlungsebene statt, sondern vor allem im Inneren des Protagonisten, dem man beim Denken zusieht: Wie er sich ausmalt, was er alles gegen seinen Kontrahenten tun könnte, wie er sich seinem Kontrahenten gegenüberstellen könnte. Aber es bleibt fast alles Phantasie. Und es geht um die innere Einstellung zum aussichtslosen Kampf, um die Interpretation einer Niederlage als insgeheimem Sieg, um das Schönreden von Verlust als bereichernder Entsagung. Am Ende bleibt dennoch die Erkenntnis, dass man sich was vormacht. Auf der praktischen Ebene bleibt nur eine hilflose, symbolische Handlung übrig, mit der sich der Protagonist vollends lächerlich macht.
Im Hintergrund dieses Büchleins schwelt die Ur-Niederlage, dass Feinlein für Eva Maria nicht als Mann infrage kommt. Dass er tun und sein kann, was er will, und dennoch nicht infrage kommt. Andere hingegen schon. Schließlich stürzt er sich in den selbstbetrügerischen Glauben an die Wahrheit von Eva Marias Postkarten-Floskel: „in Liebe“. Dieses Thema wird ständig mit den anderen Konflikten und Themen verschränkt. Aber auch solches kennen wir aus anderen Werken.
Ganz neu ist in diesem Buch vielleicht der Aspekt des Glaubens. Der Glaube als Helfer in der Not, in der Not der Ausweglosigkeit und der hoffnungslosen Niederlage. So wird der Glaube für die Vorfahren beschrieben, so nimmt der Protagonist auch den Glauben für sich in Anspruch. So wird auch der Glaube an die Reliquien verhandelt: Es gehe nicht darum, dass die Reliquie echt sei, sondern dass der Glaube echt sei. So findet z.B. auch der alljährliche Blutritt statt, obwohl die Reliquie gestohlen ist – niemand merkt es, die Kirche nimmt einfach eine ähnlich aussehende Monstranz. Glaube heiße, sich die Welt so schön zu machen, wie sie nicht ist. Hier dichtet Walser sogar einen eigenen Psalm der selbstbetrügerischen Hoffnung (S. 113 f.). Aber am Ende wird man durch das „Unerklärliche“ doch völlig zurückgewiesen und alleingelassen. Das Unerklärliche: Gemeint ist nicht Gott, sondern dass er, Feinlein, für Eva Maria nicht infrage kam. Damit war sein Leben aus den Angeln gehoben und seine Existenz gescheitert. Unerklärlich. Endgültig. Kafkaesk. „Ich ging immer an einer Wand entlang, die würde aufhören, dann begänne das Leben, die volle Berührung. Das war ein Irrtum. Die Wand war das Leben.“
Es handelt sich natürlich um eine völlig unterbelichtete Sichtweise auf den Glauben. Am Anfang denkt man noch, es gehe darum, dem Unerklärlichen vorsichtig nachzuspüren, dem Glauben einen gewissen Raum zu geben. Auch um nostalgischen Katholizismus scheint es anfangs zu gehen, der in katholischen Symbolen, Ritualen und Kirchenräumen Kontakt zu einem wie auch immer gearteten „Jenseits“ bekommt. In Rom geht Feinlein immer in die Augustinus-Kirche und betrachtet dort ein Madonnenbild von Caravaggio. In Scherblingen sitzt er gerne in der Kirche und genießt die Atmosphäre. Doch im Laufe der Geschichte wird klar, dass es überhaupt nicht um Glaube und Jenseits geht, sondern um eine schnöde Indienstnahme des Glaubens als irrationale Ausflucht und gewissermaßen „Opium des Volkes“ vor der schrecklichen Welt. Mehr nicht. Der selbstbetrügerische Glaube an das Gute im Täter und in dem, was einem angetan wurde, wird hier zur höchsten Form der Niederlage. Dass es tatsächlich metaphysische Wahrheiten geben könnte, darum geht es in diesem Büchlein keine Sekunde lang. Im Gegenteil, es ist sogar regelrecht ausgeschlossen, denn nur dann ist die Ausweglosigkeit, in der sich Walser hier suhlt, wirklich völlig ausweglos.
Fazit:
Was die Kämpfe und Niederlagen anbelangt, ist es ein echter Walser, und man kann alles wie immer mit der eigenen Lebenserfahrung abgleichen, manches wiedererkennen, und so sein eigenes Scheitern besser verstehen und tragen. Was das Glaubensthema anbelangt, ist es unter Niveau und enttäuschend. Immerhin nimmt sich Walser auch ein klein wenig selbst auf die Schippe: Seine subtilen inneren Kämpfe und Befindlichkeiten wiesen ihn als „Luxustyp“ aus. Und am Anfang wird beschrieben, wie man im Dorf mit jemand umgeht, der „komisch“ wird. Das war’s dann aber auch. Kein wirklich gutes Buch. – Es soll sich übrigens um einen „ausgelagertes“ Kapitel des Romans „Muttersohn“ handeln, ein Versuchsballon, ob die Leser ein „Glaubensbuch“ von Walser akzeptieren würden. Nun, es ist ja gar kein Glaubensbuch. Es tut nur so.
Bewertung: 3 von 5 Punkten.
(Erstveröffentlichung auf Amazon am 2. Oktober 2020)