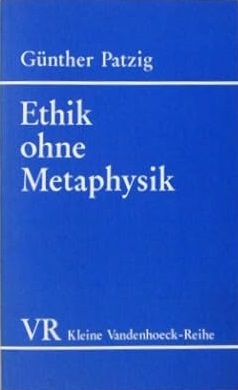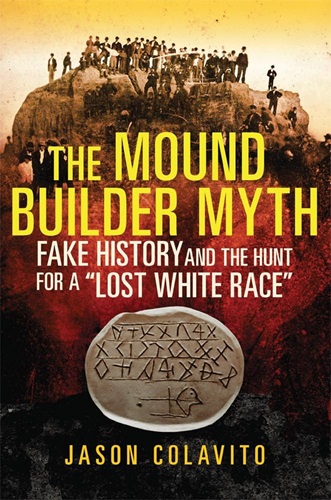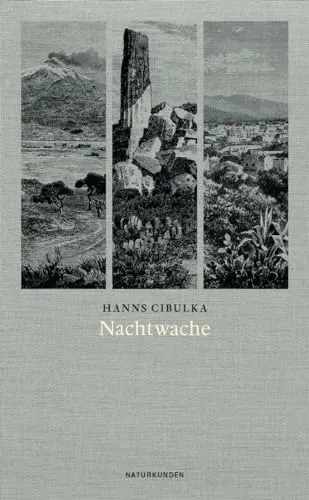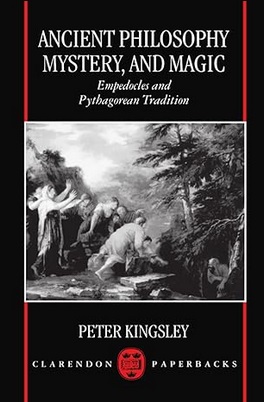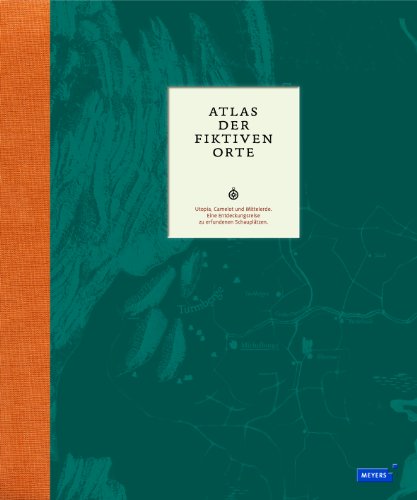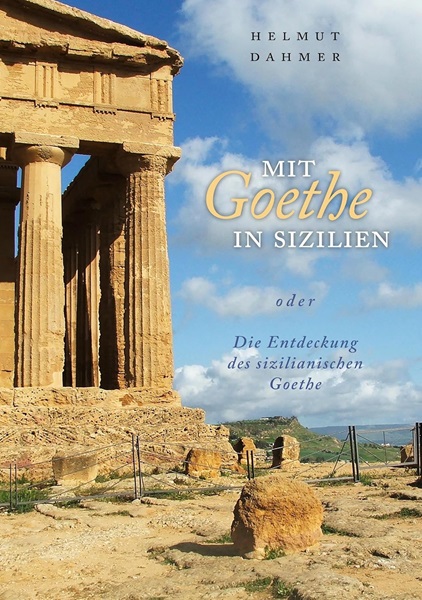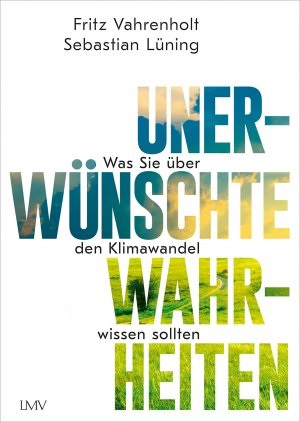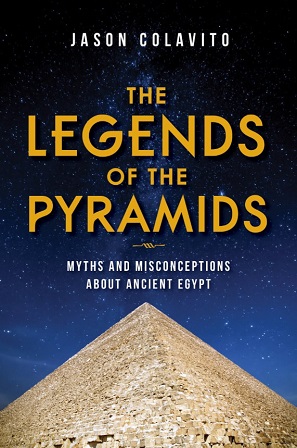
Hochinteressantes Thema, viel Stoff, aber leider unübersichtlich und fehlerhaft
Mit seinem Buch „The Legends of the Pyramids“ hat Jason Colavito ein weiteres Werk vorgelegt, in dem er einen Strang von Themen, Mythen und Legenden, wie sie heute in Pseudowissenschaft und Popkultur zu finden sind, auf ihre Ursprünge untersucht und auf diese Weise verbreitete Irrtümer und Pseudowissenschaft entlarvt. Das ausgewählte Thema ist dabei hochspannend: Einmal deshalb, weil es den Kern vieler pseudowissenschaftlicher Vorstellungen zur antiken Geschichte berührt. Und dann deshalb, weil bislang ein Mangel an Literatur zu diesem Thema herrschte, so dass hier vieles im Dunkeln lag.
Wir erfahren also, wie sich langsam, Schritt für Schritt, die falschen Vorstellungen rund um das alte Ägypten gebildet haben, von den alten Griechen über die Anfänge der Alchemie, von den Versuchen von Juden, Christen und Muslimen, das alte Ägypten für ihre Weltsicht zu vereinnahmen, von den Irrungen und Wirrungen in Renaissance und Aufklärung bis hin zur modernen Pseudowissenschaft und Popkultur.
Dazu wird wirklich sehr viel Stoff geboten in diesem Buch. Und es werden sehr viele Zusammenhänge aufgezeigt. Diese Zusammenhänge alle recherchiert und aufgefunden zu haben war gewiss eine langjährige Arbeit, und es ist der eigentliche Wert dieses Buches.
Doch leider ist das Buch unübersichtlich und teilweise fehlerhaft.
Unübersichtlich
Der Versuch, die komplexen Verwicklungen und Zusammenhänge in einem lockeren Erzählstil abzuhandeln, ist hier noch viel deutlicher gescheitert als in den vorigen Büchern von Jason Colavito. Die Zahl der Autoren und Werke, aus denen sich im Laufe der Zeit das Gespinst von Irrtümern zusammenwebt, ist sehr groß. Es wäre diesmal noch sehr viel dringender gewesen, diese Autoren und Texte in Tabellen zusammenzustellen. Auch Flussdiagramme, die aufzeigen, wer wen beeinflusst hat, wären sehr hilfreich gewesen. Doch der Leser wird mit einer endlosen Flut an immer neuen Autoren und Werken, die in jedem Kapitel neu auf ihn einprasseln, ziemlich allein gelassen.
Besonders ärgerlich ist die missglückte Einteilung des Stoffs in Überschriften. Die Überschriften sind auf den Effekt getrimmt, Neugier und Interesse zu wecken, und geben deshalb oft keine klare Auskunft über den behandelten Inhalt des jeweiligen Kapitels oder Unterkapitels und deren Zusammenhänge. Das erschwert die Orientierung im Buch sehr. Zudem tauchen die Unterkapitel nicht im Inhaltsverzeichnis auf, so dass das Inhaltsverzeichnis keinerlei Überblick bietet. Sehr ärgerlich ist auch, dass der behandelte Stoff recht willkürlich in Unterkapitel eingeteilt wurde: Teilweise findet sich der Stoff, der durch eine Unterkapitelüberschrift angekündigt wird, über mehrere folgende Unterkapitel verteilt. Teilweise wird in einem Unterkapitel noch ein weiterer Autor behandelt, dem damit keine eigene Überschrift gewidmet ist, so dass er bei der Durchsicht der Überschriften nicht sichtbar ist. Teilweise wird ein Thema zunächst in einem Unterkapitel abgehandelt, um daraufhin in einem eigenen Hauptkapitel behandelt zu werden.
Sehr ärgerlich ist auch, dass der Autor bei der Behandlung des Stoffes manchmal der Chronologie der Ereignisse folgt und zeigt, wer etwas zuerst geschrieben hat, wer es danach aufgriff, usw., manchmal jedoch auch der umgekehrten Reihenfolge den Vorzug gibt und zeigt, von welchem früheren Autor etwas übernommen wurde, und von wem dieser es wiederum übernommen hatte, usw. Das ständige Vor und Zurück verwirrt sehr. Der Überblick wird auch dadurch erschwert, dass der Autor spätere Entwicklungen, oft ankündigt und diesen vorgreift: Der Leser ist auf diese Weise dann geistig immer schon sehr viel weiter in der Zukunft und wird dann im nächsten Abschnitt wieder in eine Vergangenheit zurückgeholt, die mit den Ankündigungen nichts zu tun hat, denn das, was angekündigt wurde, kommt erst viele Kapitel später. Ebenfalls ungünstig ist, dass spätere Kapitel ein Thema groß aufbauen, dessen Vorbereitung man in einem viel früheren Kapitel fast überlesen hätte, weil es dort nur sehr klein abgehandelt wurde, ohne auf dessen Bedeutung aufmerksam zu machen.
Sehr, sehr ärgerlich ist, dass dieses Buch kein Literaturverzeichis und keine Fußnoten mit Verweisen auf die genauen Stellen in den entsprechenden Werken enthält. Die Namen von Werken werden nur im Text genannt, wenn überhaupt, und ganz selten findet sich eine genaue Seitenangabe. Damit hat dieses Werk leider sehr viel an Belegbarkeit und Nachvollziehbarkeit verloren. Für ein Werk, das sich die Aufgabe gestellt hat, Pseudowissenschaft zu entlarven, ist das ein dramatisches Versagen. Es ist zu vermuten, dass das Fehlen von Literatur und Fußnoten ebenfalls der Idee geschuldet ist, ein „schön zu lesendes“ Buch zu schaffen. Das war aber genau die falsche Idee. Dem näher interessierten Leser werden nicht einmal 2-3 wissenschaftliche Werke zur Vertiefung des Themas empfohlen, wie es sonst bei populärwissenschaftlichen Werken üblich ist. Das ist sehr schade.
Ebenfalls ungenügend ist es, dass Jason Colavito wiederholt von Bildern und deren Details spricht, ohne diese abzudrucken. Dieses Buch enthält einige sehr allgemein gehaltene Bilder in Farbe, so dass es sicher kein Problem gewesen wäre, die besprochenen Bilder ins Buch aufzunehmen. So z.B. die Darstellung der Arche Noah als Pyramide am Tor des Baptisteriums von Florenz oder die Darstellung der Pyramiden als Kornspeicher im Dom von Venedig. So muss der Leser sich auch hier selbst bemühen und im Internet nachschlagen.
Alles in allem hat Jason Colavito mit diesem Buch eine sehr umfangreiche Stoffsammlung geschaffen, doch die Aufbereitung des Stoffes für den Leser ist ihm nur schlecht gelungen. Diese Aufbereitung muss der Leser zum großen Teil selbst leisten. Dasselbe gilt für die Literatur- und Quellenarbeit. Das hätte man sehr viel besser machen können.
Fehlerhaft
Wir gehen die Fehler der Reihe nach durch. Alles zum Thema Atlantis behandeln wir in einem Extra-Abschnitt.
Obwohl zunächst richtig gezeigt wird, dass mancher Fehler und manche Geschichte bei Herodot eine historisch-kritische Erklärung hat, so dass Herodot nicht als Erfinder von Märchen abgetan werden kann, wird Herodot schließlich genau als das dargestellt („The Greek historian had many stories to tell …“; „Herodotus’s mixture of fact and fiction“; S. 13 f.). Das ist so nicht richtig. Es ist damit natürlich auch falsch, dass spätere griechische Autoren nach dem angeblichen Vorbild von Herodot Fakten und Fiktion leichtfertig vermischt hätten. Es ist auch falsch, dass Herodot mit jenen Griechen nach Ägypten kam, die die Ägypter gegen die Perser unterstützen wollten (S. 10). In Wahrheit kam Herodot erst nach Ägypten, als die Perser bereits gesiegt hatten.
Es ist falsch, lapidar zu behaupten, dass Aigyptos „burned face“ bedeuten würde (S. 16). Es gibt diese Theorie zwar, doch es handelt sich nicht um die vorherrschende Theorie. Zumal es Übereinstimmung darin gibt, dass der Name der Aithiopen auf ihre „burned faces“ zurückgeht. Es ist kaum anzunehmen, dass auch die Ägypter ihren Namen wegen ihrer Hautfarbe bekamen.
Die „Excerpta Barbari Latina“ sind keine „Excerpts in Bad Latin“ (S. 65), sondern „Lateinische Exzerpte eines Barbaren“.
Es ist falsch, dass die Araber, die Ägypten 640 n.Chr. erobert hatten, „struggled to integrate the newly conquered territory into a distinctly Islamic cultural context.“ (S. 67) Am Anfang waren die Araber nicht daran interessiert, ihre neugewonnen Untertanen zu islamisieren. Der Islam selbst hatte sich damals noch gar nicht als neue Religion gefestigt. Das begann erst später unter Kalif Abd al-Malik ab 685 n.Chr. Deshalb ist man in der Wissenschaft dazu übergegangen, von den Eroberern lieber von Arabern als von Muslimen zu sprechen.
Nachdem auf S. 76 gesagt wurde, dass „the real history of Egypt had been forgotten“, folgt nur eine Seite später die Aussage, dass die Meinung verbreitet war, dass die Hyksos um 1600 v.Chr. die Pyramiden erbauten (S. 77). Aber die Kenntnis von den Hyksos ist doch ein unglaubliches Detail der ägyptischen Geschichte! Also war doch nicht alles vergessen …
Louis Figuier wird „one of the most racist scientists of his era“ genannt. Figuier „tried to remove the Arabs and other non-Whites from the story altogether.“ (S. 145) – Wir können bei Figuier bei kurzer Recherche keinen fanatischen Rassismus feststellen, sondern nur den „normalen“ Rassismus der Zeit. Figuier nimmt Schwarze sogar gegen Benachteiligungen in Schutz. Es ist zudem fraglich, ob ein damaliger Rassist Araber als „nicht-weiß“ wahrgenommen hätte. Wir vermuten, dass Jason Colavito bei Figuier mit dem Vorwurf des „most racist“ über das Ziel hinausgeschossen ist. (Da wie überall keine Quelle angegeben ist, können wir die Behauptung nicht überprüfen.)
Die folgende Aussage ist gleich dreifach falsch: „Since the publication of Charles Darwin’s On the Origin of Species in 1859, the tension between secular views of history and science and traditional spiritual and mythical ideas had grown unbearable, and the break between them had become almost inevitable. To believe that the pyramids were ten thousand years old or the work of Atlanteans operating under divine command was to reject the discomforting authority of evolution and materialism.“ (S. 158) – Erstens ist Charles Darwin kein Argument gegen ein Alter von zehntausend Jahren, denn mit Charles Darwin wurde die menschliche Geschichte stark in die Vergangenheit verlängert. Das bessere Argumente gegen die zehntausend Jahre wären die Ergebnisse der Ägyptologie gewesen. – Das Spektrum der Bedeutungen, die man dem Begriff „divine command“ geben kann, ist sehr breit. Das bessere Argument wäre gewesen, dass Religion und Wissenschaft zwei Sphären sind, die man methodisch nicht vermischen sollte. – Das betrifft auch die Behauptung einer „authority of … materialism“. Das bessere Argument wäre gewesen, von einem „methodischen Materialismus“ zu sprechen. Wissenschaft ist jedenfalls keine Verpflichtung zu einem materialistischen Glauben. Ich würde sogar fast sagen: Wenn überhaupt, dann das Gegenteil.
Seltsamerweise werden „the Nazis“ in diesem Buch nur mit einem einzigen kurzen Satz behandelt: „The Nazis believed it“, nämlich dass die Ägypter „weiße Arier“ waren (S. 208). Zunächst ist diese Aussage falsch. Der führende NS-Althistoriker Helmut Berve bestritt 1935 das Existenzrecht der Ägyptologie an deutschen Universitäten, da sie sich mit einer „nichtarischen“ Zivilisation befasse, die man nicht verstehen könne, weil sie „artfremd“ sei. Die deutschen Ägyptologen versuchten daraufhin, soweit sie nicht emigriert oder vom Dienst suspendiert worden waren, die Ägypter als Arier darzustellen. Abgeschafft wurde die Ägyptologie zwar nicht, aber das Verdikt von Helmut Berve wog schwer.
Leider hat es Jason Colavito versäumt, auf den nationalsozialistischen Propaganda-Film „Germanen gegen Pharaonen“ von 1939 einzugehen. Der Plot ist schnell erzählt: Zuerst stellt ein Ägyptologie-Professor die Sicht der wissenschaftlichen Ägyptologie vor. Dann tritt ein Pseudowissenschaftler auf, der alle die Dinge behauptet, von denen Jason Colavito in diesem Buch schreibt: Sehr interessant! Und schließlich tritt ein Nationalsozialist auf, der beweist, dass die Ägypter ihr Wissen angeblich aus dem Norden von den Germanen hatten. Es ist wirklich sehr schade, dass dieser Film nicht in diesem Buch besprochen wird. Der Film ist auf Youtube frei verfügbar.
Zum Thema Atlantis
Der Umgang von Jason Colavito mit dem Thema Atlantis ist wie immer äußerst mangelhaft. Zugegeben: Das Thema Atlantis ist sehr komplex und Jason Colavito ist nicht der erste, der diese Fehler begeht.
Zunächst wird Atlantis „fabulous“ genannt (S. 23) und es ist von „its wonders“ die Rede (S. 24). Doch Atlantis war nicht „fabulous“ und auch kein Wunderland, sondern fügte sich in den Augen der alten Griechen perfekt in deren damalige Weltsicht ein. An Atlantis war nichts Phantastisches oder Magisches. Jason Colavito unterlässt es auch, die 9000 Jahre von Atlantis mit den 11340 Jahren von Herodots Ägypten in Beziehung zu setzen (S. 23), von denen er kurz zuvor erzählt hatte (S. 11). Doch nur unter diesem Gesichtspunkt versteht man überhaupt, wie man die 9000 Jahre deuten muss. Platon wollte jedenfalls bestimmt nicht auf die letzte Eiszeit verweisen, soviel steht fest.
In der Darstellung Ägyptens bei Platon unterlaufen Jason Colavito zwei schwere Fehler: „Plato attributed the whole story to the Egyptians, claiming it had been written on pillars in an old temple and known only to the wise priests.“ (S. 23) – Beides ist falsch. In Platons Timaios 24a heißt es, dass der Priester zusammen mit Solon „Schriften zur Hand nehmen“ werde (ta grammata labontes), und das kann nur ein Papyrus sein. Die Legende von den Tempelsäulen kam erst später auf, vermutlich mit der Geschichte von Krantor, wie sie von Proklos überliefert wird. – Aber auch die „weisen Priester“ sind falsch. Denn der Priester, der Solon auf Atlantis hinweist, wird als namenloser, alter Priester beschrieben, nicht als „weiser“ Priester. Es handelt sich um einen der vielen Anhaltspunkte, die die Geschichte sehr realistisch wirken lassen. Erst spätere Autoren haben versucht, den Priester als einen namentlich bekannten und berühmten Priestergelehrten darzustellen (Plutarch, Proklos, Clemens von Alexandria, Kosmas Indikopleustes). – Insofern die Entstehung eines falschen Ägyptenbildes das zentrale Thema dieses Buches ist, handelt es sich um zwei schwerwiegende Fehler.
Und es unterläuft Jason Colavito auf derselben Seite gleich noch ein dritter schwerwiegender Fehler, mit dem er sich zusätzlich in einen Selbstwiderspruch verwickelt: Auf der einen Seite wird die Aussage Platons richtig dargestellt, dass die zyklisch auftretenden Flutkatastrophen Ägypten verschonen – auf der anderen Seite wird behauptet, dass in der Atlantisgeschichte von einer Weltflut die Rede sei („its history occurred before the greatest flood of all, the one that destroyed the world.“; S. 23, auch S. 37). Doch das ist falsch. Die Flutkatastrophen in der Atlantisgeschichte sind regionale Katastrophen. Wie bereits richtig gesagt, soll insbesondere Ägypten von diesen Flutkatastrophen jeweils verschont geblieben sein.
Jason Colavito möchte auf eine Gleichsetzung der Flut von Atlantis mit der biblischen Sintflut hinaus, zwischen denen er „extremely close parallels“ (S. 24) sieht, doch das ist falsch. Die Flut von Atlantis ist nicht nur keine Weltflut, sondern es ist auch falsch, dass Zeus am Ende der Atlantisgeschichte die Zerstörung von Atlantis ankündigt, wie Jason Colavito meint (S. 24). Vielmehr wird dort eine Strafe zur Besserung der Atlanter angekündigt, und das kann nicht die Zerstörung sein. Immerhin: Vielleicht wurde die Zerstörung von Atlantis bei einer zweiten Götterversammlung beschlossen. Ebenfalls falsch ist es, wenn Jason Colavito schreibt: „In all of these stories, key elements repeat“, denn neben der Tatsache, dass die Atlantisflut keine Weltflut war, zählt Jason Colavito ein wichtiges Schlüsselelement auf, das in der Altantisgeschichte gar nicht vorkommt: „A small number of people are saved“ (S. 24). In der Atlantisgeschichte gibt es keine Arche Noah, soviel steht fest. – Es gibt also keine „extremely close parallels“ zwischen der Atlantisgeschichte und der biblischen Sintflutsage, sondern mehrere gewichtige Unterschiede.
Völlig irreführend ist es, wenn Jason Colavito von Platons Atlantisgeschichte mit den Worten „Parts of the story can be found in“ zu Apollodoros, Ovid und Lukian überleitet (S. 24). Diese Autoren sprechen nicht von Atlantis. Zudem dürfte mit Apollodoros die Bibliotheca des Pseudo-Apollododors gemeint sein. Denn Apollodoros selbst ist bekannt für eine Aufzählung von damals bekannten unglaubwürdigen Wundergeschichten, in denen die Atlantisgeschichte auffällig fehlt; sie war für ihn offenbar keine unglaubwürdige Wundergeschichte.
Es ist auch falsch, wenn Jason Colavito davon schreibt, dass „later Jewish, Christian, and Islamic commentators, all of whom saw … a reason to associate Atlantis with the antediluvian world that existed before Noah’s flood“. Es ist zwar richtig, dass einige christliche Autoren diese Verbindung irrigerweise gezogen haben (z.B. Clemens von Alexandria, Kosmas Indikopleustes), aber andere christliche Autoren haben sehr wohl erkannt, dass die Flut von Atlantis keine Weltflut war (z.B. Tertullian, Arnobius Afer).
Es kann deshalb auch keine Rede davon sein, dass die Atlantisgeschichte „the blueprint for associating Egypt’s greatest wonders – the pyramids – with Noah’s flood“ war (S. 25). Mir ist kein antiker Text bekannt, in der von Pyramiden in Atlantis die Rede ist. Dieser Gedanke kam erst in der Neuzeit auf, als man die Pyramiden der indianischen Kulturen in Amerika mit den Pyramiden in Ägypten verglich. Es ist zwar richtig, dass die Pyramiden schon in der Antike mit der biblischen Sintflut in Verbindung gebracht wurden, aber die Atlantisgeschichte war dabei nicht im Spiel.
Jason Colavito selbst erwähnt in den folgenden Kapiteln auch nirgends einen solchen Zusammenhang, speziell auch dort nicht, wo er hätte erwähnt werden müssen, wenn es diesen Zusammenhang gegeben hätte, so z.B. bei der Diskussion der „Many Flood Stories“ (S. 29). Auch, dass die Atlantisgeschichte angeblich auf Tempelsäulen geschrieben stand, wird in den folgenden Kapiteln nicht mehr erwähnt, obwohl dort viel von den Mythen die Rede ist, die sich um die Inschriften auf Säulen und Tempelwänden ranken. Es ist fast so, wie wenn Jason Colavito seinen eigenen Behauptungen über Atlantis nicht getraut hätte, so dass er sie in seiner späteren Argumentation lieber wegließ. Die Argumente, die er statt dessen vorlegt, sind auch viel besser und zweifelsohne richtig (z.B. Flavius Josephus S. 32).
Es ist geradezu verwunderlich, dass Jason Colavito erst mit Ignatius Donnelly wieder auf die Verbindung von Atlantis und den Pyramiden zu sprechen kommt. Die Vermutung, dass die ägyptischen Pyramiden mit den Pyramiden der indianischen Kulturen in Amerika über den versunkenen Kontinent Atlantis zusammenhängen, ist deutlich älter. Diese Beobachtung geht mindestens zurück bis Carlos de Sigüenza y Góngora 1680.
Jason Colavito verkürzt zudem die Darstellung von Ignatius Donnelly in einer Weise, die den eigentlichen Sinn verfälscht. Laut Colavito hätte Donnelly geschrieben, „that Atlantis had been populated by White people and Jews, the chosen races of God. ‚Atlantis was the original seat of the Aryan or Indo-European family of nations,‘ he wrote.“ (S. 207 f.) – Doch wenn wir bei Donnelly nachlesen, finden wir etwas ganz anderes. Dort heißt es: „That Atlantis was the original seat of the Aryan or Indo-European family of nations, as well as of the Semitic peoples, and possibly also of the Turanian races.“ (S. 2 Donnelly) Die „Semitic peoples“ umfassen wesentlich mehr als nur die Juden, und die Turanier sind „gelb“. Und von „chosen races“ ist überhaupt nicht die Rede. Lediglich „chosen people“ wird in Bezug auf die Juden an einer ganz anderen Stelle erwähnt (S. 212 Donnelly). Auch die Europäer sind für Donnelly keine reinen Weißen, sondern eine Mischung verschiedener „Farben“ (S. 197 Donnelly). – Natürlich ist das alles aus moderner Perspektive immer noch rassistisch, aber es ist eben keinesfalls dermaßen rassistisch wie es bei Jason Colavito klingt.
Was fehlt
Es wäre sinnvoll gewesen, die alchemische Tradition Ägypens noch mehr in den Blick zu nehmen. Hier wäre es außerdem gut gewesen, wenn die Überlieferungswege, die Peter Kingsley von den Pythagoreern nach Ägypten aufgezeigt hat, analysiert und integriert worden wären (Peter Kingsley, Ancient Philosophy, Mystery, and Magic – Empedocles and Pythagorean Tradition, Clarendon Press, Oxford 1995).
Der Umstand, dass viele Christen die ägyptische Kultur für eine Kultur von Götzenanbetern hielten, die sie deshalb verachteten, hätte näher beleuchtet werden müssen (z.B. Origenes).
Man hätte gerne einen der christlichen Autoren genannt bekommen, die die überproportionalen Darstellungen von Pharaonen und Göttern auf den ägyptischen Tempelwänden als Darstellungen von Riesen deuteten (S. 51).
Man hätte gerne Belege dafür bekommen, dass die Kopten nicht der Meinung waren, dass die Pyramiden die Kornspeicher des Joseph waren (S. 63).
Man hätte gerne mehr Hintergrundinformation zu der anonymen Aussage bekommen: „For every building, I fear the ravages of time, but as for this monument, I fear for time.“ (S. 67) Woher kam diese Aussage? Was ist ihre älteste Erwähnung?
Man hätte gerne mehr über die Verbindung der Freimaurer zur ägyptisierenden Symbolik erfahren.
Man hätte gerne eine Quellenangabe zu der Behauptung, dass Léon Denis mit einem Zitat von Lenormant das Horusgefolge angeblich zu Atlantern erklärte (S. 145). Man findet bei Léon Denis nur ein Zitat von Lenormant, dass die Sphinx älter sei als die Pyramiden. Ich vermute, die Aussage zu den Atlantern ist ein Irrtum, und es ist dieses Zitat gemeint.
Man hätte gerne einen konkreten Beleg für diese Aussage: „The empire imagined for antediluvians and Atlantis was a mythic precedent to the unprecedented imperial expansion of Victorian Europe.“ (S. 213) – Es klingt ja durchaus plausibel, aber einen Beleg für diesen Zusammenhang zu finden, ist schwierig.
Schluss
Wer sich für das Thema interessiert, bekommt mit Jason Colavitos neuem Buch eine überaus reichhaltige Stoffsammlung in die Hand, wie er sie so schnell nicht woanders finden wird. Mit gesunder Skepsis und einem Interesse an eigener Recherche kann man damit viel anfangen. Sehr viel sogar. Wer es gerne übersichtlich und einfach hat, wird allerdings nicht so gut bedient.
An manchen Stellen ist der Autor etwas respektlos gegenüber religiösem Glauben. Sehr zu loben ist hingegen das Kapitel „Afrocentrism and ancient Egypt“, in dem Jason Colavito beschreibt, wie Ägypten als „schwarz“ vereinnahmt wurde. Hier fällt der äußerst heilsame Satz: „… but as with so many correctives, they often tried to make too strong a case for the opposite, reproducing many of the same errors in reverse.“ (S. 210) Außerdem merkt Jason Colavito mit Recht an, dass hinter solchem Denken immer noch ein rassistisches Denken steckt, „a pernicious belief that culture is genetic“ (S. 211). Sehr wahr.
Bewertung: 3 von 5 Sternen.
(Erstveröffentlichung auf Atlantis-Scout und Amazon (gekürzt, englisch) am 31. August 2021)