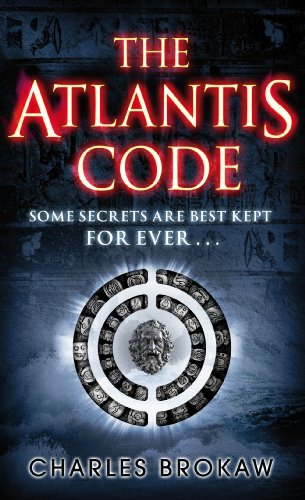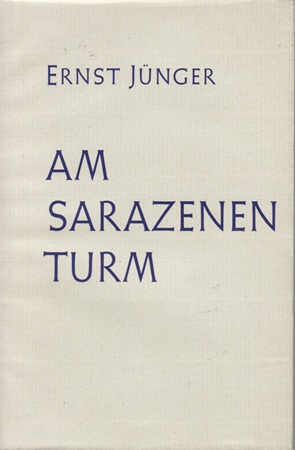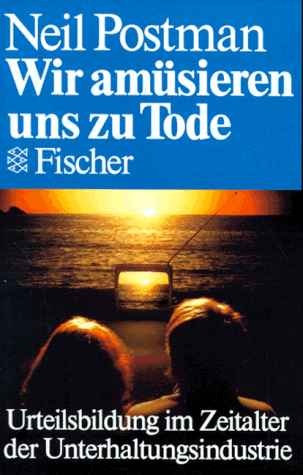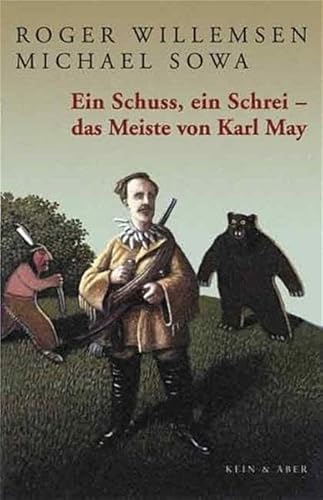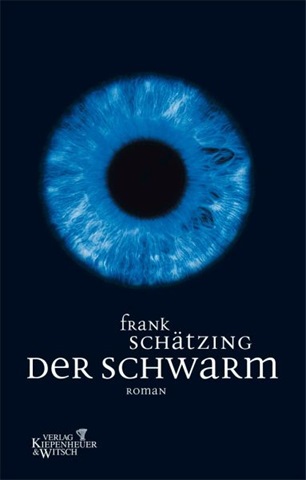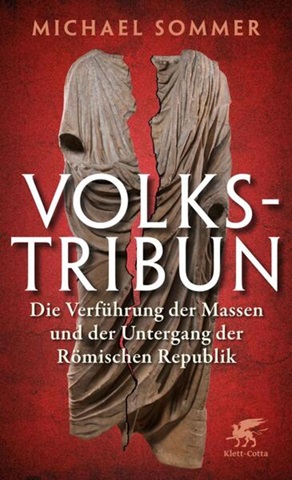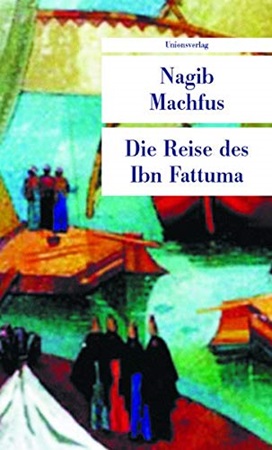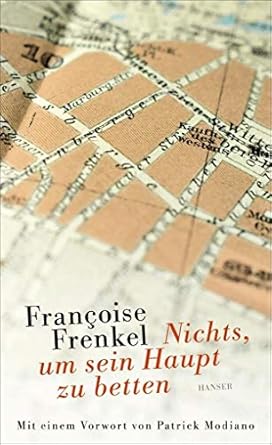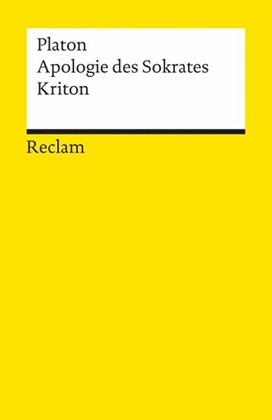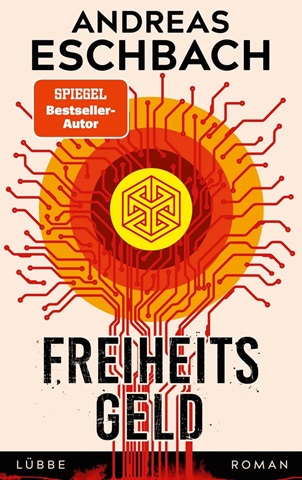Der Populist Clodius und der Einsatz organisierter, öffentlicher Gewalt am Ende der Römischen Republik
Das Buch „Volkstribun“ von Michael Sommer ist ein Leckerbissen für alle Fans des antiken Roms: Nicht nur Karriere und Schicksal des ruchlosen Clodius werden dem Leser vor Augen geführt, sondern auch das größere Bild der bekannten Abläufe drumherum, von Ciceros Aufstieg über Ciceros Verbannung bis zum Triumvirat und dem Aufstieg Caesars. Der Autor erklärt alles ausführlich und gut verständlich, was auch nötig ist, denn der Leser wird fortwährend mit den berühmt-berüchtigten termini technici bombardiert, die das komplexe Regelwerk der Römischen Republik bestimmten. Ob senatus consultum ultimum, interrex, ambitus, pietas oder mos maiorum: Wer’s mag, wird sich gut aufgehoben fühlen und kann unbeschwert Eintauchen in eine seit Schulzeiten wohlvertraute Welt. Ein Überblick über die wechselhafte Forschungsgeschichte zu Clodius, ein Register und eine Bibliographie runden das Buch ab, es ist wirklich ordentlich gemacht.
Clodius aus der altehrwürdigen gens Claudia war nicht der einzige, aber wohl der erfolgreichste „Populist“ im Alten Rom, der die Solidarität der Senatoren gegenüber dem Volk durchbrach und sich direkt beim Volk eine Machtbasis aufbaute (populariter agere). Dazu vollbrachte er eine organisatorische Glanzleistung, denn er musste über ein ausgeklügeltes Mikromanagement in die kleinteiligen Strukturen der römischen Gesellschaft hineinregieren. Überall hatte Clodius seine Leute, es muss ein riesiges Netzwerk gewesen sein. Clodius ließ sich zudem vom Patrizier zum Plebejer herunterstufen und auch sein Name wurde von Claudius zum volkstümlichen Clodius umgestylt.
Auf dieser Basis schaffte Clodius es, die bewährten Abläufe der republikanischen Staatsordnung immer wieder zu durchbrechen. Sei es durch die Störung von Abstimmungen, durch deren Verschiebung, oder auch durch die Einschüchterung von politischen Gegnern, die sich nicht mehr aus dem Haus trauten. Der Höhepunkt war zweifelsohne die Vertreibung von Cicero ins Exil – mithilfe eines ex post erlassenen Strafgesetzes – und die Zerstörung seines Hauses, an dessen Stelle Clodius ironischerweise einen Schrein der Göttin Libertas errichten ließ.
Ermöglicht wurde Clodius dieses Treiben auch dadurch, dass die römischen Senatoren sich nicht mehr so einig waren wie in früheren Zeiten, und sich immer heftiger gegenseitig bekämpften, so dass Clodius immer die eine Seite gegen die jeweils andere Seite ausspielen konnte. Außerdem versagten die Senatoren durch ihre Machtspiele immer häufiger in der Lösung von Problemen, was die Menschen in die Hände von Populisten wie Clodius trieb. Kurz: Die römischen Senatoren waren dekadent geworden und die Strukturen des alten Stadtstaates passten nicht mehr zu den Verhältnissen eines Weltreiches, in dem es um sehr viel Macht und sehr viel Geld ging.
Im besten Fall hätte das Treiben des Clodius zu einem Umbau der Republik hin zu einem demokratischeren System geführt, mit einem moderneren Verständnis von Libertas. Dafür war der Charakter des Clodius allerdings nicht geeignet. Er war wirklich Populist im negativen Sinne, d.h. er beutete die niederen Instinkte des Volkes aus Eigeninteresse aus, statt wirklich die Interessen des Volkes zu vertreten. Aus diesem Populismus erwuchs schließlich nicht die Freiheit, sondern die Tyrannei: Auch Julius Caesar übte sich im populariter agere und ersetzte schließlich die Republik durch eine Diktatur.
Heute ist Clodius weitgehend vergessen. Bekannt ist nur noch Caesar, natürlich aus Filmen und Comics. Schon Cicero dürfte nur noch jenen bekannt sein, die einmal Latein gelernt haben. In meiner Abiturprüfung zum Großen Latinum wurde ich nach dem Gegenspieler Ciceros gefragt. Ich antwortete vorsichtig: Caesar? Das war nicht falsch, gemeint war vom Prüfer aber Clodius, von dem ich bis zu dieser Prüfung nie etwas gehört hatte. Eine gute Note habe ich dann trotzdem bekommen. Gut, dass es jetzt dieses Buch gibt, mit dem ich meine damalige Wissenslücke gründlich schließen konnte!
Defizite
Zunächst einige Formalia: In den letzten Kapiteln des Buches überschlagen sich die Ereignisse so sehr, dass es dem Leser schwerfällt, die verschiedenen Drehungen und Wendungen der politischen Allianzen noch nachzuvollziehen. Manche Koalition erscheint überraschend und willkürlich. – Einige wenige Begriffe bleiben unerklärt, so z.B. Prodigien. Auch ambitus hätte vielleicht noch einmal erklärt werden müssen. – Im ganzen Buch finden sich nicht allzu viele, aber doch auffällig viele Rechtschreibfehler: Hier hätte der Verlag besser aufpassen müssen.
Die größte Kritik richtet sich aber gegen den Umstand, dass der Autor es scheute, Parallelen zu unserer Zeit zu ziehen. Dabei ist das doch eine der Hauptanwendungen antiker Geschichte: Dass wir unsere modernen Verhältnisse auf der Bühne der antiken Geschichte spiegeln, und so unsere modernen Probleme besser verstehen und vielleicht auch lösen können.
Moderne Parallelen zur organisierten öffentlichen Gewalt
Ergänzen wir also, was fehlt: Welche modernen Parallelen zu Clodius und seinen organisierten Volksmassen und Schlägerbanden lassen sich denken? Es geht um organisierte, sichtbare Gewalt von Gruppen im öffentlichen Raum. Es geht also nicht um Terror und Mord, wie er von RAF, NSU oder Islamisten verübt wird: Das ist eine völlig andere Kategorie von Gewalt.
- Donald Trump und die Erstürmung des Kapitol am 06. Januar 2021. Richtig ist, dass hier organisierte Gruppen wie Proud Boys und Oath Keepers Gewalt gegen die Polizei anwendeten. Es ist allerdings falsch, dass Trump die Menge bei seiner Rede aufgepeitscht hätte. Die Erstürmer des Kapitols versammelten sich unabhängig von Trumps Versammlung direkt am Kapitol und begannen ihren Sturm, während Trump noch eine halbe Stunde redete und zu einem friedlichen Protest aufrief. Als dann einige Teilnehmer von Trumps Veranstaltung zum Kapitol herübergelaufen kamen, war der Durchbruch durch die Polizeikette schon geschehen. Ja, es war organisierte Gewalt, aber nein: Trump hat sie weder organisiert noch aufgestachelt. Außerdem hatten zuständige Demokraten „vergessen“, für genügend Polizei zu sorgen, obwohl genau bekannt war, wer an diesem Tag zum Kapitol kommen würde.
- Die sogenannte „Antifa“. Dabei handelt es sich in der Tat um organisierte Gruppen, die in der Fläche des Landes präsent sind. Sie bedrängen teilweise Politiker, sprengen Versammlungen, schrecken Besucher von politischen Veranstaltungen ab, beschmieren die Häuser von Politikern, fackeln die Autos von Politikern ab usw. Geld fließt nicht selten vom Staat, etwa an „autonome Zentren“ oder für „autonome Projekte“.
- Gewalt durch NGOs, sogenannte „Nichtregierungsorganisationen“. Diese werden meistens sehr wohl von der Regierung bezahlt. Oder von einflussreichen Milliardären. Einem physischen Gewaltbegriff nahe kommen sie als Klimaradikale der „Letzten Generation“ oder als angebliche „Seenotretter“, die illegale Migration unterstützen und dabei auch mal ein Polizeiboot über den Haufen fahren.
- Islamistische öffentliche Gewalt, getragen von gewissen Gruppen und Moscheen, ist ebenfalls organisierte Gewalt. Dazu gehören auch pro-palästinensischen Proteste, die jüdische Studenten von der Universität und Juden generell aus dem öffentlichen Raum ausgrenzen. Nicht selten verbinden sich diese Gruppen mit linken Gruppen.
Es scheint, dass die politische Linke die Klaviatur der öffentlichen Gewalt derzeit wesentlich besser beherrscht und über wesentlich besser organisierte und finanzierte Strukturen verfügt, als die politische Rechte. Rechte organisierte Gewalt scheint sich auf manche Regionen in Ostdeutschland zu beschränken.
Hinzu kommt, dass die etablierten Medien die politische Linke decken. Dazu gehört, dass über die organisierte, öffentliche Gewalt von Links kaum gesprochen wird. Thematisiert wird vielmehr vor allem Gewalt von Rechts. Das geht so weit, dass offensichtlich falsche Statistiken, die die linke Gewalt klein- und die rechte Gewalt großreden, unhinterfragt zur veröffentlichten Meinung werden.
Drei Maßnahmen lassen sich in aller Kürze nennen, die zu einem Ende der politischen Gewalt führen würden:
- Die Finanzierung ist trockenzulegen. Politik muss sich aus der Finanzierung von liebgewordenen Gruppen und Grüppchen gleich welcher Art auch immer grundsätzlich zurückziehen. Wer sich für das Klima und gegen Rechts engagieren will, kann dies gerne tun, aber bitte mit eigenem Geld und auf friedliche Weise.
- Die Medien müssen fair berichten, dann wird politische Gewalt schnell unattraktiv für diejenigen, die sie organisieren und finanzieren. Dazu müssten die Medien neu geordnet werden.
- Polizei und Staatsanwaltschaft müssen ohne Ansehen der Person konsequent durchgreifen. Dazu müsste wohl u.a. die Weisungsgebundenheit der Staatsanwaltschaften in Deutschland abgeschafft werden.
Wie man sieht, hängt die Lösung ganz vom politischen Willen ab, Gewalt nicht zu einem Mittel der Politik zu machen. Ein solcher politischer Wille, eine solche Entschlossenheit gibt es derzeit offenbar nicht. Was am ehesten zur Wiedergewinnung eines solchen Willens führen könnte, ist der Aufbau alternativer Medien, die den Finger immer spürbarer in die Wunde legen und die Anwendung öffentlicher Gewalt auf diese Weise immer unattraktiver machen. Mit der Fairness des Mediensystems steht und fällt der gesamte demokratische Prozess in allen seinen Facetten, so auch hier.
Weitere Parallele: Populismus
Populismus im negativen Sinne gibt es heute ebenfalls, und zwar auf allen Seiten: Die etablierten Parteien gehen dem Volk um den Bart, indem sie über ihre Medienherrschaft Heile-Welt-Propaganda verbreiten, auch wenn alles den Bach heruntergeht, und indem sie Rentnern und Sozialhilfeempfängern Geldgeschenke machen. Gewisse Probleme werden verschwiegen, kleingeredet, relativiert oder mit primitivem Lösungsoptimismus überdeckt.
Mithilfe von Medien und NGOs wird außerdem „Astroturfing“ betrieben: Damit ist die Vortäuschung einer Bewegung „von unten“, aus dem Volk, gemeint, die in Wahrheit nicht wirklich „von unten“ kommt, sondern „von oben“, von Strippenziehern, organisiert wird, ganz wie bei Clodius im alten Rom. Häufig sind daran auch NGOs beteiligt. Beispiele sind Fridays for Future oder die Demonstrationen gegen die angebliche Wannsee-Konferenz 2.0 von Correctiv: Hier wird jeweils über Medien ein aufpeitschendes Angstnarrativ gestreut und zugleich der Protest von einschlägigen Gruppen vor Ort organisiert (Linksradikale, Kirchen, Ökos, Islamisten). Manche Normalbürger denken, es handele sich um eine „breite Bewegung“ und laufen naiv in solchen Demos mit.
Linksradikale und Rechtsradikale Parteien hingegen sprechen diese Probleme offen an, benutzen sie aber oft nur, um ganz andere Ziele zu verfolgen, mit denen die Bürger vom Regen in die Traufe kommen würden. Teilweise hat man den Eindruck, dass die etablierten Parteien und Medien eifrig daran mitwirken, dass sich in neuen Parteien radikale Kräfte durchsetzen, denn dann kann man diese leichter ausgrenzen. Deshalb gibt es in vielen europäischen Ländern inzwischen nicht mehr nur eine, sondern zwei Rechtsparteien: Eine populistisch-radikale, und eine liberal-konservative. Die Vernunft hat es schwer, in diesen Tagen.
Weitere Parallelen: Dekadenz und Weltreich
So wie die römischen Senatoren dekadent geworden waren, korrumpiert durch ständigen Machtbesitz und die neuen Möglichkeiten des Weltreiches, so sind unsere heutigen Eliten teilweise einfach zu lange an der Macht – teilweise sind sie aber auch globalistisch abgehoben und folgen linksradikalen Träumereien gegen die Interessen der Menschen vor Ort, deren nationale Verwurzelung nur noch als Störfaktor im Weltbetrieb gilt.
Und so, wie die Strukturen des alten römischen Stadtstaates nicht mehr zu den Verhältnissen eines Weltreiches passten, so sind heute viele internationale Strukturen aus der Zeit gefallen und dringend reformbedürftig: Sei es die UN, die von Antidemokraten und Antisemiten beherrscht wird, oder die EU, die von Multikulti-Fanatikern und Lobbyisten durchsetzt ist. Aber auch der Nationalstaat ist in seiner Funktion wieder neu zu entdecken, und das Verhältnis zwischen internationalen Organisationen und Nationalstaaten muss neu austariert werden.
Bewertung: 4 von 5 Sternen.