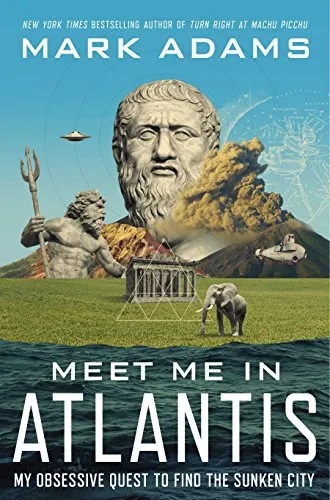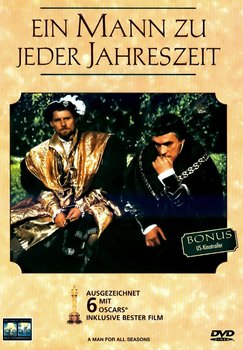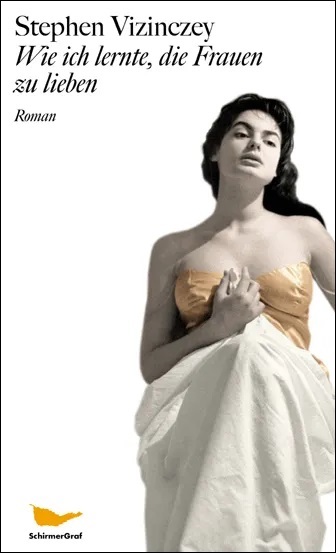Die Geburt des Shitbürgers aus dem Ungeist des NS-Wendehalses
Mit „Shitbürgertum“ hat Ulf Poschardt einen neuen Begriff geprägt für etwas, was wir schon kennen: Das „linksliberale“ Bürgertum der BRD. In seiner anekdotischen Beschreibung des „linksliberalen“ Elends hat dieses Buch viele Überschneidungen mit anderen Werken zum Thema, etwa „Unter Linken“ von Jan Fleischhauer.
Das Besondere dieses Buches
Ulf Poschardt liefert allerdings keine heiter-gelassene Beschreibung des Shitbürgertums. Bei Poschardt kommt ein aggressiver Ton hinzu: Das Shitbürgertum muss weg. Weil es uns inzwischen kaputtzumachen droht. Die letzten Reste liberalkonservativer Bürgerlichkeit sind aufgezehrt, der Marsch durch die Institutionen ist vollendet. Niemand hindert das Shitbürgertum mehr an seinem selbstzerstörerischen Wirken. Die Antwort auf den Marsch durch die Institutionen muss die Schleifung der Institutionen sein.
Vor allem aber überrascht das Buch mit seiner Kritik an der Aufarbeitung des Nationalsozialismus: Etwas ist gründlich schief gegangen bei der Vergangenheitsbewältigung, und zwar von Anfang an, und es zieht sich bis heute durch. Den Ursprung des Shitbürgertums sieht Ulf Poschardt in der inneren Abspaltung der bösen Vergangenheit durch NS-Wendehälse wie Günter Grass oder Walter Jens. Diese NS-Wendehälse belehrten uns ihr ganzes Leben lang, wie böse und faschistisch die BRD-Gesellschaft doch sei, aber dann stellte sich heraus, dass diese Gestalten selbst überzeugte Nazis gewesen waren!
Diese innere Abspaltung des eigenen Bösen hat eine manichäische Haltung von absolut rein und gut vs. absolut schmutzig und böse hervorgebracht, die bis heute beim „linksliberalen“ Bürgertum anhält. Das Shitbürgertum ist in diesem Sinne infantil und regressiv, weil es ein radikal simplifiziertes Weltbild hat: Das Böse, das ist immer das „Eigene“, also das Deutsche und das Normale, und die Bösen, das sind immer die anderen. Wer nicht „linksliberal“ ist, der ist „Nazi“. Dieser Manichäismus ist auch der Grund, warum dieses „linksliberale“ Bürgertum jeden selbstzerstörerischen und selbstverleugnenden Unsinn mitmacht, so dass sich die Gesellschaft immer mehr in einen autoritären Kindergarten verwandelt. Diese Kritik ist ein fulminanter Angriff gegen das juste milieu der BRD, und ja: Ulf Poschardt trifft den wunden Punkt unserer Gesellschaft sehr gut.
Für das Shitbürgertum dürfte allein die Tatsache, dass ihre „linksliberalen“ Ikonen wie Günter Grass und Walter Jens fast alle (!) ehemalige Nazis waren, eine ungeheure Provokation sein. Bislang nimmt man dieses Phänomen immer noch als Einzelfall wahr. Dass aber die BRD geistig dermaßen stark durch ehemalige Nazis geprägt wurde, die auf Wendehals machten, ist bislang noch nicht zu Bewusstsein gekommen. Dieser Teil unserer Geschichte wird immer noch tapfer verdrängt, und mit ihm die üblen Konsequenzen bis heute.
Was dem gegenüber wieder gewonnen werden muss, ist die Fähigkeit zur Ambivalenz, die Integration der eigenen Schattenseiten in das eigene Bewusstsein, gewissermaßen ein Erwachsenwerden hin zum Realismus und weg von manichäischen Illusionen über sich und andere. Deutschland liegt bei Ulf Poschardt also auf der Couch und bedarf der Therapie. Auch das ist kein völlig neuer Gedanke.
Rettung sieht Ulf Poschardt von der Pop-Kultur her kommen: Diese ist rücksichtslos und frech, aber auch zur Ambivalenz fähig. Die Kettensäge von Milei oder Donald Trump sind für Ulf Poschardt popkulturelle Phänomene.
Kritik – Weiterentwicklungen des Shitbürgertums
Mindestens zwei historische Weiterentwicklungen des Shitbürgertums werden bei Ulf Poschardt nicht oder nicht ausreichend thematisiert. Die Urquelle des Shitbürgertums sind zweifelsohne die NS-Wendehälse. Das ist richtig.
Aber 1989/90 kam der Antifaschismus der DDR hinzu. Die DDR definierte sich kurzerhand als antifaschistischer Staat, was zur Folge hatte, dass die DDR zur Selbstkritik nicht mehr fähig war. Im ZK der SED tummelten sich die NSDAP-Funktionäre, die Freie Deutsche Jugend wurde maßgeblich von Hitlerjugend-Funktionären aufgebaut, die Volksarmee der DDR war von einer NS-Aufarbeitung so weit entfernt wie der Mond, und auch die starke Skinhead-Szene der DDR verdankt sich der völligen Unfähigkeit der DDR, die deutsche Vergangenheit adäquat aufzuarbeiten. Die DDR war gewissermaßen der Staat-gewordene NS-Wendehals, der manichäische Abspaltung betrieb. Mit der Wiedervereinigung kamen in diesem (Un-)Geist geprägte Gestalten aus der DDR an die Schaltstellen von Politik und Gesellschaft in der BRD.
Die zweite große Weiterentwicklung des Shitbürgertums kam aus dem angelsächsischen Raum: Dort hatte sich eine ganz ähnlich shitbürgerliche Deutung der dortigen Kolonialvergangenheit herausgebildet, die alles, was früher war, verteufelte. Zugleich hatten sich an den US-Universitäten postmoderne Ideologien durchgesetzt, die den klassischen Humanismus zersetzten: Vernunft, Realismus oder Freiheit sind für postmoderne Ideologen lediglich Machtmittel von „alten, weißen Männern“, die es zu dekonstruieren gälte. Dieser Ungeist schwappte mit voller Wucht in unsere Gesellschaft herüber und wurde von den hiesigen Shitbürgern begierig aufgesogen. Ein irrwitziger Multikulti-Fanatismus und eine realitätsverleugnende Gender-Ideologie machten sich breit, bis hin zur Zerstörung unserer geliebten deutschen Sprache. Teilweise wurde in sklavischer Übernahme angelsächsischer Shit-Ideen sogar versucht, den Holocaust gegenüber der deutschen Kolonialvergangenheit herunterzuspielen. Antisemitismus ist der heimliche Trumpf im heutigen Shitbürgertum.
Kritik – Zentraler Irrtum von Ulf Poschardt
In einem entscheidenden Punkt übernimmt Ulf Poschardt eine shitbürgerliche These der NS-Wendehälse, statt diese als einen wesentlichen Bestandteil ihrer inneren Abspaltung von allem Bösen zu erkennen: Ulf Poschardt meint, dass die deutsche Kultur vor 1933 tatsächlich schlimm, schlecht und böse gewesen sei und mehr oder weniger zwangsläufig zum Nationalsozialismus geführt habe. Also ganz so, wie die NS-Wendehälse es uns einzureden versuchten.
Dabei ist diese Art der Geschichtsbetrachtung doch allzu leicht als ein integraler Bestandteil der Abspaltungsstrategie zu durchschauen! Denn die totale Schlechtredung von allem, was früher war, ist gewissermaßen der Gipfel der inneren Abspaltung. Je reiner die NS-Wendehälse sich selbst fühlen wollten, desto schmutziger musste alles andere sein. Und der Gipfel des Schmutzes ist es natürlich, wenn nicht nur die Nazis Nazis waren, sondern am besten alle Deutschen, und das nicht nur 1933-45, sondern möglichst schon seit es Deutsche gibt. Das ermöglichte es den NS-Wendehälsen auch, sich über ihre Mitmenschen zu erheben: Denn wenn sie auch keine Nazis mehr waren, so waren sie doch immer noch Deutsche, trugen also das „böse Erbe“ in jedem Fall noch in sich. Die Flucht vor dem Deutschsein nach „Europa“, die Flucht in einen völlig irrwitzigen Multikulti-Fanatismus haben hier ihre Erklärung, und ebenso natürlich der Hass auf alles Deutsche, wie er in der Gendersprache zum Ausdruck kommt.
Dass Ulf Poschardt bei all seiner Einsicht in das Wesen der NS-Wendehälse dieses zentrale Märchen nicht erkannt hat, ist bedauerlich und fast schon seltsam. Es gibt übrigens noch eine weitere Steigerung dieses Märchens der NS-Wendehälse: Die nächste Steigerung wäre, dass alle Menschen verdorben und schlecht, mithin „Nazis“ sind, und dass die Übel der Welt nur durch die Überwindung des Menschen selbst ausgerottet werden können. Da sind wir dann bei den postmodernen Klimaapokalyptikern und Extinktionalisten angelangt, für die die „unberührte“ Natur alles ist, und der Mensch nichts.
Im den folgenden Abschnitten widerlegen wir im Detail die Argumente, mit denen Ulf Poschardt die ganze deutsche Vergangenheit vor 1933 zum Problem erklärt, danach nehmen wir den Faden der Kritik wieder auf.
Widerlegung: Gegen die Vollschuldigkeit aller Deutschen
Die These, dass die Deutschen im Nationalsozialismus gewissermaßen kollektiv und allesamt schwer schuldig geworden waren, ist völlig falsch. Diese These spiegelt nicht die Realität, sondern natürlich nur die manichäische innere Abspaltung der NS-Wendehälse. Denn wenn alle Deutschen mehr oder wenig schuldig waren, dann ist auch ihre eigene Schuld nicht mehr so groß. Außerdem kann man sich hinterher umso besser moralisch über seine Mitbürger erheben, wenn man sie alle für schuldig erklärt.
In Wahrheit ist die Schuld am Nationalsozialismus jedoch sehr ungleich verteilt. Für Humanisten gilt immer die individuelle Verantwortung. Jeder sündigt für sich allein. Es gibt keine Kollektivschuld und keine Sippenhaft.
Die meisten Deutschen waren keine Nazis. Thomas Mann und Karl Jaspers waren z.B. auch Deutsche: Wie sollte man auf die Idee kommen, ihnen eine nennenswerte Schuld zu unterstellen? Martin Walser erzählte von seiner Mutter, die für den NS-Seniorenbund Kuchen backte und sich dort mit älteren Damen zum Kaffeekränzchen traf: Diese Seniorinnen waren wohl kaum sehr schuldig, sondern hatten ganz einfach keine Ahnung von dem, was wirklich geschah. In den letzten wirklich freien Wahlen gewannen die Nationalsozialisten gerade einmal 33% der Stimmen. Das ist erstaunlich wenig. Und auch die meisten Wähler der NSDAP hatten vermutlich höchst naive Vorstellungen über die Politik, die von den Nationalsozialisten gemacht werden würde. Das war damals nicht anders als heute: Was weiß der durchschnittliche Wähler denn z.B. schon davon, was Angela Merkel mit ihrer Euro-Rettungspolitik angerichtet hat? Wenn die Medien nicht Alarm schlagen, wird es die Masse der Menschen nicht realisieren. So war es immer, so wird es immer sein.
Gerade weil die Deutschen meistens nur wenig oder gar nicht schuldig waren, war es 1945 eine effektive Methode zur Entnazifizierung, die Deutschen durch die KZs zu führen: Denn das, was die Deutschen da zu sehen bekamen, war nicht das, was sie gewollt hatten, jedenfalls die meisten nicht. Und es musste ihnen gezeigt werden, damit sie es glauben konnten, sonst hätten sie es – irrig aber ehrlich – rundweg abgestritten. Hätten die Deutschen diese Verbrechen gewollt, hätten die Führungen durch die KZs keinen Effekt gezeigt. Hier ist auch an Hannah Arendt zu erinnern, die nach den ersten Berichten aus den befreiten KZs an alliierte Propaganda glaubte und einige Tage benötigte, um zu begreifen, dass die Berichte wahr sind. Wenn schon eine Hannah Arendt es nicht wusste und erst nicht glauben konnte, wie dann erst ein Otto-Normal-Deutscher?
Eine größere Schuld trifft natürlich intellektuelle Menschen, die ideologische Texte zugunsten des Nationalsozialismus produziert hatten und in die NSDAP eingetreten waren. Das trifft auf die von Ulf Poschardt ins Auge gefassten NS-Wendehälse meistens zu. Es ist kein Wunder, dass gerade solche Leute das Märchen in die Welt setzen wollen, dass „die Deutschen“ insgesamt schuldig am Nationalsozialismus geworden seien. Das liegt doch auf der Hand! Warum hat Ulf Poschardt das nur nicht gesehen?
Widerlegung: Gegen eine pauschale Deutschfeindlichkeit
Von George Steiner, einem US-Literaturwissenschaftler, zitiert Ulf Poschardt zustimmend, dass man offenbar zugleich Goethe und Rilke lesen und Menschen in Auschwitz Menschen ermorden könne. Und: „For let us keep one fact clearly in mind: the German language was not innocent of the horrors of Nazism.“
Die Vorwürfe von George Steiner sind leicht zu widerlegen. Haben denn britische Kolonialoffiziere, die Verbrechen begangen haben, keinen Shakespeare gelesen? Was will man damit überhaupt aussagen, dass klassische Bildung angeblich nichts nütze gegen Verbrechen?! Das Gegenteil ist doch richtig: Natürlich kultiviert Bildung den Menschen. Natürlich trägt sie zur Humanisierung bei. Das ist doch gar keine Frage! Wer jedoch von den Ausnahmen her ein Argument gegen Bildung konstruieren will, der schüttet das Kind mit dem Bade aus. Es wird immer Menschen geben, die sich dem tieferen Sinn von Bildung gegenüber verschlossen zeigen und diese falsch und schief interpretieren. Das macht die Bildung aber nicht wertlos.
Genau dieser falsche Vorwurf an die klassische Bildung, womöglich zum Nationalsozialismus beigetragen zu haben, wurde von den NS-Wendehälsen erhoben, die Poschardt kritisiert. So z.B. Alfred Andersch in seinem Buch „Der Vater eines Mörders“, in dem auf groteske Weise versucht wird, dem Vater Heinrich Himmlers, der Direktor an einem humanistischen Gymnasium war, eine Mitschuld am Nationalsozialismus anzuhängen (mit der vergifteten Frage: „Schützt Humanismus denn vor gar nichts?“). Es ist völlig unverständlich, warum Ulf Poschardt diese falsche und freche Verleumdung der klassischen Bildung durch die NS-Wendehälse mitmacht, indem er George Steiner zustimmend zitiert.
Schließlich noch zu dem Vorwurf von George Steiner, dass schon die deutsche Sprache schuldig sei. Hier sind wird dann endgültig bei der These angekommen, dass die deutsche Kultur schlechthin verdorben und Nazi-artig sei. Wenn das wahr wäre, dann müsste man die deutsche Kultur tutto completto abräumen. Von Walther von der Vogelweide bis Michael Ende. Genau das ist ja auch das Ziel nicht weniger „Linksliberaler“. Es ist die reine Deutschfeindlichkeit. Aber sie ist natürlich nur dumm und falsch. Wer die 1000jährige deutsche Geschichte – oder auch die jahrhundertealte Geschichte Preußens – nur als ein Vorspiel zum Nationalsozialismus verstehen will, der hat schlicht eine Macke. Man kann es nicht anders sagen.
Gewiss kann und soll und muss die deutsche Kultur gereinigt und erhöht werden – aber nur, wie jede andere Kultur auch. Wer Adolf Hitler zum Inbegriff des Deutschen schlechthin macht, ist auf dem Holzweg. Ulf Poschardt verweist selbst auf Thomas Mann und dessen These von der Ambivalenz der deutschen Kultur (S. 150). Eine Ambivalenz existiert aber nur dort, wo es auch das Gute gibt.
Widerlegung: Gegen ein falsches Preußenbild
Ein zentrales Argument Poschardts für die Schuldigkeit der deutschen Kultur ist die Forschung der britischen Historikerin Helen Roche zu preußischen Militärschulen und zu nationalsozialistischen Napola-Militärschulen. Helen Roche glaubt, dass in beiden Fällen das „Härteideal Spartas“ eine zentrale Rolle gespielt habe, beidemale als Antwort auf Niederlagen (gegen Napoleon und 1918). Poschardt spricht auch von dem „unbarmherzigen Preußentum“. (S. 21)
Es hört sich zunächst martialisch und unmenschlich an: Das Härteideal Spartas an preußischen und NS-Schulen. Aber es handelt sich um eine große psychologische Irreführung. Die Wahrheit ist viel banaler.
Die Wahrheit ist zunächst, dass im 19. Jahrhundert die klassische Bildung in ganz Europa Hochkonjunktur hatte. Es dürfte überall in Europa an allen Militärschulen aller Länder über Sparta nachgedacht worden sein. Sparta steht im klassischen Bildungskanon für das Militärische wie nichts anderes, und nichts lag deshalb näher, als sich an Militärschulen mit Sparta zu befassen. Nicht nur in Preußen, sondern auch in England oder Frankreich. Rezensionen zur Forschung von Helen Roche merken an, dass ihre Belege für die Rezeption Spartas an preußischen Kadettenschulen weniger eindeutig sind als die für die NS-Napola-Anstalten und mehr als ein Hinweis auf die damals vorherrschende klassische Bildung zu deuten sind (z.B. Hagen Stöckmann auf H-Soz-Kult 31.03.2014).
Zum Militärischen gehören auch heute noch Dinge wie Pflicht, Gehorsam, Drill, Opferbereitschaft, Patriotismus. Ein Militär ist ohne diese Dinge schlicht nicht denkbar. Auch jede moderne Armee muss sich damit auseinandersetzen. Und warum sollte man das nicht mit dem antiken Sinnbild für das Militärische schlechthin tun? Man sollte hoffen, dass auch heute noch in den Bildungseinrichtungen der Bundeswehr klug über Sparta nachgedacht wird. Aber natürlich auch über Athen.
Denn im 19. Jahrhundert stand unter Gebildeten nicht Sparta, sondern Athen im Mittelpunkt. Wir lesen in der Gefallenenrede des Perikles, dass auch die Athener sich auf das Militär verstanden, und zwar nicht schlechter als die Spartaner. Das wusste man auch im 19. Jahrhundert. Die Ideen der preußischen Reformer hören sich jedenfalls wesentlich mehr nach Athen als nach Sparta an, darunter die Heeresreform mit ihrem Konzept des Bürgers als dem geborenen Verteidiger seines Landes. Auch die Flottenbegeisterung zur Kaiserzeit konnte wesentlich besser an Athen als an Sparta anknüpfen, denn Sparta galt als Landmacht, Athen jedoch als Seemacht.
Hinzu kommt, dass der Militarismus Spartas noch keinen Rassismus, ja, überhaupt nicht zwingend irgendeinen Antihumanismus bedeuten muss. Die „bösen“ Spartaner haben jedenfalls keinen Völkermord begangen, sondern ausgerechnet die „guten“ Athener, nämlich gegen die Bewohner der Insel Melos. Der berühmt-berüchtigte Melierdialog bei Thukydides gehört zum unverlierbaren Bildungsgut der Menschheit als Mahnung für alle Zeiten. Seit damals stellen sich Historiker die Frage, wie es möglich war, das gerade eine Bildungsnation wie Athen einen Völkermord begehen konnte. Es ist dieselbe Frage, die man sich im 20. Jahrhundert zu Deutschland und dem Holocaust stellte, denn auch Deutschland war ein Land der Bildung. Wer da in einer Befassung mit Sparta ein besonderes Problem sehen will, hat den Ernst der Lage nicht erkannt.
Schließlich ist Ulf Poschardt einfach völlig auf dem Holzweg, wenn er von „unbarmherzigen Preußentum“ spricht. Das war die primitive Sicht der ungebildeten Nazis auf das Preußentum. Kadavergehorsam war eine Idee der Nazis, nicht Preußens. Preußen lebte auch von seinen Legenden und Mythen, und eine dieser unverlierbaren, wahren Legenden ist die des preußischen Generals von der Marwitz (1723-1781), der einen Befehl Friedrichs des Großen aus Gewissensgründen verweigerte. Ikonisch schrieb man auf seinen Grabstein: „Wählte Ungnade, wo Gehorsam nicht Ehre brachte.“ Dieser Satz gehört fest zum kollektiven Gedächtnis Preußens. Und er hat Wirkung gezeigt, z.B. im bekannten Attentat auf Hitler vom 20. Juli 1944. Gleichzeitig machte sich Hitlers Chef des Oberkommandos der Wehrmacht Wilhelm Keitel über diverse moralischen Bedenken der preußischen Offiziere in der Wehrmacht lustig. Keitel war eben kein Preuße, sondern ein Nazi.
In Wahrheit war Preußen einfach ein Staat wie jeder andere, sagen wir: wie England, mit Höhen und Tiefen, mit guten und schlechten Seiten. Die Kritik an Preußen ist bestens bekannt und teilweise auch berechtigt. Aber Preußen stand – durch Friedrich den Großen und Immanuel Kant – eben auch für die Aufklärung. Die preußischen Reformer und die Humboldt-Brüder standen für Fortschritt, Aufklärung, Geist und Moderne.
Das Spießrutenlaufen schaffte das „unbarmherzige“ Preußen als eines der ersten Länder im Jahr 1806 ab, also genau in der Phase, in der an preußischen Militärschulen über das Härteideal Spartas nachgedacht wurde. In süddeutschen Ländern geschah dies erst viel später, z.B. in Württemberg erst 1818, in Österreich sogar erst 1855.
In der Revolution von 1848 zeigte sich der preußische König mit der schwarz-rot-goldenen Fahne, nachdem ein versehentlicher Schuss (bis heute ungeklärt woher) zu Barrikadenkämpfen in Berlin geführt hatte. Jedenfalls gab es keinen Befehl zum Schießen und die Kämpfe begannen in jedem Fall ungewollt. Ebenso wurden die Berliner Straßenkämpfe nicht erst beendet, nachdem alle Revolutionäre besiegt waren, sondern der König selbst ließ den ohne Befehl spontan ausgebrochenen Kampf wieder beenden, zeigte sich mit der schwarz-rot-goldenen Fahne und ehrte die Getöteten. Man kann ehrlicherweise nicht behaupten, dass Preußen die Revolutionäre zusammenschießen ließ wie es die Kommunisten am 17. Juni 1953 taten. Alles andere als das. Aber die Shitbürger plappern munter von der „Unbarmherzigkeit“ Preußens.
Man beachte auch, dass die Frankfurter Nationalversammlung dem preußischen Königshaus die deutsche Kaiserkrone antrug. Preußen scheint also in den Augen der Frankfurter revolutionären Parlamentarier nicht der Inbegriff alles Bösen gewesen zu sein. Jeder weiß auch, dass Preußen die Kaiserkrone wegen Österreich ablehnen musste, um einen innerdeutschen Krieg zu vermeiden (der dann 1866 doch noch kam). Auch die Erschießung des Abgeordneten Robert Blum war ein Werk der Österreicher, nicht der Preußen. Der ganze Vormärz wurde von den Österreichern und ihrem Staatskanzler Metternich beherrscht.
Historiker wie Hedwig Richter haben darauf hingewiesen, dass das Kaiserreich moderner und demokratischer war als viele meinen.
Es ist einfach eine falsche und ungerechte schwarze Legende, dass Preußen „unbarmherzig“ und „hart“ gewesen wäre, und dass dies mehr oder weniger zielstrebig im Nationalsozialismus geendet hätte. Diese primitive Sicht auf Preußen wurde dann nahtlos von den NS-Wendehälsen in die BRD hineingetragen. Es macht traurig, dass Ulf Poschardt in diesem Punkt den NS-Wendehälsen auf den Leim gegangen ist.
Schließlich ist es Ulf Poschardt selbst, der Preußen auf S. 87 positiv konnotiert und damit seiner eigenen Preußenfeindlichkeit vom Anfang des Buches widerspricht. Dort echauffiert sich Poschardt darüber, dass Oskar Lafontaine „den preußischen Hanseaten“ Helmut Schmidt attackierte, um gegen die preußischen Sekundärtugenden zu polemisieren. Hier hat Ulf Poschardt die Verhältnisse wieder gerade gerückt: Oskar Lafontaine ist der Shitbürger, der die preußische Vergangenheit abspaltet und Sekundärtugenden nur verachtet, obwohl sie wertvoll sind, während Helmut Schmidt diese preußische Vergangenheit nicht abspaltet, sondern in seine Persönlichkeit inkorporiert, und auf vernünftige Weise für seine Gegenwart fruchtbar macht.
Ulf Poschardt wiederholt hier übrigens denselben Denkfehler, den auch Andreas Rödder in seinem Buch „Konservativ 21.0“ begangen hat: Erst sagt Rödder, dass es durch den Nationalsozialismus einen Traditionsbruch gegeben habe, und deshalb müsse man mit allem, was davor war, brechen. (Was für ein Unsinn! Gerade deshalb, weil der Nationalsozialismus ein Bruch war, kann man sehr wohl an das, was davor war, wieder anknüpfen.) Später dann beruft sich Rödder auf den Preußen Wilhelm von Humboldt und fordert Allgemeinwissen über Preußen und die Hohenzollern ein. Auch hier bei Rödder finden wir also diese völlig verklemmte Selbstwidersprüchlichkeit im Umgang mit Preußen: Erst verdammt man gut shitbürgerlich alles, dann erachtet man aber doch dies oder das oder jenes für wertvoll, und merkt den Widerspruch nicht.
Kritik – Keine konstruktive Vision
Fahren wir mit unserer Kritik fort: Ulf Poschardt erhofft sich Rettung von der Popkultur und deren respektlosen Zerstörung der Verhältnisse. Aber eine konstruktive Vision ist das eigentlich nicht. Gut, es ist eine libertäre Vision. Aber nach dem libertären Kettensägenmassaker muss eine Ordnung übrig bleiben, und die will konstruktiv gedacht sein. Hier schwächelt Poschardt.
Was fehlt, ist natürlich eine positive Vision für Deutschland. Ein geläutertes Nationalbewusstsein ohne Abspaltungen: Darum geht es Poschardt doch! Ein Deutschland, das mit sich im Reinen ist. Ein Deutschland, das stolz auf den – sprechen wir es aus – preußischen Humanismus ist. Ein Deutschland, das auch Zuwanderer gerne in seine wunderbare Kultur integriert, die eine offene und humanistische Kultur ist, aber keinesfalls eine selbstvergessene Kultur. Aber solche Töne fehlen bei Poschardt. Vielleicht hätte ihm das zu national gesinnt geklungen? Es wäre aber nur folgerichtig.
Man hätte z.B. die Vision entwickeln können, den Staat Preußen als ganz normales Bundesland, bestehend aus den historischen Gebieten auf dem Boden der ehemaligen DDR, wiederzuerrichten. Wer die falsche Abspaltung der NS-Wendehälse überwinden wollte, müsste genau das tun. Endlich die volle Versöhnung mit der eigenen Geschichte, endlich die volle Ambivalenz ins eigene Nationalbewusstsein integriert. Deutschland macht ohne Preußen gar kein Bild in der Seele, hier ist erst der Schlüssel zu allem!
Vielleicht scheitert Ulf Poschardt aber gerade deshalb an einer solchen positiven Vision, weil er den Shitbürgern in einem Punkt auf den Leim gegangen ist: Dass Deutschland und die deutsche Kultur vor 1933 durchweg „böse“ und schuldig seien. Auf dieser ideologischen Basis kann man nie mehr zu einer Geisteshaltung ohne Abspaltung kommen.
Kritik – Shitbürgertum von Rechts kaum thematisiert
Ulf Poschardt erwähnt, dass die starken Männer in der AfD gegen den Westen und gegen den Liberalismus sind (S. 144). Aber leider zieht er nicht die direkte Verbindung zum Shitbürgertum, die hätte gezogen werden müssen!
Wenn wir Alexander Gaulands Buch „Anleitung zum Konservativsein“ lesen, finden wir dort im Zentrum des Buches in mehreren Kapiteln (!) eine fundamentale Kritik an Preußen. Gauland zieht alle nur erdenklichen Register der preußenfeindlichen Propaganda. Schließlich meint Gauland, dass Preußen gesellschaftlich und territorial verloren sei, und will auf gar keinen Fall – und niemals nicht! – dass Preußen wieder sei. Das ist schon auffällig nahe am Shitbürgertum.
Gleichzeitig freut sich Gauland darüber, wie die Osteuropäer wieder an die Zeit vor 1933 anknüpfen, bevor sie durch Nationalsozialismus und Kommunismus geknebelt wurden. Und das, obwohl diese Länder kaum weniger als Preußen „gesellschaftlich und territorial“ gelitten haben. Auch hat Alexander Gauland überhaupt kein Problem mit Bayern, und das, obwohl Bayern das Bundesland mit den engsten Bindungen zum Nationalsozialismus war: München war die Hauptstadt der Bewegung, Nürnberg die Stadt der Reichsparteitage, und in Bayreuth residierte der große Inspirator des Nationalsozialismus auf dem Grünen Hügel. Für Gauland kein Problem. Aber Preußen mit seiner Rationalität und seinem preußischen Humanismus, das ist für Gauland ein Riesenproblem.
Auch sonst ist Gauland der typische Shitbürger: Sein Antiamerikanismus ist unübersehbar. Sein Antiliberalismus ist penetrant. Und konservativ ist er eigentlich auch nicht, wenn man es recht bedenkt. Sondern unangenehm bräunlich. Eine Fixierung auf Hitler scheint offensichtlich.
Schließlich missbraucht Alexander Gaulands Freund Björn Höcke Preußen immer wieder als Projektionsfläche für seine schrägen Phantasien. Höcke kann dies tun, weil das juste milieu der BRD ihm Preußen völlig überlassen hat. Höcke kann über Preußen den größten Unsinn verzapfen, wie einst die NS-Wendehälse, und niemand widerspricht ihm.
Insbesondere aber denkt Höcke keine Sekunde daran, Preußen als Bundesland wiederherzustellen. Das wahre Preußen wäre für Höcke ein Problem. Das wahre Preußen ließe sich nicht so leicht missbrauchen. Es stünde Höckes Visionen von Deutschland nur im Wege. Wir erinnern uns, wie Kaiser Wilhelm II. in seinem Exil in Doorn mehrere Stunden vergeblich versuchte, Göring zu erklären, dass man Deutschland nur in Ländern regieren könne: „Zwei Stunden lang habe ich diesem Rindvieh klarzumachen versucht, dass man Deutschland nur auf der Grundlage des Föderalismus regieren kann.“
Kritik – Kleine Fehler
Richard von Weizsäcker wird von Ulf Poschardt den Shitbürgern entgegengestellt (S. 37). Er hätte seine Rede vom 8. Mai 1985 nur deshalb halten können, weil er selbst aufgrund seiner Familiengeschichte die Ambivalenzen integriert hätte. Doch das ist falsch. Ganz falsch. Bekanntlich wurde Weizsäckers Rede für die Aussage gefeiert, dass der 8. Mai ein Tag der Befreiung war. Doch diese Einseitigkeit der Perspektive auf den 8. Mai ist genau die Abspaltung von allem Bösen und Problematischen, das Ulf Poschardt anprangert. Denn viel besser als Richard von Weizsäcker hatte es der erste Bundespräsident Theodor Heuss gesagt, der in einer Rede vor dem Parlamentarischen Rat am 8. Mai 1949 eine andere Deutung des 8. Mai präsentiert hatte, die bis 1985 unter Liberalkonservativen unbestritten war: „Im Grunde genommen bleibt dieser 8. Mai 1945 die tragischste und fragwürdigste Paradoxie der Geschichte für jeden von uns. Warum denn? Weil wir erlöst und vernichtet in einem gewesen sind.“ Hier, bei Theodor Heuss, finden wir die Integration der Ambivalenz, nach der Ulf Poschardt verlangt, während Richard von Weizsäcker einfach nur ein weiteres abspalterisches Dogma des Shitbürgertums bestätigt hat.
Martin Walser wird bei Ulf Poschardt zu den Shitbürgern und Antisemiten gezählt, seine Friedenspreisrede in der Paulskirche scharf kritisiert (S. 32). Diese Perspektive ist fragwürdig. Martin Walser hatte sich von der linksliberalen Schickeria losgesagt und gründlich zu denken begonnen („Nichts ist wahr ohne sein Gegenteil“), weshalb er ausgegrenzt blieb. Auch seine Paulskirchenrede ist nicht einfach antisemitisch, sondern im Gegenteil ein Versuch, die Ambivalenz, nach der Ulf Poschardt verlangt, wieder sichtbar zu machen. (Es wäre interessant zu wissen, was Ulf Poschardt von Hans Magnus Enzensberger denkt.)
Fazit
Mit „Shitbürgertum“ hat Ulf Poschardt einen laut vernehmbaren Weckruf in die Welt gesandt, der hoffentlich zu einer vermehrten Bewusstseinsbildung beiträgt, indem Realitäten auf Begriffe gebracht werden, vor allem den Begriff des „Shitbürgertums“. Völlig richtig ist, dass Ulf Poschardt den Kern des Übels in einer falschen Vergangenheitsbewältigung sieht. Leider ist Ulf Poschardt selbst nicht völlig frei von den Lebenslügen der Shitbürger. Deshalb bleibt seine positive Vision für Deutschland auch seltsam dünn. Aber es ist eine Streitschrift, lanciert zum Streiten. Und das ist gut, denn es ist der Anfang von aller besseren Erkenntnis.
Bewertung: 4 von 5 Sternen.