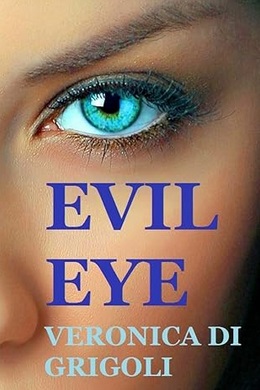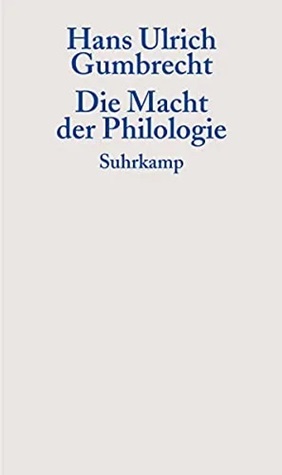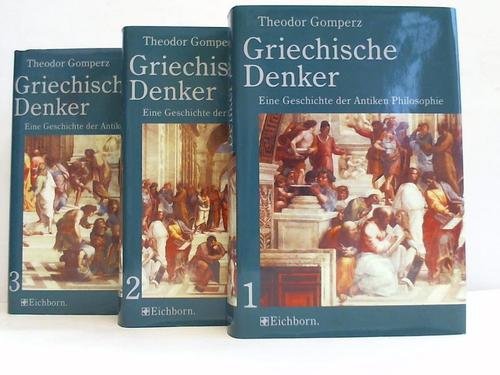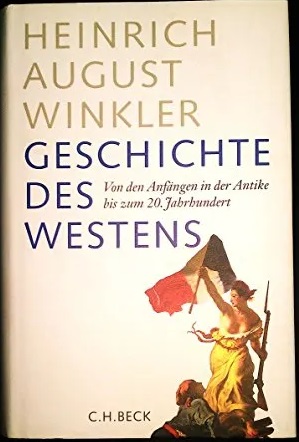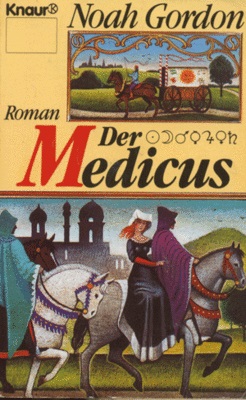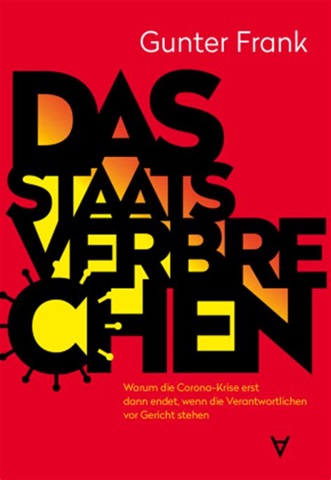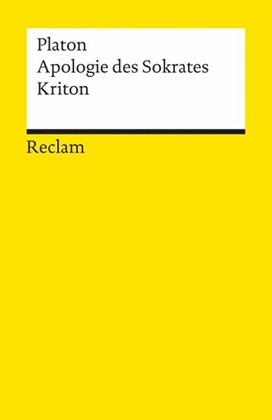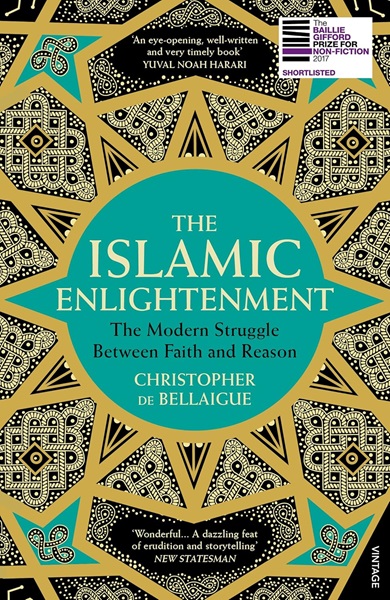Annäherung an die Wahrheit zu Corona anhand eines „Viertelsschwurbler“-Buches
Die Fronten zu Corona (Covid-19, Sars-Cov-2) sind verhärtet. Der normaldenkende Mensch hat die Erfahrung gemacht, dass beide Seiten mit Halbwahrheiten arbeiten. Schwurbler überall! Was soll man da glauben? Wie soll man sich da orientieren?
Der Frage nach der Corona-Wahrheit wollen wir hier anhand des Buches „Das Staatsverbrechen“ von Gunter Frank näherkommen. Auch Gunter Frank argumentiert nicht perfekt, aber sein Buch zeichnet sich durch ein hohes Maß an Faktizität und Rationalität aus. Gunter Frank schwurbelt fast nie um den Punkt herum, er kommt zum Punkt. Dabei liegt er nicht immer richtig. Aber er liegt vermutlich näher an der Wahrheit, als andere. Er ist sozusagen ein „Viertelsschwurbler“. Das ist in diesem Fall durchaus als Kompliment gemeint. Deshalb liefert sein Buch einen brauchbaren Ausgangspunkt für eine rationale Debatte.
Beginnen wir aber mit einer Chronologie eigener Beobachtungen und Gedanken während der Pandemie: Wir alle starten unsere Überlegungen nicht bei Null, und so soll auch hier zunächst aufgezeigt werden, was der Rezensent zu Corona dachte und wusste, bevor er dieses Buch las. Auf dieser Grundlage gehen wir danach auf das Buch ein.
Eigene Beobachtungen, chronologisch
Am Anfang der Pandemie war man mit den Corona-Maßnahmen der Regierung noch im Reinen: Offenbar hatte der Virus eine höhere Sterblichkeitsrate, wie man vor allem durch Berichte von Ärzten aus Bergamo erfuhr (09.02.2020). Bergamo war die Initialzündung zur Corona-Panik. Angela Merkel hielt ihre Fernsehansprache zu Corona praktisch zeitgleich zu den berühmt-berüchtigten „Bildern aus Bergamo“, die eine Kolonne von Militärlastwagen zeigten, die Särge abtransportierten (18.03.2020). Heute wissen wir: In Bergamo wurden massive Behandlungsfehler begangen. Aber das wusste man damals noch nicht. – Die Wissenschafts-Youtuberin Mai Thi Nguyen-Kim hatte zudem wunderbar erklärt, wie das mit „Flatten the Curve“ funktioniert: Man muss die Erkrankungsrate senken, um das Gesundheitswesen zu schonen, indem nicht zuviele Menschen auf einmal an Corona erkranken.
Was Mai Thi nicht ausgerechnet hatte, war die Zeit, wie lange man „Flatten the Curve“ betreiben müsste, um alle Menschen nach und nach durch die Erkrankung und – anteilig – durch das Gesundheitswesen zu schleusen: Mein eigenes Rechenergebnis sagte mir, dass es viele Jahre sein würden. Bei Alexander Kekulé fand ich diese Erkenntnis später bestätigt. Damit war mir aus damaliger Sicht klar, dass die Pandemie durch eine Impfung beendet werden musste, und dass es eine Pflichtimpfung sein würde. Denn man kann die Gesellschaft nicht für viele Jahre in den Lockdown schicken, und die Impfung würde nur helfen, wenn sehr viele sie bekommen würden. – Was ich zu diesem Zeitpunkt nicht wusste: Die Impfung würde gar nicht wie eine klassische Impfung wirken. Und: Eine Pandemie kann auch durch eine mildere Variante des Virus beendet werden.
Meine Erwartung war also, dass die Politik die Menschen auf eine Impfpflicht vorbereiten würde. Doch das geschah nicht. Im Gegenteil verkündeten alle Politiker und Journalisten unisono, dass der Gedanke an eine Impfpflicht eine Verschwörungstheorie von Schwurblern und bösen „Rechten“ wäre. Nach der Bundestagswahl 2021 schalteten die Politiker dann plötzlich reihenweise auf Impfpflicht um: Das war maximal unglaubwürdig, sehr undemokratisch und sehr entlarvend.
Dann war da noch die sehr frühe Studie des Virologen Hendrik Streeck zu Heinsberg, die u.a. das Ergebnis brachte, dass die Sterblichkeitsrate doch nicht so hoch war, wie man zunächst befürchten musste. Man hätte erwartet, dass diese Ergebnisse Beachtung bei den Maßnahmen finden. Es geschah jedoch nicht. Vielmehr wurde versucht, Streeck schlechtzureden. Man gewann den Eindruck, dass man gar nicht daran interessiert war, die wahre Sterblichkeitsrate des Virus näher zu bestimmen: Dabei hing daran doch alles!
Zum Thema Masken hatte ich gleich am Anfang der Pandemie ein Youtube-Interview mit einem südkoreanischen Arzt gehört. In Südkorea hatte man bereits 2015 Erfahrungen mit einer MERS-Pandemie gesammelt und musste also Bescheid wissen. Der südkoreanische Arzt sagte klipp und klar, dass Masken sehr wohl nützen. Sie reduzieren das Risiko. Natürlich nicht auf Null. Und es ging um medizinische Masken, auch als OP-Masken bekannt. – Als dann später die FFP2-Masken Pflicht wurden, fragte man sich, wie man solche Masken einen ganzen Tag lang tragen soll. Schulkinder und Angestellte mit Kundenkontakt wurden dazu gezwungen. Man selbst litt schon, wenn man ein paar Stunden damit in der Bahn saß. Da Masken das Risiko nicht auf Null reduzieren, dürfte die Nutzen-Schaden-Abwägung bei FFP2-Masken nicht positiv gewesen sein.
Christian Drosten erschien am Anfang der Pandemie recht überzeugend, weil er gut reden konnte. – Doch zu Anfang der Pandemie sagte er, dass Masken nichts nützen würden. Das sagte er natürlich deshalb, weil wir zu wenige Masken in Deutschland hatten und er nicht wollte, dass nun ein Run auf die Masken beginnt, so dass am Ende keine Masken mehr für das Gesundheitswesen übrig bleiben. Man kann das als eine verständliche Notlüge interpretieren. Allerdings wäre mir bis heute nicht zu Ohren gekommen, dass Drosten sich zu dieser Notlüge je bekannt hätte. – Heute, nach der Pandemie, hört man, dass Drosten sagt: Er wäre immer der Auffassung gewesen, dass Masken nichts nützen. Verrückt! Denn er hatte in der Pandemie ganz klar Masken propagiert. – Auch sonst will Drosten hinterher nicht so richtig dabei gewesen sein, wie man hört: Sehr fragwürdig! Zudem fabuliert er davon, in einer nächsten Pandemie die Meinungsfreiheit beschneiden zu wollen, weil Andersdenkende den Erfolg der Maßnahmen gefährden würden. Meint er. Drosten scheint ein tragischer Fall zu sein. Aber das alles wusste man erst hinterher.
Sehr schwer wiegt auch, dass Drosten gleich am Anfang der Pandemie behauptete, dass die These vom Laborunfall „vom Tisch“ sei. Sie war natürlich nicht vom Tisch, wie wir heute wissen. Als das Anfang 2022 klar wurde, war das eine weitere, schwere Erschütterung der Glaubwürdigkeit von Drosten, auf dessen Expertise ich in diesem Punkt vertraut hatte.
Seltsam war auch, dass der deutsche Staat nicht genügend Masken vorrätig hatte, und sich auch schwer tat, sie im Ausland zu beschaffen. Man lebt ja in der Vorstellung, dass der Staat Katastrophenschutzpläne in der Schublade hat und auch das nötige Material auf Vorrat hält. So wie die Feldbetten, die bei jeder Katastrophe verfügbar sind. Aber offenbar war das nicht der Fall. – Man hatte generell den Eindruck, dass es überhaupt keine Pläne für eine Pandemie gab, sondern alles ad hoc entschieden wurde. Statt planvollem Vorgehen nach Vorgaben von Experten z.B. des Robert-Koch-Instituts (RKI) hatten wir einen Hühnerhaufen von profilierungssüchtigen Politikern, besserwisserischen Journalisten und ein paar wenigen Star-Virologen.
Völlig obskur war die Argumentation, dass die Rettung auch nur eines einzigen Menschenlebens jede Maßnahme rechtfertigen würde. Der grüne Ministerpräsident Winfried Kretschmann berief sich dazu auf Immanuel Kant, ohne das näher zu begründen. Wolfgang Schäuble hat das schon im April 2020 hinterfragt, da Menschenwürde und Menschenleben nicht dasselbe seien, drang aber nicht durch. Ebenfalls im April 2020 äußerte Boris Palmer denselben Gedanken („Wir retten in Deutschland möglicherweise Menschen, die in einem halben Jahr sowieso tot wären – aufgrund ihres Alters und ihrer Vorerkrankungen.“) und wurde für diesen Satz stellvertretend für alle Andersdenkenden öffentlich niedergemacht. Man blieb beim radikalen Schutzanspruch. Etwas anderes durfte nicht gedacht werden. Es war erschütternd zu sehen, auf welch‘ niedrigem intellektuellen Niveau die Debatte verlief. Es war derselbe flache Dogmatismus, den man schon von den Debatten um Krieg, Migration, Folter oder finalem Rettungsschuss her kannte. Man kann es kaum eine Debatte nennen, es war ein Vertuschen und ein Wegbeißen von Andersdenkenden.
Die Corona-Warn-App war ebenfalls ein Flopp. Es war sehr schnell klar, dass sie überhaupt nichts nützt. Richtig war allerdings, dass nur eine solche App Akzeptanz finden würde, die datensicher ist. – Man hätte auch erwartet, dass der Staat damit beginnt, Gesundheitstipps zu verbreiten. Viele wissen nicht, dass man gegen eine Erkältungskrankheit nicht nur Vitamin C sondern auch Vitamin D braucht. Dafür hätte man Werbung machen können. Außerdem war schnell klar, dass Übergewicht ein Risikofaktor ist. Es wäre eine gute Gelegenheit gewesen, Werbung für mehr Bewegung und Abnehmen zu machen. Doch nichts geschah. Seltsam.
Während der Pandemie las man dann, dass Intensiv-Betten abgebaut werden. Und dass die Krankenhäuser unterbelegt sind. Weil viele Operationen verschoben wurden. Und man fragte sich, ob das nicht etwas übertrieben ist: Sollten die Krankenhäuser nicht wenigstens normal ausgelastet sein? „Flatten the Curve“ sollte die Krankenhäuser vor einer Überlastung schützen, aber nicht zu einer Unterbelegung führen.
Im öffentlichen Raum verengte sich die Debatte um Corona extrem schnell auf ganz wenige Personen, vor allem Drosten und Streeck. Kekulé war auch noch dabei, wurde aber marginalisiert. Eine Initiative wie der Offene Brief im Spiegel von Boris Palmer, Juli Zeh, Alexander Kekulé und Julian Nida-Rümelin wurde zwar gedruckt (immerhin), aber in der Debatte praktisch ignoriert. Hin und wieder meldete sich der Ethikrat mit seiner unsäglichen Vorsitzenden Alena Buyx zu Wort, und sagte immer genau das, wohin der mediale Zeitgeist gerade steuerte, statt ethische Dilemmata aufzuzeigen und Widerspruch anzumelden. Die Ministerpräsidenten Söder und Kretschmann spielten Team Vorsicht.
Die ganze Pandemie über gab es Schwurbler und Covidioten. Leute, die ganz offensichtlich falsche Dinge erzählten. Dinge, die so nicht sein konnten. Oder Leute, die sich im Ton vergriffen. Ich hatte mehrfach versucht, mir Videos von Bakhdi anzusehen. Der Mann war ein Schwätzer vor dem Herrn und kam nie zum Punkt. Ich hatte es dann aufgegeben, seinen Punkt zu verstehen. Die Corona-Kritiker konnten nie Glaubwürdigkeit aufbauen.
Ein Sonderfall war Gunnar Kaiser. Ein gebildeter Kritiker mit Stil, der allerdings leider manchmal ganz bewusst herumschwurbelte, so dass Ironie und Ernst nicht immer hinreichend zu unterscheiden waren. Unvergessen seine Lesung der „Pest in Bergamo“ von Jens Peter Jacobsen aus dem Jahr 1881. Gunnar Kaiser starb 2023 an Krebs.
Am Anfang war Drosten sehr glaubwürdig. dann immer mehr Alexander Kekulé. Bei Kekulé war klar, dass er die Dinge nach menschlichem Maß abwog, er war kein Ideologe und versuchte, das Ganze zu sehen. Er konnte seine Thesen nicht immer gut begründen, was manchmal unglaubwürdig erschien, aber am Ende hatte meistens Kekulé Recht, und nicht Drosten mit seinem Tunnelblick. Das wurde im Laufe der Zeit immer klarer. Auch jetzt, 2024, hat Alexander Kekulé ziemlich vernünftige Ansichten zum Thema Aufarbeitung.
Dann hörte man täglich von Inzidenz-Werten. Also von absoluten Fallzahlen festgestellter Corona-Infektionen. Jeden Tag in der Tagesschau. Aber diese Inzidenzzahlen hätten natürlich mit der Anzahl der durchgeführten Tests abgeglichen werden müssen, denn je mehr man testet, desto mehr findet man natürlich auch. Doch das geschah nicht, bis zum Ende der Pandemie nicht. Völlig sinnlose Zahlen wurden täglich zum Zentrum der Tagesschau gemacht.
Irgendwann wurde klar, dass bei den Todeszahlen nicht unterschieden wurde, ob ein Patient „an“ oder nur „mit“ Corona verstorben war. Man hätte erwartet, dass diese Statistik schleunigst umgestellt wird, und sei es nur nach grober Einschätzung der behandelnden Ärzte, damit mehr Klarheit herrscht. Doch es geschah nicht. Bis zum Ende nicht. Unfasslich.
Von Schweden hörte man zunächst, dass dort mehr Menschen als in Deutschland sterben, aber dann sickerte irgendwann durch, dass in Schweden – trotz lockerer Maßnahmen – deutlich weniger Menschen gestorben waren. Ähnliches hörte man dann auch aus den USA, im direkten Vergleich von verschiedenen Bundesstaaten. Aber die deutsche Politik und Medienöffentlichkeit reagierte auf solche Informationen nicht. Solche Informationen gab es nur unter der Hand. Bei den „Schwurblern“ und „Rechten“.
Es war sehr schnell klar, dass Kinder und Jugendliche kaum durch das Virus gefährdet sind. Es wäre eine sinnvolle Strategie gewesen, die Durchseuchung der jüngeren Bevölkerung gezielt anzustreben. Aber dem stand das Argument „Long Covid“ entgegen. Doch auch hier wurde man systematisch im Unklaren gelassen, wie oft dieses Phänomen eigentlich auftritt. Wir wissen heute: Bei Kindern und Jugendlichen selten genug. Außerdem war immer klar, dass das Virus irgendwann jeden erreichen wird. Fragt sich nur, ob vor oder nach einer Impfung. Und eine symptomlose oder milde Infektion mit dem Originalvirus ist natürlich die beste, natürlichste Impfung, die man sich wünschen kann.
Man fragte sich, je länger die Pandemie dauerte, ob den Politikern keine anderen und besseren Maßnahmen einfallen, als immer nur Lockdowns? Oder ob man Lockdowns nicht abwechslungsreicher hätte gestalten müssen: Lieber eine kurze Zeit einen strengen Lockdown, und dann wieder für eine gewisse Zeit größere Freiheit genießen, als einen endlosen, depressiv machenden Dreiviertelslockdown? Boris Palmer hatte in Tübungen auch einige gute Ideen, für die sich sonst niemand interessierte. Und warum mussten immer alle Bundesländer im Gleichschritt marschieren? Das machte doch gar keinen Sinn, da die Pandemie regional sehr unterschiedlich ausfiel. Gerade in der Pandemie hätte der Föderalismus seine Stärken ausspielen können. In den USA geschah das. Warum nicht bei uns? Hatte man etwa Angst, dass manche Länder besser abschneiden würden als andere? So wie beim Bildungsföderalismus, wo man auch versucht, jeden Vergleich zu vermeiden?!
Obskur auch die Gesetze, die gemacht wurden: Natürlich muss es möglich sein, bei einer gefährlichen Krankheit auch Grundrechte außer Kraft zu setzen, um die Bevölkerung zu schützen. Aber ohne jede Kontrollinstanz, einfach mit einem Federstrich der Regierung? Das erscheint wenig demokratisch. – Obskur auch die Übertragung von erstaunlichen Kompetenzen an die WHO im Falle einer kommenden Pandemie. Denn weder ist die WHO demokratisch, noch haben sich übernationale Organisationen in der Pandemie als handlungsfähig erwiesen. Das Heft hatten die Nationalstaaten in der Hand. Vermutlich ist die Übertragung von Kompetenzen an die WHO auch nicht völlig ernst gemeint. Aber sollte man Gesetze machen, die nicht völlig ernst gemeint sind? Was sagt das über die Gesetzestreue der Parlamentarier aus? Und über den Zustand unseres Rechtsstaates insgesamt?!
Im Vorfeld des zweiten Corona-Sommers kam eine völlig verrückte Diskussion auf, ob das Virus im Sommer nachlassen würde. Dabei hatte man schon im Sommer zuvor gesehen, dass das der Fall war. Wieso sollte es jetzt anders sein? Wozu diese irre Debatte?
Im Fernsehen – unter Ausschluss der Öffentlichkeit – zelebrierte der Bundespräsident eine seltsame Trauerfeier für die Corona-Toten. Doch wie viele waren es nun eigentlich? Darüber konnte niemand eine klare Auskunft erteilen. Im eigenen Umfeld kannte man niemanden, der an Corona gestorben war, und man kannte auch niemanden, der jemand kannte. Es war völlig surreal.
Und dann gab es die Zero-Covid-Idioten, die besonders scharfe Maßnahmen forderten, weil sie glaubten, das Virus ausrotten zu können. Doch das kann man nicht. Oder weil sie ein völlig falsches Verständnis von Risiko und Verhältnismäßigkeit hatten. Es sind dieselben Leute, die auch in ökologischen Fragen jedes Maß an Verhältnismäßigkeit und Realismus verloren haben. Irgendwie schafften diese Zero-Covid-Idioten es, die Debatte zu beherrschen, mithilfe sympathisierender Journalisten und gewissen fragwürdigen Aussagen von Drosten, auch wenn die Politik zum Glück kein völliges Null-Covid-Programm durchzog. Es war sonnenklar, dass diese Leute von einem autoritären Furor geleitet waren. Sie machten oft keinen Hehl daraus, dass sie auch die Klima-Problematik gerne autoritär „lösen“ würden, wenn man sie ließe. Das war sehr undemokratisch gedacht.
Die Impfung für alle erschien zunächst der logisch einzige Weg aus der Pandemie heraus. Mai Thi hatte auch dazu das richtige Video mit überzeugenden Argumenten. Jetzt sagte sie das, was ich mir schon am Anfang der Pandemie ausgerechnet hatte: „Flatten the Curve“ dauert ewig. Allerdings: Mai Thi sagte das erst nach der Wahl.
Doch irgendwann sickerte durch: Die Impfung verhindert eine Infektion gar nicht, und sie verhindert auch nicht die Weitergabe des Virus. Ein respiratorischer Virus kann durch eine Impfung gar nicht völlig abgewehrt werden, weil er die Schleimhäute immer erreicht. Die Impfung reduziert lediglich das Risiko eines schweren Verlaufs. Das ist nicht wenig, aber damit ging es nur noch um Eigenschutz, nicht mehr um Fremdschutz. Und damit fiel jedes Argument für eine Impfpflicht weg. Doch niemand diskutierte das. Man tat so, als gäbe es diese Schlussfolgerung nicht.
Und diese Information sickerte nur langsam durch, so wie viele Informationen und Wahrheiten in dieser Pandemie leider nur durchsickerten: Niemals stellte sich ein Politiker oder ein Drosten hin und verkündete, dass man bisher auf dem falschen Dampfer war und ab sofort neue Einsichten gelten. Sondern man veränderte die Positionen schrittweise und ganz heimlich, still und leise.
Später dann bekam Mai Thi ihre eigene Show im Öffentlich-Rechtlichen Fernsehen, und hier zeigte sie dann ihr wahres Gesicht: Ursprünglich hatte sie noch einen gewissen Anspruch. Sie war natürlich, vernünftig und menschlich, auch wo sie irrte. Doch dann gab sie sich für höchst einseitige Darstellungen her. Und dass sie in ihrem Impf-Video von einem Fremdschutz ausging, den es nie gab, dazu hat sie sich nie geäußert. Ebenso hat sie sich nie dazu geäußert, dass die Pandemie am Ende nicht durch die Impfung, sondern durch Omikron beendet wurde. Mai Thi könnte ja sagen, dass sie sich geirrt hat. Das wäre OK. Aber da kam nichts.
Unklar war auch, wie lange man eigentlich immun ist. Sowohl durch die Impfung, als auch durch eine durchgemachte Infektion. Bei Grippeviren dachte man immer, man sei auf Jahre immun, bei Corona waren es plötzlich nur 3-6 Monate. Wegen der Varianten. Aber es gibt doch Kreuzimmunitäten? Das alles war sehr verwirrend.
Schließlich sickerte auch die Information durch, dass die Impfung entgegen ersten Behauptungen auch Nebenwirkungen haben kann. Und dass so manches „Long Covid“ in Wahrheit wohl eher ein PostVac-Syndrom ist. AstraZeneca wurde schon während der Pandemie diskutiert, andere Probleme aber nicht. Die mRNA-Impfung scheint insbesondere ein Problem damit zu haben, zu kontrollieren, wie lange die Spike-Proteine zur Anregung einer Impfreaktion produziert werden. Und die Impf-Lipide mit der mRNA verteilen sich im ganzen Körper. Das alles ist bis heute ein einziges Dunkelfeld. Denn irgendwie scheint es keiner so genau wissen zu wollen.
Am Ende der Pandemie sickerte wiederum nur langsam durch, dass die Omikron-Variante des Virus nicht die große Katastrophe ist, sondern die Lösung des Problems. Doch diese Wahrheit wurde nicht ausgesprochen, und die Maßnahmen blieben noch lange in Kraft, obwohl Omikron das in keiner Weise mehr rechtfertigte. Im Ausland begann man über die Deutschen zu lachen, wie so oft in diesen Tagen, nicht nur wegen Corona.
Weitere Beobachtungen am Rande
Das sture Festhalten der Politik an den immergleichen Maßnahmen erinnerte an das Verhalten der Politik in vielen anderen Krisen: Auch in der Euro-Krise hieß es am Anfang, es gäbe ein einziges Griechenlandrettungspaket, und dann, wenn die Märkte sich beruhigt haben, würde alles geordnet abgewickelt. Schön und gut. Die geordnete Abwicklung kam aber nie, sondern es kam ein neues Griechenlandsrettungspaket nach dem anderen, bis man die Griechen mit soviel Krediten zuschüttete, dass die Krise heute gelöst erscheint. Sie ist es nicht. – In der Migrationskrise 2015 ging es anfangs nur um einige tausend Migranten am Budapester Bahnhof. Schön und gut. Danach kamen aber immer mehr und mehr. Merkel bekam die Tür nicht mehr zu. Sie wollte die Tür nicht mehr zu bekommen. Es ging immer weiter. Verrückt! Bis die Osteuropäer gegen den Willen Merkels die Tür dann schlossen. – Im Ukraine-Krieg ging es anfangs darum, dass Putins Aggression nicht belohnt werden darf, und dass wir die Ukraine mit Waffenlieferungen in eine Position der Stärke für Verhandlungen versetzen wollen. Schön und gut. Verhandelt wurde dann aber nie, sondern es wurden immer nur weitere Waffen geliefert, ohne eine Strategie, wohin das genau führen soll. – Und genau nach diesem Schema lief es auch bei Corona.
Plötzlich waren die Nationalstaaten wieder handlungsfähig. Sie nahmen das Heft des Handelns einfach in die Hand. Weil nur der Nationalstaat auch tatsächlich handlungsfähig ist, weil nur er einen politische Diskursraum für Demokratie bietet. Carl Schmitt lässt grüßen. – Angela Merkel konnte sogar plötzlich Deutschlands Grenzen schließen, was sie zuvor für unmöglich erklärt hatte. Es wurden sogar Grenzen zwischen Bundesländern aufgezogen, was eigentlich absurd ist. – Und es wurde auch eine Hackordnung der Nationalstaaten in der Welt sichtbar, von der man sonst wenig hört: Denn wer bekam die Impfstoffe zuerst? Natürlich die Angelsachsen. Erst danach die Kontinentaleuropäer. Das ist keine Kritik, es ist nur eine Beobachtung. So ist die Welt eben, und vielleicht ist es sogar gut, dass es so ist.
Die deutschen „Gutmenschen“ haben in der Pandemie einmal mehr ihr hässliches Gesicht gezeigt: Während sie sich sonst als die guten Europäer gerieren, stoppten sie aus reinem Eigennutz eine Lieferung von Masken nach Italien. Die Italiener, die zu dieser Zeit von Corona besonders betroffen waren, werden das sicher nicht gut aufgenommen haben. Immerhin übernahm man später einige Patienten aus Italien. – Etwas seltsam war auch, dass einige Parlamentarier, die die schnelle Beschaffung von Masken aus dem Ausland organisieren halfen und dafür handelsübliche Beraterhonorare nahmen, gekreuzigt wurden. Hätte man ihnen nicht danken müssen? Korruption und Bereicherung wäre es gewesen, wenn die Honorare nicht den üblichen Gepflogenheiten entsprochen hätten. – Die Briten wiederum stellten Gedankenspiele an, einen AstraZeneca-Impfstoff, der in den Niederlanden lagerte und von den Niederländern nicht herausgegeben wurde, mit militärischen Mitteln nach Großbritannien zu holen. Davon erfuhr man natürlich erst sehr viel später.
Auch die parteiliche Unfairness der Politik – und damit auch der Polizei – gegenüber Demonstranten verschiedener Art zeigte sich in der Pandemie besonders auffällig: Während man linksradikale Black-Lives-Matter-Demonstranten ohne Maske und auf engstem Raum demonstrieren ließ, wurden Demonstrationen von Corona-Kritikern unter strenge Auflagen gestellt und oft genug aufgelöst. Teilweise soll die Polizei die Corona-Kritiker so eingepfercht haben, dass sie die Abstandsregeln nicht einhalten konnten, was ihnen dann zum Vorwurf gemacht wurde. Schließlich schockieren heute noch die Bilder von Polizisten, die normale und friedliche Bürger, teils ältere Leute, brutal zu Boden stoßen. Oder mit Wasserwerfern bearbeiten. Es war immer klar, dass die Polizei politisch gesteuert wird und nicht jede Demonstration gleich behandelt. Aber so krass hat man es selten gesehen.
Last but not least entlarvte die Corona-Pandemie auch, wie sehr Deutschland schon in migrantische Parallelgesellschaften zerfällt. Denn ein großer Teil der Impfverweigerer waren gar keine Impfverweigerer. Es waren vielmehr Menschen mit Migrationshintergrund, die geistig-medial nicht in Deutschland leben, sondern in einem ganz anderen Land. Sie haben die Impfung oft einfach deshalb nicht mitgemacht, weil sie von ihr nichts gehört hatten. Es gab immer wieder größere Corona-Ausbrüche in Migranten-Communities, weil sich dort keiner an die Regeln hielt. Deshalb auch die Vorschläge, mit Impfbussen in die entsprechenden Viertel zu fahren. Einem Impfverweigerer ist mit einem solchen Angebot nicht beizukommen. Einem Impf-Ignoranten, der geistig-medial nicht „bei uns“ ist, jedoch schon. Im März 2021 las man, dass die Corona-Patienten auf den Intensivstationen weit überproportional Migrationshintergrund hätten. – Natürlich wurde dieses Problem wie immer vertuscht und kleingeredet, und es wurden natürlich keine Konsequenzen daraus gezogen. Wie Seyran Ates in ihrem Buch „Der Multikulti-Irrtum“ schon 2007 feststellte, scheitert die Lösung von Problemen in Deutschland oft schon daran, dass über die Probleme nicht gesprochen werden darf.
Dieses Buch bietet Erklärungen und mehr
Viele der oben aufgezählten Beobachtungen werden in diesem Buch bestätigt. Die Beobachtungen waren richtig. Und für manche der oben genannten Fragen wird eine überzeugende Erklärung geboten.
Im Zentrum stehen völlige falsche Anreizsysteme für die Beteiligten:
- Gewählte Politiker achten generell nicht auf medizinische Argumente, sondern immer nur auf die Stimmung im Land und vor allem auf die Stimmung unter den Journalisten, die meinungsmächtig sind. Dieser Regierungsstil ist gerade von Angela Merkel zur Perfektion gebracht worden. Politiker haben kein Interesse an genauen Daten und Statistiken. Diese stören nur beim Regieren nach Stimmung.
- Beamte wiederum flüchten sich nur allzu leicht in den Gehorsam gegenüber der Regierung. Hier diffundiert die Verantwortung zwischen Dienstherr und untergebenen Fachexperten, die es zwar besser wissen, aber nichts zu entscheiden haben. Beamte, die die Scharaden der Politik nicht mitmachen wollen, werden schnell gefeuert und geächtet, wie das Beispiel Hans-Georg Maaßen zeigt.
- Mitglieder von Beraterstäben und Gremien wie der Leopoldina Wissenschaftsakademie oder dem Ethikrat haben ein Interesse daran, der Politik und der Stimmung im Land nicht zu sehr zu missfallen, um ihren Beraterposten zu behalten und ihre Karriere nicht zu gefährden.
- Die etablierten Medien verfolgten wie immer eine linksliberale Agenda mit leicht autoritären Zügen: Gegen Corona-Schwurbler, gegen „rrrrächz“. Dadurch wird die gesellschaftliche Debatte in ein enges Korsett gepresst. In der Pandemie führte das zu einer Kommunikationskatastrophe. Legitime alternative Meinungen wurden nicht gehört, Menschen wurden ausgegrenzt, ein demokratisch absolut unerlässlicher Diskurs fand nicht statt, eine Korrektur von Irrtümern war nicht möglich. Es sind inzwischen diverse Absprachen und Einflussnahmen bekannt geworden, die den Ruf der Unabhängigkeit mancher Medien schwer beschädigt haben.
- Und die Krankenhäuser nutzten die Gelegenheit, sich gesundzustoßen: Sie rechneten Intensivbetten rauf und runter und kassierten für Betten ab, die es gar nicht gab bzw. die allenfalls verpackt im Keller standen. Die Politik ließ es durch Wegschauen geschehen.
Das Buch macht gleich am Anfang klar, dass es in Deutschland zu keinen Engpässen in den Krankenhäusern gekommen ist. Außerdem gibt es keine signifikanten Unterschiede zwischen Ländern und Regionen mit harten oder lockeren Maßnahmen, und zwar bei durchaus vergleichbaren Regionen. Vor diesem Hintergrund stellt sich die Frage, ob die Maßnahmen verhältnismäßig waren. Sie waren es – zumindest in dieser Form – ganz offensichtlich nicht.
Masken nützen durchaus: Gut, dass dieses Buch diese Tatsache festhält. Allerdings wird die Wirksamkeit der Masken dann zu sehr kleingeredet.
In diesem Buch wird Klarheit geschaffen darüber, dass die Laborthese für den Ursprung des Corona-Virus keinesfalls vom Tisch ist, wie Drosten behauptete, sondern höchstwahrscheinlich zutrifft, wie Professor Wiesendanger anhand vieler starker Indizien zeigen konnte. Dahinter steckt ein Netzwerk von Virenforschern, Pharmafirmen, des Pentagon, sowie von Philanthropen wie Bill Gates und seiner Stiftung. Diese Lobby betrieb eine gefährliche Virenforschung, die man zur Abwehr von Viren, aber auch für Biowaffen verwenden könnte. Diese Forschung fand in Wuhan statt, und das Corona-Virus „Sars-Cov-2“ entspricht ganz den Plänen und Patenten dieser Virenforschung. Man fasst es nicht. Es ist völlig naheliegend, dass das Virus in Wuhan aus dem Labor entwischt ist. Die Indizien dafür sind erdrückend. Es handelt sich um einen klassischen Laborunfall. Der Autor spricht völlig zurecht vom Tschernobyl der Virenforschung. Genau das ist es.
Zugleich forschte diese Lobby aber auch an neuartigen Impfstoffen auf der Basis der mRNA-Technologie: Der Impfstoff enthält nicht mehr die Proteine des Erregers selbst, wie bei klassischen Impfstoffen, sondern der Impfstoff enthält den Bauplan für diese Proteine, so dass der menschliche Körper diese Proteine dann selbst erzeugt. Was sich theoretisch gut anhört, hat in der Praxis aber noch nie funktioniert. Die Lobby hatte deshalb Pläne geschmiedet, die Gelegenheit der nächsten größeren Grippe-Pandemie dafür zu nutzen, um einen Hype auszulösen, der die Politik dazu bringen würde, die Hürden für die Zulassung der mRNA-Impfstoffe zu senken. Genau das geschah dann auch in der Corona-Pandemie: Die Gelegenheit wurde genutzt. – Allerdings ist zu beachten: Anders als geplant, war Corona mehr als nur eine größere Grippe. Es wäre möglich, dass der böse Plan in diesem Fall unfreiwillig seine Bosheit verlor, weil die moralische Abwägung in diesem Fall vielleicht doch zugunsten des Impfstoffs ausfiel. So viel Differenzierung muss sein. Dazu unten mehr
Was ich vor der Lektüre des Buches noch nie gelesen hatte: Dass ein Impfen in zu kurzen Abständen zu einer Desensibilisierung führen kann. Ein zu häufiges Impfen mit Corona-Impfstoffen kann das Immunsystem gegen Corona schwächen statt stärken. Ein sehr bedenkenswertes Argument, das glaubwürdig genug klingt, um zumindest öffentlich diskutiert zu werden. Dass ich davon zuvor noch nichts gehört hatte, ist sozusagen der eigentliche Skandal, unabhängig davon, wie viel am Ende an der These dran ist.
Das Buch schafft aber auch ein Bewusstsein dafür, wieviele Menschen völlig unverhältnismäßig geschädigt worden sind. Teilweise liegen die Zahlen im Dunkeln, aber die Schäden sind groß, das ist klar:
- Die Zwangsimpfung für Pflegepersonal, Ärzte und Soldaten stürzte in Gewissensnöte und zerstörte Karrieren, obwohl die Impfung eine Übertragung des Virus nicht verhinderte und damit jeder Grund für eine Impfpflicht entfiel.
- Der Lockdown bedeutete für viele Berufe ein Berufsverbot. Existenzen wurden vernichtet. Soldaten sitzen jetzt noch (Oktober 2024) im Gefängnis, weil sie die Impfung verweigern.
- Es wurde extrem viel Geld ausgegeben, um Menschen das Nichtstun zu ermöglichen. Dafür muss natürlich der Steuerzahler aufkommen.
- Kritiker wurden pauschal als Schwurbler und Rechtsradikale verunglimpft und ausgegrenzt. Ihnen wurde zudem die Schuld an Lockdown und Tod zugewiesen, sprich: Es wurde gegen sie gehetzt.
- Kindern wurde Angst eingejagt, sie könnten ihre Großeltern anstecken.
- Schüler mussten einen ganzen Schultag mit FFP2-Masken verbringen: Eine Tortur.
- Im Lockdown wurden Kinder isoliert und es kam vermehrt zu häuslicher Gewalt.
- Menschen mit PostVac-Syndrom werden bis heute mit ihren Problemen allein gelassen.
Es ist auch erschreckend zu sehen, wie Humanismus und Aufklärung in der Gesellschaft zusammenbrachen:
- Diverse Argumente und Thesen wurden öffentlich vertreten und blieben in den etablierten Medien unhinterfragt stehen, obwohl sie bereits mit wenig Aufwand als unzureichend oder glatt falsch hätten erkannt werden können.
- Wir erfahren von vielen warnenden Stimmen von Professoren, Beamten, Politikern und Ärzten, die Einspruch zu erheben wagten und dafür verleumdet und mundtot gemacht wurden, von ihren Institutionen Redeverbot bekamen oder gleich ganz rausgeworfen wurden: Es sind erschreckend viele! Es gab auch einige Suizide in diesem Zusammenhang. Wie konnte es in einer aufgeklärten Gesellschaft zu einer solchen Cancel Culture kommen? Widerspruch muss ertragen werden, ohne dem Andersdenkenden an die Existenz zu gehen. Diese Gesellschaft ist nicht mehr so aufgeklärt, wie sie tut.
- Ärztliche Atteste wurden schlicht ignoriert, ja sogar verlacht.
- Ärzte, die Maskenbefreiung u.a. Maßnahmen verschrieben, mussten mit dem Staatsanwalt rechnen.
- Lehrer benahmen sich gnadenlos gegenüber ihren schutzbefohlenen Schülern.
- Menschen mussten einsam sterben, Angehörige wurden nicht vorgelassen.
- Viel zu viele Politiker, Ärzte, Gesundheitsfunktionäre, Beamte haben die Verantwortung, die sie hatten, einfach abgeschoben bzw. sich die Verantwortung allzu leicht nehmen lassen.
- Der Ethikrat hatte völlig versagt, eine Farce.
- Die Kirchen machten zu statt auf, ließen die Leute alleine, und stellten sich an die Seite der Mächtigen, gegen Kritiker. Sie versagten genauso wie der Ethikrat.
- Besonders schlimm waren die Verhältnisse in Altenheimen oder Waisenhäusern. Alte und Kinder wurden gnadenlos isoliert, mussten einsam und verlassen sterben oder blieben tage- und wochenlang ohne notwendige Zuwendung. Hauptsache, die Vorschriften wurden eingehalten.
- Korruption blieb von den etablierten Medien unbeachtet: So bekam der Ehemann von Ursula von der Leyen einen gutbezahlten Job bei der Pharmafirma Orgenesis, die von der EU Gelder aus dem Corona-Wiederaufbaufonds bekam.
Die Aufarbeitung der Probleme kommt nur schleppend voran:
- Eine systematische Aufarbeitung z.B. durch einen Untersuchungsausschuss des Parlamentes ist bis jetzt nicht zustande gekommen.
- Transparenz muss bis heute abgetrotzt werden, durch Klagen vor Gericht oder durch Wistleblower (z.B. RKI-Files).
- Politiker, Journalisten und Mediziner beginnen zurückzurudern, ziehen sich dabei aber auf ein Standardargument zurück, das oft nicht haltbar ist: Dass man es anfangs nicht besser hätte wissen können. Teilweise konnte man das aber doch, wie dieses Buch aufzeigt.
- Zugegeben wurde z.B. bereits, dass die langen Schulschließungen ein Fehler waren. Aber ohne dass dies Konsequenzen gehabt hätte.
- In Mediatheken und Zeitungsarchiven verschwinden plötzlich Beiträge, die ex post betrachtet keinen guten Eindruck machen.
Kritik an diesem Buch
Kommen wir nun zu der Frage, was an diesem Buch übertrieben oder falsch ist. Es ist dabei interessant zu wissen, dass der Autor Gunter Frank, der als Hausarzt arbeitet, schon lange vor Corona ein Medizinkritiker war und manchmal in Talkshows auftrat. Seine Kritik richtete sich insbesondere gegen falsche ökonomische Anreize im Gesundheitswesen: So geschieht es z.B., dass sich die Pharma-Lobby durch die Senkung von Normwerten neue Patienten erschließt, die gewissermaßen krank definiert werden, statt wirklich krank zu sein. Der Autor äußerte sich auch zu der sattsam bekannten Fragestellung, welche Vorsorgeuntersuchungen sinnvoll sind, und wie oft. Oder zur Frage der Notwendigkeit von FSME-Impfungen gegen Zeckenbisse: Weil die Zahl der Schadensfälle sehr gering ist, stellt sich auch hier die Frage nach dem Kosten-Nutzen-Verhältnis. Genau dieselben Fragestellungen tauchen beim Thema Corona natürlich ebenfalls auf.
Kritik: Statistik
Mit statistischen Aussagen ist in der Corona-Pandemie von allen Seiten extrem viel Schindluder betrieben worden. Teilweise mag dies auch auf echte Denkfehler zurückzuführen sein, denn Statistik ist nicht jedermanns Sache. Es wäre zu wünschen, dass jemand eine Internet-Seite aufmacht, auf der er alle typischen Statistik-Irrtümer der Corona-Pandemie systematisch aufgelistet und widerlegt werden. Ein Klassiker ist z.B. die Aussage, dass mehr Geimpfte als Ungeimpfte im Krankenhaus liegen, verbunden mit der irrigen Schlussfolgerung, dass die Impfung wohl die Ursache dafür sein müsse. Ebenfalls klassisch ist der Irrtum sowohl von Corona-Kritikern als auch des etablierten Narrativs: Während die Corona-Kritiker oft nicht verstanden haben, dass Corona am Anfang tatsächlich etwas schlimmer war als eine Grippe-Welle, haben die Anhänger des etablierten Narrativs oft nicht verstanden, dass Corona mit dem Auftreten der Omikron-Variante harmlos geworden war. Auch dieses Buch ist nicht frei von derartigen Irrtümern.
Was der Autor dieses Buches völlig ungesagt lässt, ist der Umstand, dass Länder und Regionen, in denen es keine Zwangsmaßnahmen gab, dennoch sehr wohl Maßnahmen durchführten, nur eben lockere und freiwillige Maßnahmen. So begannen in Deutschland viele Bürger und Organisationen schon vor dem ersten Lockdown mit einer freiwilligen, Panik-getriebenen Isolation, weshalb die Infektionszahlen schon vor dem Lockdown zu fallen begannen. Das heißt aber nicht, dass die Maßnahmen, die der Lockdown verpflichtend machte, nichts nützen würden. Es scheint vielmehr so zu sein, dass es zwischen freiwilligen, lockeren Maßnahmen und strengen Zwangsmaßnahmen keinen signifikanten Unterschied im Effekt zu geben scheint. Länder „ohne Maßnahmen“ waren eben keine Länder ohne Maßnahmen, sondern Länder „mit“ Maßnahmen, nämlich mit freiwilligen Maßnahmen. – Es ist deshalb richtig, die strengen Zwangsmaßnahmen zu kritisieren und auf Freiwilligkeit zu setzen, es ist aber nicht richtig, so zu tun, als hätten die Maßnahmen überhaupt nichts genützt. Das ist falsch.
Der Autor stellt mit Recht fest, dass es im ersten Corona-Jahr keine Übersterblichkeit gegeben hatte, während man heute noch überall lesen kann, dass es angeblich eine Übersterblichkeit von mehr als 70.000 Toten gegeben habe, was falsch ist. Aber der Autor macht es sich zu einfach. Denn es muss bedacht werden, dass es sehr wohl eine hohe Sterblichkeit durch Corona gab, die allerdings durch die Maßnahmen ausgeglichen wurde (weniger Unfalltote, weniger Herzinfarkte, verschobene Operationen usw.), so dass es nur unter dem Strich keine Übersterblichkeit gab. – Im Oktober 2021 stellte eine Forschergruppe der Universität Duisburg-Essen eine demographisch bereinigte Übersterblichkeitsrechnung vor, derzufolge es 34.000 Corona-Tote im Jahr 2020 gab. Das ist deutlich mehr als eine normale Grippewelle, die jährlich knapp 20.000 Tote fordert. Zum Vergleich: Die Asiatische Grippe von 1957 forderte 30.000 Tote in Westdeutschland, die Hongkong-Grippe von 1968 ca. 50.000 Toten in Ost- und Westdeutschland zusammen. Beide Grippewellen rauschten damals ohne größere Maßnahmen durchs Land. Vielleicht muss man die Zahl von 34.000 Corona-Toten auch noch durch zwei teilen (ähnlich wie es der Autor des Buches mit Corona-Fallzahlen tut), um den wahren Wert nahezukommen. Dann wäre man mit ca. 17.000 Corona-Toten ziemlich genau auf dem Niveau einer normalen Grippe-Welle. – ABER: Hätte man keinerlei Maßnahmen ergriffen, wären die Zahlen natürlich deutlich höher ausgefallen als nur 34.000 (oder 17.000) Tote. Zu beachten ist auch, dass die Zahl der Toten am Anfang unnötig hoch war, weil eine falsche Behandlung angewendet wurde. Allerdings muss demgegenüber wiederum bedacht werden, dass diese falsche Behandlung nun einmal leider angewendet wurde, und die Zahl der Toten deshalb nicht nur rein rechnerisch so hoch lag, sondern ganz real, und dass diese Toten deshalb auch real verhindernswert waren. In Deutschland scheint die Behandlung recht schnell besser geworden zu sein. So schlimm wie in Bergamo war es in Deutschland nie. – Der Autor irrt also, wenn er Corona nur als „mittlere Grippe“ einstuft. Es war schlimmer, wenn auch nicht so schlimm, wie manche damals meinten, sondern etwas dazwischen. Auf dieses „dazwischen“ scheinen sich beide Seiten nicht einigen zu können. – Es ist richtig, die Unterbelegung der Krankenhäuser und die strengen Maßnahmen zu kritisieren, aber die bessere Alternative hätte nicht in gar keinen Maßnahmen bestanden, sondern z.B. in abgestuften und freiwilligen, lockeren Maßnahmen, die zu einer richtigen Balance bei der Auslastung der Krankenhäuser geführt hätten.
Die Zahlen der Phase-III-Zulassungsstudie von Pfizer / BionTech werden vom Autor falsch interpretiert. Dabei gab es zwei Testgruppen zu je ca. 22.000 Personen. Die eine Gruppe bekam die Impfung, die anderen Gruppe nur ein Placebo. In der Placebo-Gruppe wurden daraufhin 162 Corona-Fälle gezählt, in der Impf-Gruppe hingegen nur 8. Daraus schloss Pfizer auf einen Schutz vor Corona von 95%, weil 8 : 162 = 5%. Der Autor rechnet nun so, dass er zunächst die vermiedenen Fälle berechnet: 162 – 8 = 154, und dann die 154 durch die Gesamtzahl der Gruppenteilnehmer von 22.000 teilt, also 154 : 22.000 = 0,7%. Diese Zahl nennt er die „Wirksamkeit“ (S. 120). – Doch diese Rechnung ist falsch, wie wir gleich sehen werden. Vielmehr ist die Rechnung von Pfizer durchaus richtig, es wurde im Prinzip ein Schutz von 95% erzielt. Die richtige Kritik an Pfizer lautet so: Man muss die kleinen Zahlen bedenken, auf denen diese Kalkulation beruht, nämlich nur 8 bzw. 162 Fälle. Das spricht für einen hohen statistischen Fehler. Es wäre z.B. durchaus möglich, dass der Schutz nur bei 75% liegt. Das ist die richtige Kritik an den Zahlen von Pfizer. – Die Rechnung des Autors ist hingegen unsinnig. Es lässt sich vermuten, dass er diese Rechnung analog zu einer Rechnung konstruiert hat, die er in einer Talkshow zum Thema Brustkrebsvorsorge vorgeführt hat (Talk 3nach9, Radio Bremen, 2014): Dort gab es auch zwei Gruppen von Patienten zu je 1000 Teilnehmern. In der Vorsorgegruppe starben 6 an Brustkrebs, in der Gruppe ohne Vorsorge starben 8. Die Befürworter der Vorsorgeuntersuchung sagen, dass das Risiko, an Brustkrebs zu sterben, durch die Vorsorgeuntersuchung um 25% gesenkt würde (von 8 auf 6). Das stimmt auch, wenn auch mit großer statistischer Unsicherheit aufgrund der kleinen Zahlen. Der Autor hingegen sagt, dass das Risiko in absoluten Zahlen nur um 0,2% gesenkt wurde, nämlich von 8 : 1000 auf 6 : 1000, also von 0,8% auf 0,6%. Auch diese Aussage stimmt, der Autor hat Recht: Für die Brustkrebsvorsorge stimmen diese Zahlen. Aber man darf diese Überlegung nicht auf die Corona-Impfung übertragen. Denn die meisten der zweimal 1000 Teilnehmer der Brustkrebsuntersuchung werden nie Brustkrebs bekommen. Die zweimal 22.000 Teilnehmer der Corona-Impfstudie werden jedoch alle früher oder später Corona bekommen.
Dass die Zulassung des Impfstoffs mit heißer Nadel gestrickt war, war allen denkenden Menschen klar. Der Autor lässt allerdings unerwähnt, dass die israelische Bevölkerung den Impfstoff auch deshalb als erste bekam, weil sich Israel gewissermaßen als Testlabor für die Impfung zur Verfügung gestellt hatte. Als der Impfstoff dann in Deutschland ausgerollt wurde, konnte man sagen, dass alle kurz- und mittelfristigen Risiken bereits bekannt waren. Sie waren klein genug, um die Ausrollung des Impfstoffs zu wagen. Denn man muss das Risiko der vulnerablen Gruppen, an Corona zu versterben, dagegen stellen. Dieses Risiko wurde durch den Impfstoff gesenkt. – Richtig ist allerdings, dass ein Ausrollen des Impfstoffs an nicht-vulnerable Gruppen oder gar eine Impfpflicht auf dieser Grundlage keine Rechtfertigung hat. Der Autor hat sehr wohl gute Punkte, es ist allerdings nicht immer ganz so dramatisch, wie er meint. Es ist aber immer noch dramatisch genug.
Die These, dass man nicht in eine Infektionswelle hinein impft, ist sicher richtig, aber gilt sie auch in jedem Fall? Die Impfung half bekanntlich beim Eigenschutz der vulnerablen Gruppen. Es gab also auch Gründe für die Impfung während einer laufenden Infektionswelle. Am Ende hätte man beide Effekte gegeneinander abwägen müssen. Wir wissen nicht, wie diese Abwägung ausfallen würde.
Zu den Folgeschäden der Impfung (PostVac-Syndrom) kann der Autor nur Indizien aufzählen. Ob es wirklich ein größeres Problem gibt, ist unklar. Klar ist auch, dass die Corona-Impfung viel mehr Aufmerksamkeit bekommt als irgendeine andere Impfung. Auch deshalb gibt es viel mehr Meldungen, von denen sich sehr viele – anders als bei anderen Impfungen – als falscher Alarm erweisen. Die Berichte darüber, dass man auch hier gar nicht wissen will, wie die Wahrheit aussieht, sind allerdings sehr bedenklich. – Richtig ist also, dass die Frage nach den Folgeschäden der Impfung vermauschelt wird und offensiv angegangen werden müsste. Was dabei herauskäme, wissen wir jedoch nicht.
Der Rückgang der Geburtenrate dürfte kaum mit gesundheitlichen Schäden durch das Corona-Virus oder durch die Impfung zusammenhängen. Hier sind Zahlen aus der Schweiz hilfreich: Der Rückgang der Geburtenrate, den es tatsächlich gibt, hat z.B. damit zu tun, dass sich während Corona viele Paare für ein Kind entschieden, die jetzt unmittelbar nach Corona natürlich nicht sofort noch ein Kind bekommen möchten. Auch die Fertilitätsrate ist nicht gesunken. Es gibt keine Zunahme von Patienten mit unerfülltem Kinderwunsch. – Bedenklich sind die klaren Zahlen von Frühgeburten bei geimpften Schwangeren.
Kritik: Nicht Verschwörung sondern Lobby – Nicht Verbrechen sondern Versagen
Es hat fraglos eine „Verschwörung“ einer gewissen Lobby zur Vertuschung der Laborherkunft des Virus und zur Durchsetzung der mRNA-Impfstoffe gegeben. Allerdings stellt sich die Frage, ob das jetzt was ganz Großes und Neues ist. Denn eigentlich ist das nicht so. Dass sich gewisse Lobbies aufbauen, um irgendetwas durchzusetzen, kennen wir aus zahllosen Fällen. Man denke nur an die Graichen-Connections zur Durchsetzung Erneuerbarer Energien, die kürzlich enthüllt wurden: Von US-Milliardären bis hin zu deutschen NGOs hängt dort alles mit drin, und es geht um gigantische ökonomische Verschiebungen zuungunsten der Menschen. Dasselbe ließe sich über die Migrationslobby von „Seenotrettern“ und Multikultifanatikern sagen. Man könnte auch noch BlackRock nennen, die mithilfe des „Drehtüreffekts“ ehemalige Mitarbeiter in die Politik schleusen, und dort Lobbyarbeit für BlackRock betreiben. Kurz: Es gibt zahllose Beispiele. – Und die Vorgänge um Corona sind hier (leider) nur ein weiteres Beispiel. Ja, es ist ein Skandal, man sollte ihn aber auch nicht zu hoch hängen.
Man sollte sich auch klarmachen, dass die „Verschwörung“ nur halb so schlimm ist, wie es aussieht: Das Virus wurde nicht mit Absicht aus dem Labor in Wuhan freigesetzt. Es war ein Unfall. Der Vergleich zu Tschernobyl ist sehr treffend. Die Ursache für solche Unfälle sind ein Versagen des Staates und der Gesellschaft. Die „Verschwörung“ bezieht sich auf die Fahrlässigkeit vor dem Unfall und auf die Vertuschung des Unfalls, nicht auf den Unfall selbst.
Und auch bei der mRNA-Impfung ist der Schaden womöglich geringer, als gedacht. Denn wie oben schon gesagt: Die Verschwörer hatten zwar einen üblen Plan für eine vereinfachte Zulassung von mRNA-Impfstoffen, den sie anlässlich einer größeren Grippe-Welle ausführen wollten. Doch anders als geplant, war Corona mehr als nur eine größere Grippe. Es wäre deshalb möglich, dass der böse Plan in diesem Fall unfreiwillig seine Bosheit verlor, weil die moralische Abwägung in diesem Fall vielleicht doch zugunsten des Impfstoffs ausfällt. So viel Differenzierung muss sein. Der Impfstoff hatte immerhin die Funktion des Eigenschutzes, in dem das Risiko eines schweren Verlaufes reduziert wurde. Es ist möglich, dass Zehntausende Menschen ihr Leben dem Impfstoff verdanken. Das ist nicht wenig, und muss gegen Impfrisiken aufgewogen werden.
Und jenseits der Virenforschungslobby gab es nur das übliche Versagen, aufgrund der genannten Mechanismen, wie oben dargestellt. Auch systemische Fehlanreize entschuldigen kein Fehlverhalten, aber ein Versagen ist nun einmal nur ein Versagen und kein geplantes Verbrechen. Das Wort „Verbrechen“ ist in diesem Zusammenhang irreführend. Natürlich ist auch ein Versagen teilweise strafrechtlich relevant. Aber es fehlt die gezielte Absicht, der verschwörerische Plan. Der Titel des Buches „Staatsverbrechen“ ist deshalb schlecht gewählt. Besser hätte man von einem „Zusammenspiel von Lobby und Staatsversagen“ gesprochen: Das war es.
Dieselbe Übertreibung im Inneren des Buches: Unter der Überschrift „Der Hype wird zum Menschheitsverbrechen“ (S. 180) wird zunächst berichtet, dass Bill Gates, Anthony Fauci und ein Virenforschungslobbyist oft gemeinsam auf Fotos zu sehen sind. Damit mogelt sich der Autor um Belege herum, was diese drei nun im Einzelnen wirklich getan haben. Das ist nämlich unklar. – Weiter ist von einer strategischen Planung die Rede zur Einteilung der Menschen in Geimpft und Ungeimpft. Solche Pläne gab es, doch ist ihre lokale Implementierung aufgrund dieser Pläne fraglich. Die lokalen Behörden sind keine Befehlsempfänger einer Weltzentrale, wie sich in der Corona-Pandemie klar gezeigt hat. – Schließlich: „Zusammen mit dem Genimpfzwang hebt dies die Covid-Impfkampagne von einem organisierten Verbrechen in die Dimension eines Verbrechens gegen die Menschheit.“ – Und hier muss man sagen: Nein, so geht das nicht. Die Wahrheit sieht erheblich komplizierter aus.
Man könnte vielleicht sagen, dass die Virenforschung in Wuhan, die Tschernobyl-artig schiefging, ein Menschheitsverbrechen war. Gut. Aber weder wurde das Virus absichtlich freigesetzt. Noch waren die mRNA-Impfstoffe nutzlos. Die Probleme liegen in den vom Autor genannten Punkten nicht im Großen und Ganzen, sondern in Teilfragen: Warum hat man nicht nur die vulnerablen Gruppen geimpft, sondern auch junge und gesunde Menschen? Wie sieht die Nutzen-Schaden-Abwägung der Impfstoffe wirklich aus? Warum waren die staatlichen Akteure so schlecht aufgestellt, dass sie vielen Fehlanreizen unterlagen? Warum haben manche Staaten freiwillige Maßnahmen erlassen, andere hingegen Zwangsmaßnahmen? Es gibt Probleme und auch Straftaten, aber diese sind alle eine Nummer kleiner, als der Autor annimmt. Nur die Virenforschung in Wuhan an sich könnte als Verbrechen größeren Ausmaßes eingestuft werden. Das alles muss unterschieden werden.
Kritik: Aufarbeitung durch Strafverfolgung?
Der Wunsch nach Strafverfolgung ist verständlich: Es sind ja auch tatsächlich strafbare Handlungen geschehen. Außerdem könnte man durch eine Strafverfolgung ein Zeichen für die Zukunft setzen: So nicht!
Aber der Wunsch nach einer Aufarbeitung durch Strafverfolgung ist politisch unklug. Denn auch hier muss man eine Abwägung vornehmen: Wie wahrscheinlich wird es eine Aufarbeitung geben, wenn Strafverfolgung droht? Wahrscheinlich eher nicht. Es wäre klug, einen Deal zu machen: Wahrheit und Transparenz („Alles auf den Tisch“) sowie Rehabilitierung gegen Verzicht auf Strafverfolgung. Das hätte eine größere Chance. Wichtiger als Bestrafung ist Transparenz und die Beschämung für alles, was falsch lief. Diese Beschämung setzt den Maßstab, weniger eine Strafe. Eine Strafe könnte auch nie den angerichteten Schaden wiedergutmachen.
Es gibt aber noch einen weiteren Grund für einen weitgehenden Verzicht auf Strafverfolgung: Denn viele Akteure haben nicht mit direkter Absicht getan, was sie getan haben, sondern weil die systemischen Anreize sie dazu verleitet hatten. Und weil die systemische Auslese des Personals in Deutschland inzwischen so schlecht ist. Inkompetenz im Amt kann man schlecht mit der Strafjustiz bekämpfen.
Eine Strafverfolgung sollte man für besonders schwere Delikte vorbehalten, in denen auch klar mit Vorsatz gehandelt wurde. „Kleine“ und „große“ Delikte klug voneinander abzugrenzen wäre eine der Aufgaben, die eine gelungene Aufarbeitung zu leisten hat.
Kritik: Verschiedenes
Manche wichtige Information wird in diesem Buch nur am Rande gegeben, und es fehlen Belege. So z.B. die Behauptung, dass die Spike-Proteine des Virus bei einer milden Infektion nicht in den Körper eindringen würden, während sie das bei einer Impfung in jedem Fall tun und im Extremfall überall im Körper auftreten würden. Ob man das wirklich so klar voneinander trennen kann? Kommen schwere Verläufe der Infektion seltener vor als eine aus dem Ruder gelaufene Impfung? Das ist die Frage. Sie wird in diesem Buch nicht beantwortet.
Die These, dass eine Impfung gegen Corona nur für kurze Zeit wirkt, ist fraglich. Es ist sicher richtig, dass die Impfung gegen neue Varianten weniger wirkt. Aber dass sich der Impfschutz in wenigen Monaten komplett verliert, ist unglaubwürdig. So läuft es bei normalen Grippe-Viren ja auch nicht: Die Immunität bleibt viele Jahre erhalten.
Es erscheint wenig hilfreich, dass dieses Buch auffällig plakativ mit den Worten „Biowaffe“ und „Gentherapie“ arbeitet. Beide sind nicht völlig falsch. Aber der Corona-Virus war keine Biowaffe. Die Impfung ebenfalls nicht. Und das Wort „Gene“ triggert nur weniger gebildete Menschen. Mit solchen Triggerworten sollte man nicht arbeiten, wenn man zur Sache spricht.
Zusammenfassung
Der Autor ist oft zu knapp in seiner Argumentation und etwas zu forsch in seinen Schlussfolgerungen. Es ist zwar meistens etwas dran an seiner Kritik, aber oft stellt es sich dann als nicht ganz so dramatisch dar, wie es zunächst den Anschein hat. Es ist aber immer noch dramatisch genug. Der Autor hat sich das Prädikat „Viertelsschwurbler“ deshalb redlich verdient, im Guten wie im Bösen.
Damit ist dieses Buch eine gute Vorlage, noch einmal gründlich alles zum Thema Corona zu überdenken. Man sollte es jedoch nicht unreflektiert für bare Münze nehmen. Die Wahrheit liegt zwischen den Extremen. Nicht immer in der Mitte, aber dazwischen. Alle Seiten sollten „abrüsten“ und sich auf die Suche nach diesem „dazwischen“ machen.
Eine Aufarbeitung sollte beginnen. Diese sollte sich Transparenz, Beschämung und Rehabilitierung als oberstes Ziel setzen, nicht jedoch Strafe. Und sie sollte Handlungsempfehlungen für die Gestaltung von Strukturen und Abläufen im Staat erarbeiten. Denn offenbar hat es ein Staatsversagen gegeben, dem durch Reformen von politischen und behördlichen Strukturen begegnet werden muss.
Diese Reform weist weit über das Thema Corona hinaus, denn inzwischen sehen wir ein Staatsversagen in allen Bereichen, Stichwort: Merkelismus. Nicht nur Strukturen sind falsch, sondern der Geist ist falsch und muss erneuert werden. Die Corona-Krise ist in diesem Sinne nur eine von mehreren Teil-Krisen einer viel größeren Krise, die unser Gemeinwesen erfasst hat. Symbolisch steht dafür in unseren Tagen der Zustand der Deutschen Bahn. Man muss sich die Corona-Politik wie eine Bahnfahrt durch ganz Deutschland unter den aktuellen Bedingungen und Zuständen der Deutschen Bahn vorstellen.
Forschungsfrage zum Schluss
Bekanntlich wurde die Corona-Pandemie nicht durch die Impfung, sondern durch die Omikron-Variante des Virus beendet, die sich durch einen meist milden Verlauf der Krankheit auszeichnete. Die Frage ist, ob diese Variante durch Zufall entstanden ist? Denn immerhin stammte das ursprüngliche Virus aus dem Labor. Dort ging es auch um Biowaffenforschung. Es ist absolut plausibel davon auszugehen, dass man im Rahmen dieser Forschung auch der Frage nachging, ob man eine Pandemie durch eine künstlich erzeugte milde Variante eines Virus stoppen kann. Das würde die Frage aufwerfen, ob die Omikron-Variante womöglich gar nicht auf natürlichem Weg entstand, sondern gezielt erzeugt wurde, um die Pandemie zu stoppen? Diese Frage ist natürlich Spekulation. Aber es ist eine berechtigte Frage.
Bewertung: 3 von 5 Sternen.