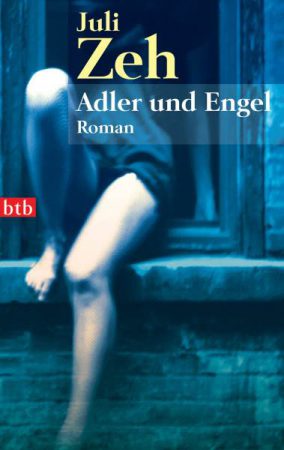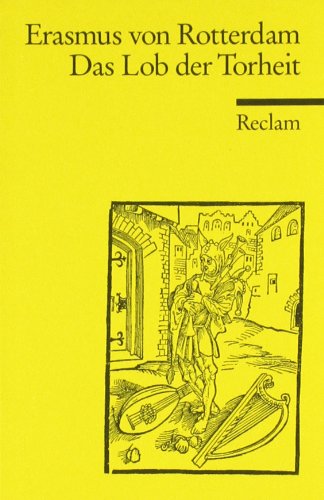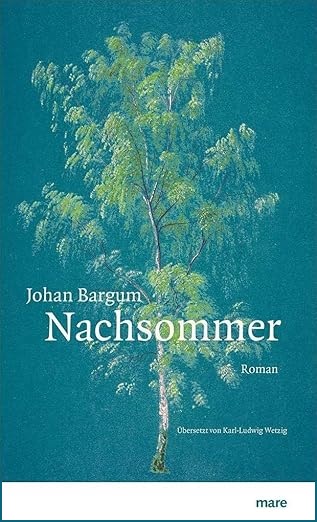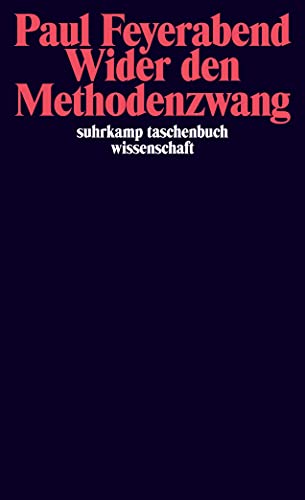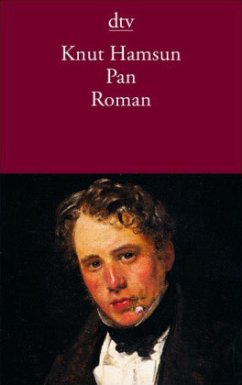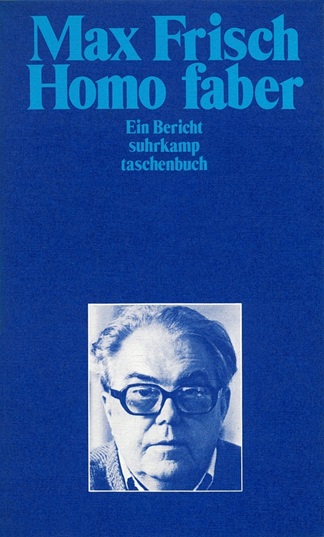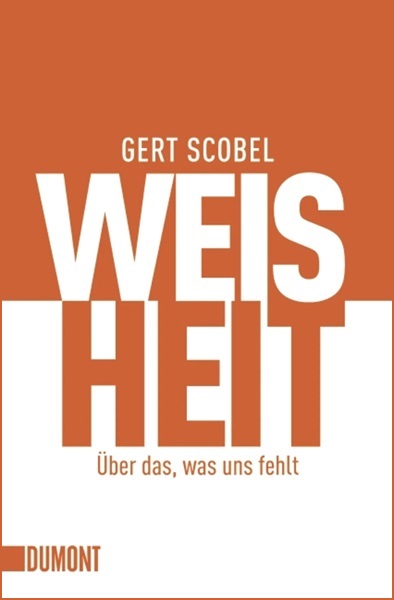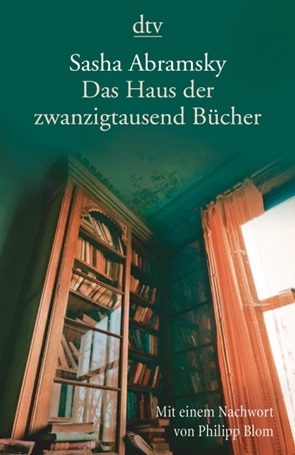Hymne auf den faschistischen Charakter – ein schreckliches Buch
Die Erzählung „Pan“ von Knut Hamsun ist keine Liebesgeschichte, wie vielfach behauptet wird, sondern die Geschichte eines äußerst merkwürdigen jungen Mannes. Es geht um Leutnant Thomas Glahn, Ende 20, der im größten Teil des Buches im Norden Norwegens gezeigt wird: Bei einem offenbar monatelang ausgedehnten Aufenthalt auf einer Hütte am Waldrand, nahe einer kleinen Ansammlung von Häusern „in the middle of nowhere“.
Am Anfang finden wir Thomas Glahn in einsamer Harmonie mit der Natur. Doch fragt sich der Leser, wie denn ein junger Mann Ende 20 ein solches Leben führen kann?! Monatelanges Nichtstun! Diese Form des Lebens eignet sich für Kinder, die geistig noch nicht erwacht sind, oder für Rentner, die in ihrem Leben schon genug geleistet haben, um gelassen darauf zurückblicken zu können. Aber so lebt und denkt doch kein lediger junger Mann Ende 20! Ein solcher sollte tunlichst einen inneren Drang danach verspüren, etwas zu werden und zu bewegen und zu erreichen in der Welt. Man fühlt sich spontan an den „Aufstand der Massen“ von Ortega y Gasset erinnert, der als eines der Symptome des Heraufdämmerns des Faschismus in Europa den „zufriedenen jungen Herrn“ nennt. Einen solchen sollte es nämlich eigentlich gar nicht geben, und wo es ihn doch gibt, da ist er ein Symptom für eine Krankheit der Gesellschaft.
Dann finden wir Glahn verliebt in Edvarda, die Tochter des örtlichen Kleinkrämers. Diese Liebesgeschichte nimmt sich jedoch sehr merkwürdig aus. Sie ist etwa 16, er kurz vor 30, also ungefähr doppelt so alt. Dieser Altersunterschied ist in jungen Jahren von einigem Gewicht. Im Grunde „vernarrt“ sich Glahn in die junge Frau, „Liebe“ ist das falsche Wort. Es entwickelt sich eine Art von Liebelei, aber er kommt nicht richtig aus sich heraus, und sie ignoriert ihn immer wieder systematisch, und man weiß nicht, warum. Das ganze macht schon einen sehr verklemmten Eindruck. Von beiden Seiten.
Nach dem ersten Drittel des Buches erfährt man, dass Edvarda in Wahrheit 20 Jahre alt sein soll. Sie sei ein ungezogener Charakter und liebt es angeblich, sich die Wirklichkeit irrational zurechtzubiegen, und ihre Umgebung zu manipulieren und nach ihrer Pfeife tanzen zu lassen. Doch gegen Ende des Buches erfährt man, dass Edvarda während des Sommers gewachsen war: Sie kann also nicht 20 gewesen sein, sondern wohl doch eher 16. Da der Erzähler in diesem Teil Glahn selbst ist, hat er uns wohl angelogen.
Glahn nimmt die Frauen wie im Flug für sich ein, und es sind jeweils die Frauen, die den ersten Schritt auf ihn zu machen. Neben Edvarda entwickelt sich auch eine Liebelei mit Eva, der Tochter des Schmieds, die sich als die Ehefrau des Schmieds entpuppen wird, und ganz am Rande auch noch eine Henriette, von der wir nicht viel erfahren. Es ist mit diesen Liebeleien ein ewiges Hin-und-her, auch Eifersucht spielt natürlich hinein, doch teilweise vergisst Glahn seine Freundinnen auch erstaunlich schnell wieder. Frauen tauchen in diesem Buch durchweg als dienstbare Geister ihrer Väter und Ehemänner auf; selbständiges Denken ist hingegen nicht gefragt, aber das ist bei diesem Buch auch kein Wunder, wie wir gleich sehen werden.
Eine weitere Merkwürdigkeit ist Glahns Unfähigkeit, sich in Gesellschaft geschickt zu benehmen. Doch dabei bleibt es nicht: Glahn begeht wiederholt völlig aus dem Ruder laufende Unvernünftigkeiten:
- Glahn wirft unvermittelt den Schuh von Edvarda vor aller Augen ins Wasser, und im nächsten Moment weiß er selbst nicht mehr, was das sollte.
- Glahn schießt sich buchstäblich selbst in den Fuß, mutwillig und sinnlos.
- Glahn spuckt einem Baron vor aller Augen unvermittelt ins Ohr.
- Glahn nimmt eine sinnlose Sprengung vor, durch die Eva zu Tode kommt.
- Glahn erschießt seinen treuen Hund (So ein A…loch!), um ihn dann wie versprochen (allein das schon unsinnig) an seine inzwischen zu Eis erkaltete Liebe Edvarda zu verschenken.
Und in seiner Rückschau, als die die Erzählung angelegt ist, schreibt uns Glahn, dass er über alle diese Dinge schreibe, weil es ihm „Vergnügen“ (!) mache, als Zeitvertreib, weil er angeblich – schon wieder – nichts besseres zu tun habe.
Hier geht es nicht um sinnreiche Themen wie z.B. Schüchternheit und Ungeschick im gesellschaftlichen Umgang, die durch Ermunterung, Humor und eine geänderte Einstellung überwunden werden. Oder gar um das Thema des eigenwilligen, klugen Menschen, der mit der Gesellschaft naturgemäß im Clinch liegt, und sich einen Platz in der Gesellschaft als geduldeter Exzentriker, gefragter Querdenker oder bewunderter Erfolgsmensch erobern muss. Das alles ist es nicht.
Es ist vielmehr eine Art Krankheit, eine pathologische Charakterschwäche, eine psychische Gestörtheit. Glahn ist ein kindischer Tiermensch mit „Tierblick“, ein irrationales Wesen, dessen Willkür und Emotionalität nicht durch Rationalität und Pflichtbewusstsein gezähmt und gezügelt worden sind. Glahn ist irre und wild, letztlich barbarisch. Die glatte Gegenthese zu Humanität und Aufklärung. Im Schlussteil des Buches erfahren wir, dass Leutnant Thomas Glahn auch andernorts in dieser Art fortfährt, in irrer Willkür zu handeln, bis er schließlich einen Kameraden provoziert, ihn zu erschießen.
Der zentrale Satz des Buches lautet: „Ach, es war kein klarer Gedanke in meinem Kopf.“ (S. 120), und ein häufig verwendetes Adjektiv ist „berauscht“. Glahn „fühlt“ in der Natur auch Gott in allen Dingen. Dies ist kein philosophisches Weltbild, kein Pantheismus des Gedankens, sondern eher ein Schamanismus des religiösen Gefühls, eine abergläubische Ideologie.
Und hier sind wir am Kern der Sache:
Knut Hamsun feiert in „Pan“ das barbarische „Denken“, den „freien“ Geist als Gegenthese zu Humanismus und Rationalität. Der knorrige Pan ist der Tiermensch aus den Wäldern, der Inbegriff des von jeder Zivilisation „verschonten“ Barbaren schlechthin, dem rauschhaften Gotte Dionysos zugehörig. Dionysos ist traditionell der Gegenspieler zu Apollon, dem Gott der Vernunft und der Ordnung, des Wahren und des Schönen, dem die Musen zugehörig sind.
Offenbar wird Knut Hamsun mit Recht als ein faschistischer Autor eingeordnet. Hamsun begrüßte den Aufstieg von Hitler, dessen Weltanschauung und Charakter genau denselben Gesetzen gehorchte, die wir bei Thomas Glahn finden. Und wir finden dieses „Denken“ auch bei Richard Wagner, dem Vorbild Hitlers. Es stimmt alles überein, bis hin zum nekrophilen Charakter und der Selbsttötung. Wir sehen hier nicht den Triumph eines rationalen Willens, sondern den Triumph einer barbarischen Willkür, die letztlich ins Verderben führen muss, und eigentlich nur lächerlich ist. Offenbar nicht für Knut Hamsun.
Ein weiterer Fingerzeig auf Hamsuns Einstellung ist sein Vorsprechen bei Hitler, um die Greueltaten der Nationalsozialisten in Norwegen, deren Anwesenheit Hamsun grundsätzlich begrüßte, zu mildern. Was eine Heldentat hätte sein können, denn Hamsun war einer der ganz wenigen, die Hitler ins Angesicht widerstanden, war natürlich einfach nur der naive Schildbürgerstreich eines politischen Kleingeistes. Was dabei aber auffällt, ist die Wortwahl Hamsuns. Hamsun zu Hitler: „Die Methoden des Reichskommissars eignen sich nicht für uns, seine ‚Preußerei‘ ist bei uns unannehmbar, und dann die Hinrichtungen – wir wollen nicht mehr!“
Die Methoden der Nazis als „Preußerei“ zu bezeichnen ist wahrlich der Gipfel. Wenn es denn nur „preußisch“ zugegangen wäre in Norwegen! Denn Preußen steht (auch) für Immanuel Kant, den Eckstein des Rationalismus, oder für Friedrich den Großen, der die Aufklärung in Deutschland populär machte, oder für Karl Friedrich Schinkel, der Berlin in ein „Spree-Athen“ verwandelte, oder für Wilhelm von Humboldt, der mit Gymnasium und Universität die Institutionen für die humanistische Bildung schuf und zudem den politischen Liberalismus begründete, oder für Alexander von Humboldt, der für Menschenrechte und Wissenschaft steht. Preußen steht für eine Rezeption der Antike im Hinblick auf Humanismus und Aufklärung, sowie für Selbstdisziplin und Rechtsstaatlichkeit. Selbst ein verunglückter Charakter wie Kaiser Wilhelm II. widerstand noch den Nationalsozialisten und ihren Umwerbungsversuchen in seinem Exil. Und noch Marcel Reich-Ranicki fand wiederholt lobende Worte für das „preußische Gymnasium“ mitten im Nationalsozialismus, während er negative Geschehnisse lieber mit dem Wort „deutsch“ charakterisierte. Wer Preußen in einen Topf mit den Nationalsozialisten und ihren Untaten wirft, hat intellektuell schon verloren. Der derbe Pöbelgeist des Faschismus und ein moderner, liberaler Konservativismus sind eben nicht dasselbe, sondern grundverschieden. Doch Knut Hamsuns Irrtum ist noch verrückter: Denn für ihn ist Preußen das Böse, und der Nationalsozialismus das Gute. Verkehrte Welt …
Literarisch gelungen sind an diesem Buch lediglich die Passagen, die Leutnant Glahn in seiner einsamen Verbundenheit mit der Natur zeigen. Die Harmonie, Zeitverlorenheit und die Geborgenheit, die Glahn inmitten der Natur erlebt, wird gut geschildert, und ist auch schön zu lesen. Ebenfalls noch literarisch gekonnt ist die Schilderung, wie diese Harmonie verloren geht, als Glahn Edvarda kennenlernt, noch bevor er sich bewusst wird, dass er sie liebt. Danach kommt nichts mehr. Die Erzählung ist als Gedankenschau Glahns angelegt. Teils erzählt er für sich selbst, teils gibt er unvermittelt Dialoge wieder. Das eine geht fließend ins andere über. Es ist oft schwerfällig zu lesen, hölzern und unlebendig. Hamsun benutzt außerdem Mythen, Märchen, Metaphern und dunkle Andeutungen. Rational fassbare Dinge kann man von diesem Autor wohl eher nicht erwarten.
Fazit
Ein schreckliches Buch! Wie dtv mit dem Spruch „eine der schönsten Liebesgeschichten der Weltliteratur“ Werbung dafür machen kann, erschließt sich nicht.
Empfehlung einer besseren Alternative
Wer über Harmonie mit der Natur lesen möchte, wer ein strebendes Leben ohne Müßiggang erleben möchte, wer eine schöne, schwungvolle, geistig niveauvolle Liebesgeschichte vorgeführt bekommen möchte, und wer ein tragisches Ende sehen will, aber tragisch im Vollsinn des Wortes, d.h. unter bejahender Annahme des Schicksals, dem sei unbedingt „Hyperion oder Der Eremit in Griechenland“ von Friedrich Hölderlin empfohlen! Das ist wirksames Gegengift.
Nicht zufällig schrieb einer der großen Hölderlin-Kenner, Pierre Bertaux, auch eine Rede zum 200. Todestag von Friedrich dem Großen für eine Feier auf Schloss Hohenzollern. Er charakterisierte diesen Preußenkönig als „Philosophen im französischen Sinn“, denn er habe „Vernunft als gesunden Menschenverstand kultiviert.“ – Der knorrige Pan jedoch, und diese verkrüppelte Geschichte des finsteren Herrn Hamsun, sie sollen uns gestohlen bleiben! Weg damit!
Bewertung: 1 von 5 Sternen.
(Erstveröffentlichung auf Amazon am 30. Dezember 2018)