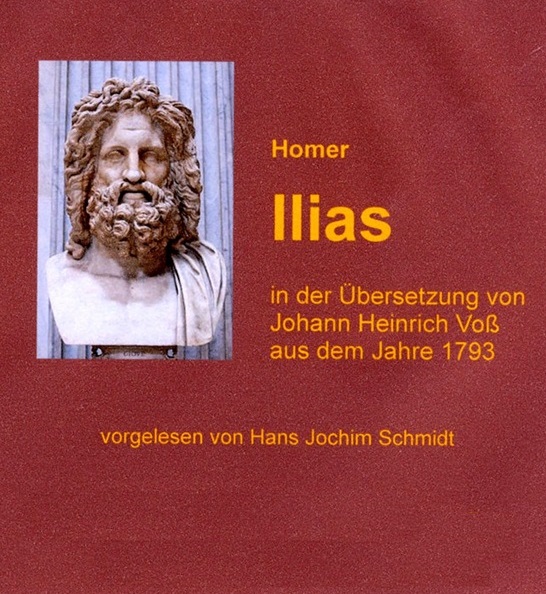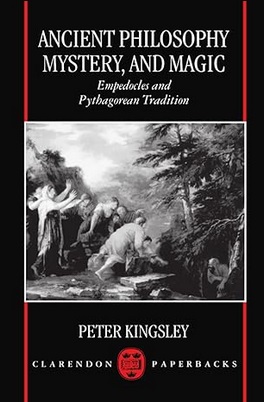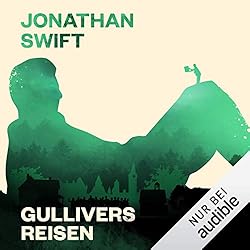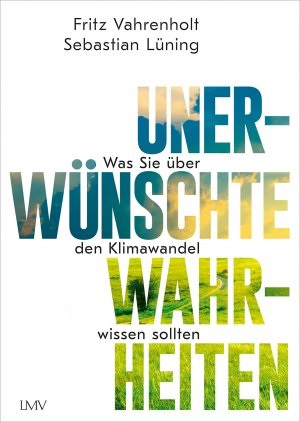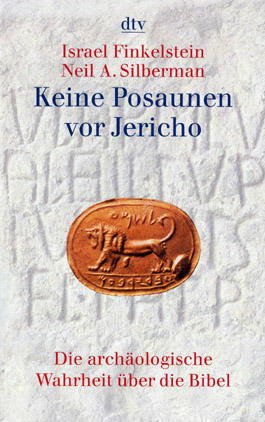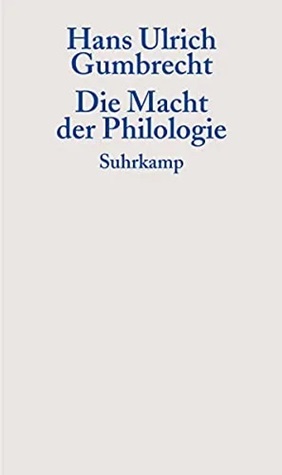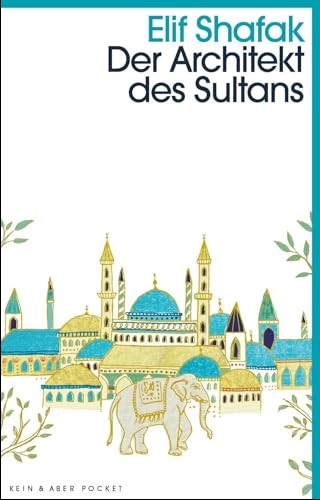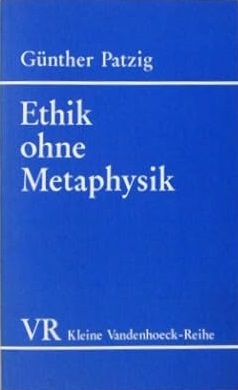
Plädoyer für den Utilitarismus in einer von Kants Kategorischem Imperativ beherrschten Umwelt
Der Philosoph Günther Patzig hat unter dem Titel „Ethik ohne Metaphysik“ 1971 bzw. in zweiter, überarbeiteter Auflage 1983 eine Reihe von Aufsätzen zusammengestellt, deren zentrale These sich ungefähr folgendermaßen zusammenfassen lässt: Der Kategorische Imperativ von Immanuel Kant sei eine große Entdeckung und bleibe gültig, aber er bedürfe notwendig der Ergänzung durch den Utilitarismus.
Patzig arbeitet allerdings mit einem Kuschel-Utilitarismus: Er geht nicht konsequent vom völlig egoistischen Standpunkt des Menschen aus, wie z.B. Cicero, sondern stellt statt dessen das Allgemeinwohl als Ansatzpunkt des Utilitarismus dar. Er wendet sich dagegen, Altruismus letztlich egoistisch begründen zu wollen. Lustgewinn und Schmerzvermeidung sind für Patzig keine ausreichende Begründung, da er von einem platten Begriff von „Lust“ ausgeht.
Das alles ist natürlich Unfug. Patzig selbst lässt einigemale den wahren Ansatzpunkt des Utilitarismus durchschimmern (z.B. S. 46: Das Egoistische ist nicht automatisch das Schlechte; S. 165). Wer den Utilitarismus aus dem Allgemeinwohl begründet, handelt naiv und unphilosophisch. Das Allgemeinwohl ist vielleicht eine gute Faustregel, die aus dem Utilitarismus folgt, nicht aber dessen wahrer Wurzelgrund. Natürlich muss der Utilitarismus, um praktisch zu werden, Faustregeln entwickeln, und kann nicht in jedem Einzelfall die absolute utilitaristische Rechnung aufmachen. Diese Faustregeln müssen unweigerlich auch das Allgemeinwohl in den Blick nehmen. Aber unter der Ebene dieser Regeln liegt ein tieferer Grund, der rein egoistisch ist, wobei der Altruismus im Egoismus einbeschlossen ist.
Außerdem redet sich Patzig den Kategorischen Imperativ (KI) Kants schön bzw. er biegt ihn in Richtung eines utilitaristischen Ansatzes um und schiebt so dem KI gewissermaßen wie mit einem Taschenspielertrick ein utilitaristisches Verständnis unter, das er im Original nicht hat. Bei Patzig ist der Kategorische Imperativ mehr eine Heuristik und Faustregel zur Findung moralisch nützlicher Regeln. Kant habe keineswegs Moral aus einer rein logisch-vernünftigen Überlegung ziehen wollen, meint Patzig irrigerweise: Doch genau das ist Kants KI. Der KI von Patzig ist nicht mehr der KI von Kant. Das Rigorose an Kants KI wird weggeredet und statt dessen kurzerhand zum utilitaristischen Abwägen von Werten übergegangen. Am Ende wird Kants KI von Patzig ad absurdum geführt, als er die Abwägung jeder einzelnen Situation in den KI aufnehmen zu können glaubt. Ein solcher auf den Einzelfall mit Güterabwägung ausziselierter KI wäre aber kein kategorisches Gesetz mehr, sondern eine Güterabwägung im Einzelfall. Also gerade nicht das, was Kant mit dem KI wollte.
Indem Patzig auch John Rawls Gedankenexperiment mit dem „veil of ignorance“ als Anwendung des KI deutet, verkennt Patzig, dass das Gedankenexperiment von Rawls auf einem wohlverstandenen Egoismus aufbaut, und nicht auf einem Gesetz, das im Sinne Kants von jedem Eigennutz absieht. Das falsche Verständnis des KI erklärt auch die seltsame Auffassung von Patzig, dass die antiken Ethiken ein Defizit hätten, das durch eine Kombination von Utilitarismus und Kategorischem Imperativ behoben werden müsste. Bei Cicero gibt es kein solches Defizit.
Die gute Absicht von Patzig
Warum beging Patzig diese Fehler? Der Grund dafür ist offenbar, dass er in einer Umwelt lebte, nämlich der deutschen Philosophie, die völlig vom Kategorischen Imperativ Kants beherrscht ist. In dieser Umwelt glaubte Patzig wohl, den Kategorischen Imperativ nicht frontal angreifen zu können, und den Utilitarismus nur in abgeschwächter Form präsentieren zu können. Auf diese Weise glaubte er offenbar, Anschlussfähigkeit zu wahren und mögliche Interessenten nicht zu verschrecken. Es handelt sich also um Fehler, die begangen wurden, um der Sache zum Durchbruch zu verhelfen. Genützt hat es offenbar nicht, und es ist auch sehr die Frage, ob eine Verbiegung dessen, was man möchte, bei der Durchsetzung desselben hilfreich ist, gerade auch wenn es um Philosophie geht.
Es ist natürlich dennoch ein großes Verdienst von Patzig, den Utilitarismus in Deutschland ins Gespräch gebracht zu haben, und Defizite des Kategorischen Imperativs von Kant zumindest angedeutet zu haben! Es hat aber die Konsequenz gefehlt. Patzig scheint jedenfalls sehr daran gelitten zu haben, dass sich die angelsächsische Welt dem Utilitarismus zuwandte, während die deutsche Welt in Kants KI steckenblieb, weil er die Nachteile und die Irrtümer des einen und die Vorteile und die Wahrheit des anderen klar erkannt hatte.
Weitere Themen
Verhältnis Ethik zum Recht. Grundlegende Überlegungen, an denen vieles richtig ist. Es fehlt ein wenig der Gedanke, dass Strafe sich ausschließlich auf einen in der Zukunft zu erreichenden Zweck richten sollte, was Abschreckung und Befriedung nicht ausschließt.
Gegen Relativismus und Subjektivismus, für die Geltung von objektiven moralischen Normen.
Detailkritik an Kants Sprache, die begriffliche Unschärfen, Fehler und Widersprüche bei Kant aufzeigt.
Einzelnes
Für Patzig ist der erste Entwickler des Utilitarismus Joseph Butler (1692-1752). Doch dieser erbte den Grundgedanken des Utilitarismus bereits von Shaftesbury (1671-1713).
Der Titel „Ethik ohne Metaphysik“ ist ein wenig fragwürdig. Denn weder der Kategorische Imperativ noch der Utilitarismus geben konkrete Werte und letzte Ziele vor. Beide sind im Grundsatz in der Metaphysik verankert und hängen nicht an diesseitigen, konkreten Gütern; und beide sind offen für metaphysische Ziele. Unter „Metaphysik“ versteht Patzig offensichtlich die Behauptung göttlicher Offenbarungen wie sie in den großen Religionen postuliert werden. Wer solche göttlichen Offenbarungen ablehnt, ist die Metaphysik und letztlich auch Gott aber noch lange nicht los.
Bewertung: 4 von 5 Sternen.
(Erstveröffentlichung auf Amazon am 26. Januar 2020)