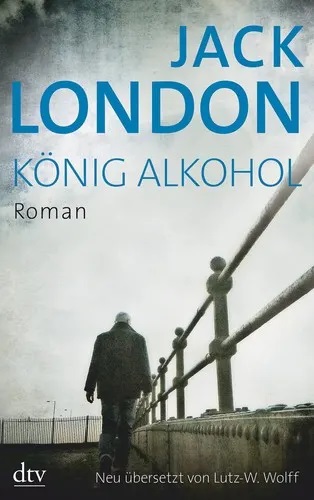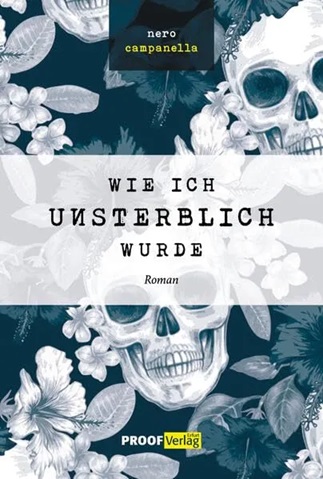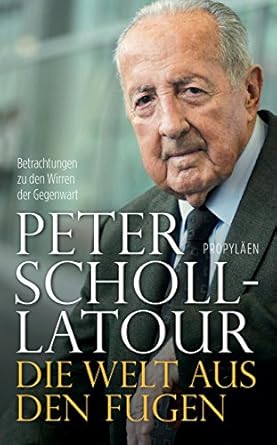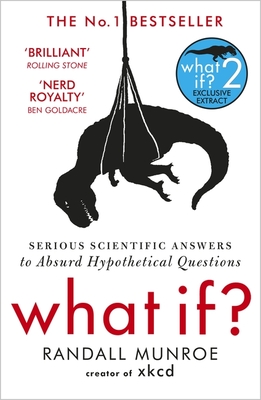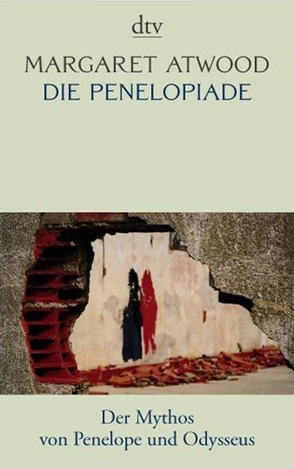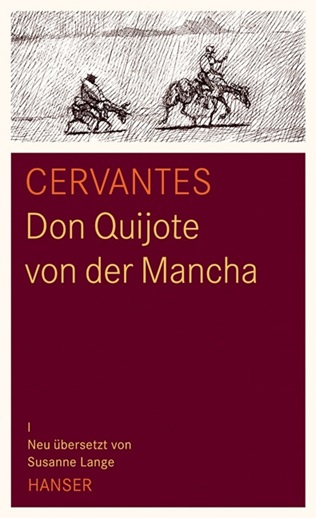Zauberlehrling Zorn versucht die Postmoderne zu retten und enttäuscht – Eine kritische Rezension
In den Jahren 1983/1984 hielt Jürgen Habermas zwölf Vorlesungen, die unter dem Titel „Der philosophische Diskurs der Moderne“ bekannt wurden. Das zentrale Thema war gewissermaßen die „Erledigung“ der Philosophie der Postmoderne, die vor allem durch vier französische Denker markiert wurde: Michel Foucault, Jacques Derrida, Gilles Deleuze, Jean-Francois Lyotard. Seit damals ist das Bild der Postmoderne äußerst negativ besetzt mit Schlagworten wie Relativismus, Irrationalismus, Antihumanismus und Nihilismus.
Der Philosoph Daniel-Pascal Zorn möchte mit diesem Buch das schier Unmögliche versuchen, nämlich zeigen, dass es sich um ein Fehlurteil handelt. Der Versuch, eine seit langem etablierte Meinung zu revidieren, noch dazu gegen eine Autorität wie Habermas, nötigt Respekt ab. Der Rezensent kennt eine solche Situation aus eigener Erfahrung durch sein Bemühen, die sogenannten Platonischen Mythen aus der über 150 Jahre alten Verständnisfalle herauszuholen, dass es sich um frei erfundene Kunstmythen handele (statt um platonische Erkenntnisgewebe von Elementen verschiedener Perspektive und verschiedener Grade von Wahrscheinlichkeit). Zudem ist Zorn ein schier unglaublich belesener Autor: Auch das nötigt Respekt ab. Es ist nicht möglich, Zorn zu lesen, ohne dabei manche interessante Anregung mitzunehmen.
Leider konfrontiert Zorn die Leser seines Buches mit einer langen Reihe von Enttäuschungen. Einige davon wurden gewiss mit voller Absicht begangen, ganz im Sinne einer postmodernen, inkommensurablen Intervention (vgl. im Buch S. 558). Zugleich macht dieses Buch den Kritikern ihre Enttäuschung zum Vorwurf (S. 543): Das ist frech. Aber so ist die Postmoderne nun einmal. Zorn scheitert, aber am Ende kann der Leser dennoch einigen Gewinn aus dem Buch ziehen.
Enttäuschung Nr. 1
Das Buch beginnt einladend mit der Jugendzeit der bekannten französischen postmodernen Denker. Doch bald kommt das Buch von ihnen ab und es folgt die Besprechung einer schier endlos langen Reihe von Denkern, die nicht zur „französischen“ Postmoderne gehören: Cusanus, Hume, Kant, Hegel, Kierkegaard, Nietzsche, immer wieder Nietzsche, die US-Pragmatiker, die Logischen Empiristen, Wittgenstein, Max Scheler, Husserl, Cassirer, Heidegger, immer wieder Heidegger, Carl Schmitt, Reinhart Koselleck, Tillich, Adorno, Joachim Ritter, Heinz von Foerster, Margaret Mead, Humberto Maturana, Gregory Bateson u.a. Wer etwas zu den französischen Denkern erfahren wollte, sieht über viele hundert Seiten kein Licht am Ende des Tunnels. Schließlich werden diese Denker erstaunlich knapp abgehandelt, auf insgesamt vielleicht 15% des Seitenumfangs. Der Autor möchte natürlich – ganz postmodern – „Genealogie“ und „Struktur“ der Postmoderne offenlegen, doch das enttäuscht nun einmal die Erwartungshaltung, die das Buch erweckt hat. Wer flexibel ist, wird darüber hinwegkommen und sich auf das Konzept des Autors einlassen.
Enttäuschung Nr. 2
Das Buch „Die Krise des Absoluten“ erscheint als populärwissenschaftliches Buch. Das ist leicht erkennbar an der äußeren Aufmachung, an den launigen Kapitelüberschriften, am erzählerischen Stil, der fortlaufend biographische Anekdoten einflicht und auch manches für philosophische Laien zu erklären versucht, an der Verbannung der Fußnoten ans Ende des Buches, an den fehlenden Literatur- und Autorenverzeichnissen, und nicht zuletzt am Marketing. Der Autor selbst hat Interviews zu seinem Buch auf Plattformen gegeben, die ein breiteres Publikum ansprechen (z.B. taz talk, Thilo Jung, ZDF blaues sofa). – Doch dieses Buch ist kein populärwissenschaftliches Buch. Es arbeitet ein sehr dichtes Programm an Inhalten ab, führt an die Abgründe möglichen Denkens, und nicht selten verfällt der Autor in Fachjargon. Vorkenntnisse sind für das Verständnis äußerst hilfreich. Der Fußnotenapparat am Ende umfasst 60 Seiten. Der durchschnittlich interessierte Leser dürfte dieses Buch schon nach den ersten 150 Seiten aufgeben. Der Rezensent ist drangeblieben.
Enttäuschung Nr. 3
Das Buch ist leider vielfach unverständlich. Zu viel wird vorausgesetzt. Zu viel wird knapp oder im Fachjargon abgehandelt. Zu viel bleibt ungesagt. Die launig gewählten Überschriften (z.B. „Traumzeit“, „Kambrische Explosion“ oder „Super-GAU“) geben leider überhaupt keine Hilfestellung. Zudem leidet das Buch an zu vielen erzählerischen Vor- und Rückblenden. Manchmal ist der Stoff ungünstig in Kapitel geschnitten. Mancher Cliffhanger am Ende eines Kapitels überfordert: Der Leser fragt sich, warum er es nicht versteht; manchmal kommt die Auflösung in einem späteren Kapitel. Manchmal auch gar nicht.
Immer wieder führt der Autor den Leser gezielt aufs Glatteis: Er lässt ihn das eine denken, nur um nach einigen Seiten aufzulösen: Nein, gemeint war ein anderes. So z.B. im Kapitel „Der Herr der Gegensätze“ zu den Davoser Disputen (S. 152). Der Leser denkt erst, es geht um Cassirer und Heidegger, doch nein: Es geht um Tillich und Przywara. Die Fußnoten beginnen ihre Nummerierung mit jedem Kapitel neu: Nachschlagen wird zur Qual. Hinzu kommt, dass man an vielen Stellen des Buches nicht so recht weiß, ob Zorn nun als Autor spricht, oder ob er lediglich einen Autor der Postmoderne referiert. Die Übergänge sind offenbar bewusst fließend gestaltet worden.
Wirft man hingegen einen Blick in Zorns wissenschaftliches Buch „Vom Gebäude zum Gerüst“, wird man positiv überrascht: Dort wird alles ausführlich erklärt, dort sind die Überschriften hilfreich, dort sind die Fußnoten tatsächlich am Fuß derselben Seite, und dort gibt es auch ein Literatur- und Autorenverzeichnis. Die Unverständlichkeit der „Krise des Absoluten“ ist kein Zufall, kein bloßes Versagen z.B. des Verlages (aber das auch).
Enttäuschung Nr. 4
Auch „das Absolute“, das dem Buch den Titel gegeben hat, ist eine Enttäuschung. Zunächst beginnt es noch harmlos und vielversprechend: Mit dem „Absoluten“ ist zu Beginn die Voraussetzung des Denkens gemeint, die dem Denken einerseits vorausgeht, andererseits vom Denken gedacht werden muss, um sie zu erfassen. Ein reflexives Erkenntnisproblem, ein Kernproblem der Philosophie. Doch das Absolute bleibt schillernd. Eine Definition, auf die sich dieses Buch stützen würde, wird nicht wirklich gegeben. Vielmehr kommen auf den nächsten zweihundert Seiten viele weitere Auffassungen des Absoluten hinzu, die sich keineswegs ineinander überführen lassen, doch alle werden kurzerhand als „das Absolute“ angesprochen. So z.B. Gott als das Absolute, oder auch absolute politische Geltungsansprüche. Diese Dinge sind nicht wirklich dasselbe. Man kann zwar argumentieren, dass diese Dinge miteinander zusammenhängen, aber sie sind dennoch verschiedene Dinge, und aus dem einen folgt zumindest nicht zwingend das andere. Schwerwiegende Denkfallen lauern überall hinter diesen Gleichsetzungen. Ist das Schwärmerei? Der Leser wundert sich und ist verwirrt.
Erst auf S. 235 kommt eine teilweise Auflösung: Erst jetzt macht das Buch explizit, was der Leser über 200 Seiten hinweg in schweigender Duldsamkeit erfahren hat: Es gibt drei verschiedene „Momente“ des Absoluten, liest man da. Aber sogleich wird ein Schema von vier verschiedenen Absolutheiten nachgeschoben (S. 246). Wenn man genau mitgezählt hätte, wären es sicher noch mehr. Und auch im folgenden kommen viele weitere hinzu. Und alles wird „das Absolute“ genannt. Warum, wird nicht erklärt. Da schwurbelt das Buch: Es wird in oberflächlichen Analogien geschwärmt. Ob der Autor das wirklich alles erklären könnte? Wir vermuten zudem, dass das Buch sich im Wesentlichen auf den Begriff des Absoluten bei Hegel stützt. Doch wir wissen es nicht. Es bleibt ungesagt.
Im weiteren Verlauf des Buches verflacht der Begriff des „Absoluten“ zu einem eher politischen und gesellschaftlichen Begriff. Anders, als der Leser erwartet hatte, geht es jetzt nicht mehr um einen Kernbereich der Philosophie, sondern eher um politische Philosophie. Vermutlich würde der Autor es anders sehen wollen. Doch so stellt es sich dem Leser dar. Jetzt bekommen wir eine Darstellung der gesamten Geschichte seit Platon präsentiert, in der es immer wieder um die Krise des Absoluten ging. Wir lesen davon, dass auch der Absolutismus in Frankreich das Absolute war, und dass auch die Vordenker der französischen Revolution über das Absolute nachdachten. Und jetzt ist z.B. auch der Vorgang der Industrialisierung eine Krise des Absoluten. Zuletzt wird auch die physikalische Energie von Dampfmaschine und Elektromotor als „das Absolute“ angesprochen (S. 300), zuguterletzt auch der Goldstandard des Dollars (S. 514). Im Grunde gerät nun die ganze Geschichte der Menschheit zu einer einzigen Dauerkrise des Absoluten. Und damit hat sich das Versprechen des Buchtitels von der Krise des Absoluten in philosophisches Kleingeld verwandelt. Das Absolute und seine Krise, das sind keine seltenen und unbekannten Dinge, die es durch dieses Buch neu zu erfahren gilt, sondern das ist gewissermaßen die altbekannte, stets krisenhafte conditio humana zu allen Zeiten. An dieser Stelle fragt sich der Leser: Und dafür dieses Buch?
In diesen Zusammenhang gehört auch die gebetsmühlenartig wiederholte These, dass das Absolute und die Vielfalt korrespondieren. Auch diese Beziehung wird eher schwärmerisch in assoziativen Analogien beschworen als erklärt (z.B. die vielen Währungen und der eine Goldstandard, S. 514 f.), und der Leser hat den Eindruck, dass hier Äpfel mit Birnen verwechselt werden: Mal zeigt sich das Absolute in der Vielfalt, man kann es nur in der Vielfalt erfassen (reflexive Denkvoraussetzung) – mal stehen sich Vielfalt und das Absolute antagonistisch gegenüber (Absolutheit des Geltungsanspruchs gegen die Vielfalt). Jedenfalls spricht der Autor in einer Weise von der Gefahr des Absoluten und von der Vielfalt in der Gesellschaft, dass ein Bezug zu philosophisch „flachen“ Themen wie Multikulti und Diversity nicht übersehen werden kann. Der Leser ist skeptisch, ob der Bogen von einem Kernproblem der Philosophie wirklich zu diesen Dingen geschlagen werden kann, und ob das überhaupt noch Philosophie ist oder nicht vielmehr politische Weltanschauung und Agitation. Doch weiter.
Enttäuschung Nr. 5
Chronologisch wird der Leser von dieser Enttäuschung schon früher ereilt, doch die ganze Tragweite erschließt sich erst mit der Zeit: Der Autor übernimmt keine Verantwortung für sein Buch, sondern lässt alles in der Schwebe, wie es sich für die Postmoderne gehört.
Zu Anfang wird wiederholt darauf hingewiesen, dass die vorgelegte Darstellung der Postmoderne lediglich aufzeigt, „was die Postmoderne hätte sein können“ (S. 47 f.), aber – so folgt zwingend, auch wenn es in dieser Form ungesagt bleibt – vielleicht war die Postmoderne auch etwas ganz anderes. Das ist starker Tobak. Es ist in Ordnung, wenn ein Autor seinen Text einen „Essay“ nennt, also einen „Versuch“, sich einem Thema zu nähern. Wir alle wissen, dass man sich der Wahrheit nur annähern kann, und wir alle versuchen dies, so gut wir eben können, und scheitern doch immer irgendwo. Aber was hier als Anspruch formuliert wurde, ist das Gegenteil eines Anspruchs: Wenn es doch nicht so war, dann war es halt eben anders: Pech gehabt! Diese unphilosophische Frechheit ist natürlich ein Markenzeichen der Postmoderne (Vgl. z.B. S. 350, 562 ff.).
Zugleich wird damit auch die Erwartungshaltung enttäuscht, die der Untertitel „Was die Postmoderne hätte sein können“ beim Leser aufgebaut hatte: Der Leser dachte natürlich, dass die Postmoderne etwas Wichtiges und Richtiges „hätte sein können“, aber dann vom Weg abkam, und dass dieses Buch dieses Wichtige und Richtige, das „hätte sein können“, aufzeigt und damit Ansätze und Anteile der historischen Postmoderne für die Gegenwart rettet. Aber nein, die Postmoderne wird nicht differenziert und gereinigt sondern pauschal betrachtet, und es geht nur darum, dass die Postmoderne so „hätte sein können“, wie beschrieben, was immer einschließt, dass sie vielleicht auch anders war.
Enttäuschung Nr. 6
In diesem Buch ist die Postmoderne eine durch und durch richtige und gute Sache. Sie erscheint (!) völlig rational und geradezu septisch rein von allen bösen Dingen, die wir gemeinhin mit der Postmoderne assoziieren. So ist z.B. von einer Philosophie die Rede, „die nichts mit ‚postmoderner‘ Beliebigkeit, mit bloßer Ästhetik oder wahrheitsfeindlichem Relativismus zu tun hat.“ (S. 431) In der Rezeptionsgeschichte der Postmoderne sind dann alle Kritiker der Postmoderne durch die Bank unfair und polemisch (S. 528-549). Diese allzu reine Reinheit der überguten Postmoderne und diese allzu böse Bosheit ihrer Kritiker ist vollkommen unglaubwürdig und man fragt sich, ob der Autor nicht bemerkt hat, dass er sich damit ins eigene Knie schießt?
Hier wird sogar Nietzsches Übermensch zu einem weichgespülten Multikulti-Übermenschen, der gelassen und sogar zustimmend dabei zusieht, wie seine eigenen Interessen in dem großen Gezerre der Interessen von den vielfältigen Anderen ignoriert und zertrampelt werden (S. 331). Hat man sich aber den Übermenschen nicht eher so vorzustellen, dass vor allem er es ist, der in dem Gezerre der Interessen die vielen anderen über den Tisch zieht, und ihnen seinen Willen aufnötigt? Und wo ist denn Nietzsches Idee von der Züchtung einer Herrenkaste und der Eliminierung der Entarteten? Wie auch immer: Der Autor hat in diesem Buch völlig vergessen zu erwähnen, dass Nietzsches Werk dermaßen „literarisch“ ist, dass es eben keine einigermaßen einheitliche Deutung von Nietzsche gibt. Wir sehen hier Zorns Nietzsche. Aber nicht Nietzsche. Nietzsche ist schon lange tot.
An einer Stelle heißt es beiläufig: „Nur wenn man davon ausgeht, dass es nur die eine Wahrheit geben kann, wird die Pluralität der Philosophie zu einem unlösbaren Problem.“ (S. 397) Dass damit die Einheit der Wahrheit aufgegeben wird, der wir alle gemeinsam nachstreben und um die wir alle gemeinsam ringen, bleibt ungesagt. Die Konsequenzen dieser beiläufig referierten postmodernen These, dass es die eine gemeinsame Wahrheit nicht geben würde, sind absolut dramatisch und dramatisch absolut – und bleiben hier völlig unbesprochen! Honi soit qui mal y pense?
Um die Akzeptabilität der Postmoderne zu untermauern, werden zahlreiche Autoren an die Postmoderne „rangepflanscht“, die wir keinesfalls zur Postmoderne zählen wollen. Darunter Joachim Ritter und seine Schule oder Theodor W. Adorno.
Andere Autoren mit starkem Bezug zum Thema fehlen, und es ist völlig unverständlich. So z.B. Hannah Arendt, die immerhin als wichtige Denkerin zum Totalitarismus gilt und damit eine Hauptautorin zum „Absoluten“ ist! Noch dazu hatte sie bei Heidegger studiert. Auch Zorn selbst verwendet das Wort „totalitär“ immer wieder zur Beschreibung des Absoluten (z.B. S. 120, 125, 216, 332), doch Hannah Arendt kommt nicht vor. Ob die Idee des Antitotalitarismus nicht in das Konzept des Autors passte? Karl Jaspers, ein berühmter Existenzphilosoph im Umfeld von Heidegger und Hannah Arendt, wird nur einmal erwähnt, aber nicht als Philosoph, sondern als „Psychiater“ (S. 88). Auch die Phänomenologin Edith Stein fehlt, immerhin Assistentin Husserls und in dieser Rolle direkte Vorgängerin Heideggers, die sich Gott zuwandte und in Auschwitz ermordet wurde: Mehr Krise des Absoluten geht gar nicht. Aber sie fehlt. Blankes Schweigen herrscht über den „Prager Frühling“ 1968. Wer von Paris 1968 spricht, darf von Prag 1968 nicht schweigen. Zudem hätte sich eine Erwähnung besonders angeboten, denn mit Jan Patocka spielte ein Phänomenologe eine wichtige Rolle. Patocka war auch der geistige Ziehvater von Vaclav Havel, der 1989 eine erfolgreiche bürgerliche Revolution anführte. Aber Schweigen.
Enttäuschung Nr. 7
Wenn der Leser gegen Ende des Buches auf Zorns vernichtende Kritik an Habermas und anderen Kritikern der Postmoderne stößt, ist er geradezu daraufhin konditioniert, um nicht zu sagen: manipuliert worden, diese Kritiker nicht verstehen zu können. Der unkritische Leser wird deren Kritik für genauso unfair und polemisch halten, wie das Buch sie darstellt.
Dieses Gefühl, manipuliert worden zu sein, gefällt überhaupt nicht. Überdies fühlt sich der Leser hilflos. Denn obwohl man sich gerade durch ein sehr dickes und schwieriges Buch zur Postmoderne hindurchgequält hat, fühlt man sich nicht hinreichend und auch nicht verlässlich informiert, um eine eigene Abschätzung abgeben zu können, ob und inwieweit die Kritiker irren. Man traut der Sache nicht, kann ihr gar nicht trauen. – Und über allem schwebt das Diktum, dass dieses Buch ja nur sagen will, was die Postmoderne vielleicht hätte sein können, vielleicht aber dann doch nicht war.
Enttäuschung Nr. 8
Was dieses Buch hätte leisten müssen, wäre ein großes Aussortieren, Reinigen und – wo möglich – teilweises Erneuern der Postmoderne gewesen: Aus den rauchenden Trümmern der Postmoderne mit all ihren Fehlern und Maßlosigkeiten hätte herausgearbeitet werden müssen, was aus dem Schutt gerettet werden kann und Bestand hat. Doch von dieser notwendigen Kritik fehlt in diesem Buch jede Spur. Der Leser ist ja durchaus bereit, sich auf vieles einzulassen. Es ist offensichtlich, dass nicht alles schlecht war an der Postmoderne. Aber ohne dieses Sortieren geht es nicht. Denn so sicher, wie die Postmoderne manchen wertvollen Gedanken formulierte, so sicher schoss sie auch über das Ziel hinaus.
Wir würden z.B. gerne davon hören, warum Foucault Freiheit im Traum zu finden glaubte (S. 93 f.). Der Leser findet bei eigener Introspektion nämlich, dass Träume zwar sehr phantasievoll sein können, frei jedoch fühlt man sich in ihnen keinesfalls. Es wäre auch interessant herauszufinden, ob das Ereignis, das dieses Buch mit den Worten „Foucaults Hass kennt keine Grenzen“ beschreibt (S. 344), völlig unverbunden zu Foucaults Denken sein konnte? Wir verstehen die Motivation Foucaults sehr gut, aber Hass? „Grenzenloser“ Hass?! Nein. Wir würden auch gerne wissen, warum Foucault die mörderische Tyrannei von Khomeini im Iran verharmloste, und ob das nicht doch sehr viel mit seinem Denken zu tun hatte. Von seinem teils fragwürdigen Sexualverhalten, das Foucault teilweise selbst mit seinem Denken in Verbindung brachte, mal ganz abgesehen. Doch davon kein Wort in diesem Buch.
Es ist zu fragen, warum die Zielrichtung der Kritik der Postmoderne immer fundamental gegen die bestehende Ordnung gerichtet war, gegen „das System“, wie dieses Buch sehr gut herausarbeitet. Ist das nicht ein wenig kindisch? Irgendeine Ordnung muss es ja geben. Vielleicht hat die bestehende Ordnung auch ihr gutes? Und vielleicht kommt nach der erfolgreichen „Überwindung“ der bestehenden Ordnung nichts besseres nach? Hier fehlt doch einfach der Blick auf das Ganze. – Und wenn es der Postmoderne wirklich darum ginge, die herrschende Ordnung zu hinterfragen, und „das System“ mit inkommensurablen Interventionen zu irritieren, warum wird dann die irritierende Frage nach Gott nicht gestellt, sondern abgeräumt? (S. 235, 330) Ist das die Inkohärenz der Inkohärenz der Postmoderne?
Ebenso auffällig ist die völlige Verhaftetheit dieser Denker in ihrer Zeit und ihrem Zeitgeist. Es ist eine seltsame Verschränkung von Philosophie und Zeitgeist, also eine Philosophie, die gar nicht nach der Wahrheit an sich fragt, sondern nach der geistigen Stimmung zu einem bestimmten geschichtlichen Zeitpunkt. Da ist z.B. Nietzsches Gejammer über den Tod Gottes, den „wir“ angeblich getötet haben. Damit reflektiert Nietzsche den Geist seiner Zeit. Aber sollen denn auch wir, die wir sowohl die vielfältigen Verläufe der Geschichte überblicken, als auch besser über die Gottesfrage Bescheid wissen als jene Menschen, die dem Zeitgeist ausgeliefert sind, uns diesem Diktum anschließen? Nein. Das Gejammere Nietzsches über den Tod Gottes ist unter philosophischen Gesichtspunkten dumm und kindisch. Ein Gegenbeispiel ist Platon, der die Zyklen der Zeit zu überblicken versuchte.
Wir würden auch gerne wissen, ob es nicht eine maßlose Übertreibung ist, hinter dem reflexiven Wechselgeflecht des Strukturalismus eine völlige Ablösung von den zugrunde liegenden Realitäten zu sehen. Das Buch zieht eine Analogie zu den Finanzmärkten, an denen Derivate gehandelt werden, also Preise und Preiserwartungen, aber keine echten Waren mehr: „Es ist nicht so, als ob es die Welt, auf die diese Werte sich beziehen, nicht gäbe. Sie existiert. Doch sie spielt für die Bewertung keine Rolle mehr.“ (S. 523 f.). – Doch das ist falsch. Die den Derivaten zugrunde liegenden Realitäten spielen für die Bewertung sehr wohl eine Rolle. Es ist vielmehr eine fahrlässige Risikokontrolle, die dazu führt, dass sich Finanzmärkte allzu weit von der Realität entfernen und in luftige Höhen abheben – und dann irgendwann zwangsläufig eine sehr harte Landung erleben. Mit den Finanzmärkten ist es wie mit der Fliegerei: Runter kommen sie immer. Damit verkehrt sich das gegebene Beispiel zu einem Argument gegen (!) die Postmoderne: Wurde nicht auch hier allzu leichtfertig die zugrunde liegende Realität vergessen und zu Höhenflügen angesetzt, die mit einer harten Landung enden müssen? Derselbe Irrtum unterläuft dem Autor noch ein zweites Mal beim Thema der Ablösung der Währungen vom Goldstandard (S. 515, 522): Es ist falsch, dass Währungen sich losgelöst von jeder Realität nur noch gegenseitig bewerten. Denn jeder Ausgabe von Geld steht die Einlage eines Wertpapiers bei einer Zentralbank gegenüber: Das ist harte Realität. Zentralbanken können natürlich dazu übergehen, wertlose Wertpapiere als Einlagen zu akzeptieren. Aber das führt dann in die Inflation. Runter kommen sie immer. Nichts schwebt frei.
Stellvertretend für alles, was der Autor über die Postmoderne ungesagt lässt, möchte der Rezensent das Büchlein „Glaubten die Griechen an ihre Mythen?“ von Paul Veyne 1983 anführen, das er selbst gelesen und rezensiert hat. Paul Veyne war mit Foucault eng befreundet und übertrug das postmoderne Denken 1971 in seiner Schrift „Comment on écrit l’histoire“ auf die Geschichtsschreibung. Paul Veyne ist ein Urgestein der Postmoderne. Das Büchlein wird u.a. auch von Slavoj Zizek empfohlen, der wiederum von Zorn geschätzt wird. Es ist ein Machwerk voller maßloser und falscher Ideen, eine Orgie der Anti-Rationalität und des Relativismus, des Zynismus und der Menschenfeindlichkeit. Alle Vorurteile gegen die Postmoderne werden hier bestätigt. Doch dieser Realität stellt sich das Buch von Zorn nicht. Das wäre aber verlangt gewesen.
Enttäuschung Nr. 9
Dieses Buch realisiert nicht, dass die Postmoderne keinesfalls ein Antidot gegen das Absolute ist, sondern dass die Postmoderne selbst zu einem Absoluten geworden ist, das unerwünschte Extreme hervorbringt. Das ist fast schon tragisch. Zorn beschönigt die Postmoderne absolut.
Da ist zunächst die maßlose Überziehung und Übertreibung von an sich richtigen Grundgedanken durch die Postmoderne. Doch der Mensch ist ein begrenztes Wesen. Komplexität muss reduziert werden. Es ist nicht möglich, Rücksicht auf alles zu nehmen, selbst wenn man das wollte. Noch zu Anfang des Buches wird auf Nietzsches Erkenntnis verwiesen: „Das Absolute ist nur das Missverständnis einer Vielfalt, die so radikal ist, dass sich das alltägliche Denken bei ihr nicht lange aufhalten kann.“ (S. 48) Am Ende des Buches fehlt diese Einsicht. Gutes Denken denkt die Praktikabilität immer mit. Wer hingegen versucht, auf Teufel komm raus Probleme mithilfe filigraner Theorien zu lösen, die an der groben Praxis scheitern müssen, endet zwangsläufig in Extremen. Man muss die Kirche im Dorf lassen können.
Die Postmoderne ist keine Philosophie nach menschlichem Maß. Und der Mensch wird immer das Maß für den Menschen bleiben, eben weil der Mensch ein Mensch ist. Die Vorstellung, dass der Mensch den Menschen erst vor wenigen Jahrhunderten als Maßstab entdeckt hat, und dass es jetzt gilt, den Menschen wieder zu verabschieden, ist unsinnig, falsch und extrem. Das Ringen um das Wesen des Menschen wird kein Ende nehmen, solange es Menschen gibt. Die Idee des Menschen ist vielleicht die einzige Idee, die man getrost zum Absoluten machen kann, eben weil der Mensch ein Mensch ist. Vielleicht auch noch ein dazu korrespondierender Gott, vielleicht. Auf diese Weise wird das Absolute als Trennendes unter den Menschen neutralisiert. Die Absolutheit der Menschenrechte rührt daher. Aber ein solcher Gedanke fehlt in diesem Buch.
Statt dessen wird der Leser mit Deleuze und Guattari konfrontiert, die in einer kommunistischen Klinik die „originelle“ Idee aushecken, dass der Kapitalismus die Krankheit der Schizophrenie hervorbringe (S. 455 ff.). Später liest man dann, dass die beiden eigentlich gar nicht die Krankheit Schizophrenie meinten, sondern mit diesem Wort etwas anderes meinten (S. 466). Typisch Postmoderne. Oder da ist Lyotard, der das Bündnis mit den Arbeitern gegen die herrschende Klasse sucht (S. 476): So flach kann Postmoderne sein.
Überhaupt das fundamentalistische Aufbegehren gegen die herrschende Ordnung, gegen „das System“. Es geht immer ums Kaputtmachen. Nie ums Aufbauen. So einfach kann man es sich aber nicht machen. Wir erinnern daran, dass z.B. auch die Menschenrechte „zum System“ gehören. Lyotard meint, dass es völlig sinnlos sei, über eine Reform der Universität und ihrer Lehrinhalte nachzudenken, denn der Dozent würde immer nur konsumierte Lehrinhalte reproduzieren und auf diese Weise Studenten zu Arbeitskräften für den Kapitalismus ausbilden (S. 480). Abgesehen davon, dass Lyotard hier eine sehr zynische Auffassung seines eigenen Lehrberufes zu erkennen gibt: Ist es nicht maßlos übertrieben, dass Lyotard trotzig auf einer utopischen Fundamentalkritik beharrt und darüber womöglich nützliche Reformen pauschal verwirft? Gewisse Defizite von Foucault sprachen wir oben schon an. – Es gibt gute Gründe, solchen Menschen nicht zu vertrauen.
Es wird auch die Wende zur völligen Dominanz des Marktes unter Reagan und Thatcher beklagt (S. 519 ff.). Doch es wird kein Grund dafür angegeben, wieso es eigentlich dazu kommen konnte. Wäre es nicht möglich, dass gerade linke und postmoderne Denker den Boden dafür bereitet haben? Denn sie waren es, die die klassische bürgerliche Bildung diskreditiert haben, die ein Gegengift gegen die Verabsolutierung der Märkte gewesen wäre. Sie waren es, die den Fokus völlig auf das Ökonomische und den Hedonismus gelenkt haben. Sie haben Sinnangebote jeglicher Art zerstört, bei Gott angefangen (S. 330), und sich als erste dem Konsum hingegeben. Sie sind schuld daran, dass die Menschen über keine eigenen geistigen Ressourcen mehr verfügen, mit denen sie den Vereinnahmungen des Marktes und des Konsums entgegentreten könnten. „Die ich rief, die Geister, werd‘ ich nun nicht los!“, ruft Goethes Zauberlehrling.
Der Rezensent verweist noch einmal auf das Beispiel des Büchleins „Glaubten die Griechen an ihre Mythen?“ von Paul Veyne, dessen Lektüre eine traumatische Erfahrung war. Es ist wirklich ein Machwerk voller maßloser und falscher Ideen, eine Orgie der Anti-Rationalität und des Relativismus, des Zynismus und der Menschenfeindlichkeit. Kurz: Die Postmoderne ist selbst extrem und „absolut“, daran kann kein Zweifel sein. Doch Zorn scheint das nicht zu sehen. Oder nicht sehen zu wollen.
Enttäuschung Nr. 10
Ein wirkliches Antidot gegen die Gefährlichkeit des Absoluten wäre eine klassische, bürgerliche, humanistische Bildung. Auch und gerade in einer „Massengesellschaft“, die ihre „Vermassung“ ja gerade nicht ihrer großen Zahl verdankt, sondern eben dem Verlust der höheren Bildung als Ideal und der Orientierung auf Konsum. Doch diese Idee wird in diesem Buch in Form des Ansatzes von Joachim Ritter (S. 269, 510 f.) nur sehr zurückhaltend behandelt. Im Epilog, auf der vorletzen Seite und als letzte inhaltliche Botschaft des gesamten Buches, reibt Zorns Adorno Joachim Ritter noch einmal kräftig unter die Nase, warum er davon nicht viel hält (S. 580). Der Zauberlehrling mag die Weisheit des alten Meisters nicht. Er wird immerhin noch geduldet.
Der Rezensent möchte an der Idee des gebildeten Menschen als einem selbständigen Leser und Denker festhalten. Platon und Kant, Goethe und Schiller, Thomas Mann und Hermann Hesse, Cicero und die Federalist Papers, um es einmal ganz platt zu sagen. Eine solche Bildung schützt allein durch ihre Vielheit vor Absolutheiten, indem sie viele Facetten des Denkens und Lebens kennengelernt hat. Indem sie viele Beispiele aus der Geschichte kennt, wie sich anfänglich gute Gedanken verabsolutierten. Und indem sie durch ihr vieles Weltwissen Probleme richtig einzuordnen weiß. Der gebildete Mensch wird niemals den Markt oder die Ökologie oder die Wissenschaft verabsolutieren, wie es heute geschieht, sondern er wird immer sagen: Marktwirtschaft ist sehr nützlich, aber nicht hier. Oder: Naturschutz ist wichtig, aber nicht so. Oder: Wissenschaft ist unverzichtbar, aber der real existierende Wissenschaftsbetrieb ist kein unfehlbares Konzil, das gläubige Unterwerfung verlangen könnte.
Eine solche Bildung ermöglicht erst eigenes weltanschaulich-philosophisches und politisches Denken. Schon mit Platon lernen wir, dass wir im Grunde nichts wirklich wissen, und wie wir der Wahrheit schrittweise durch Argumente nachstreben. Erkenntnis ist ein Riesennetzwerk von sich gegenseitig stützenden Einzelerkenntnissen verschiedener Wahrscheinlichkeit, und jede neu hinzukommende Erkenntnis verändert die Gewichte in diesem Netzwerk aufs neue. Die Wahrheit selbst ist nur schwierig oder gar nicht zu erlangen. Statt dessen muss man sich wie Münchhausen an seinem eigenen Schopf aus dem Sumpf der Erkenntnis ziehen, indem man Vieles mit Vielem abgleicht. Intellektuelle Demut ist angesagt. Wir können nicht alles verstehen, und es gibt Probleme, die wir nicht lösen können. Wer sie dennoch zu lösen versucht, muss in Extremen enden. Die Welt ist komplexer als wir erfassen können. Das ist triviale Allgemeinbildung. Aber darauf kann man aufbauen.
Gesellschaften brauchen ein gewisses Maß an Freiheit, sonst sind sie zu eng, aber auch ein gewisses Maß an Zusammenhalt, sonst fallen sie auseinander. Dass aus der allzu großen Freiheit der Tyrann wie ein frischer Trieb aus einem totgeglaubten Wurzelstock hervorschießt, lesen wir schon bei Platon und Cicero. Konsequentes Multikulti kann es paradoxerweise nur in einem autoritären Staat geben, wie Helmut Schmidt schon feststellte. Zorn selbst beschreibt mit Koselleck, wie sich der politische Absolutismus zur Befriedung der vielfältigen konfessionellen Gegensätze herausbildete (S. 493). Ungebildete Menschen plärren für Multikulti oder für Monokulti. Der gebildete Mensch sucht nach integrativen Lösungen praktischer Natur, z.B. Transkulturalismus statt Multikulturalismus, damit das absolut notwendige Gemeinsame über dem Vielen nicht verloren geht, und umgekehrt. Ideale Lösungen allzu filigraner Natur gibt es aber nicht. Gesellschaft und Demokratie werden immer holprig und grob geschnitzt bleiben, denn der Mensch ist selbst aus krummem Holz geschnitzt. – Solche Probleme werden bei Zorn aber nur ganz kurz und kryptisch angedeutet (S. 559 unten), und es ist wieder einmal nicht sehr klar, was er da eigentlich meint. Es bleibt auch unverständlich, wie denn das Gemeinsame kein Absolutes sein soll.
Richard Rortys Metaphilosophie meint man schon in Albert Schweitzers Kulturphilosophie begegnet zu sein, sowie in dem trivialen Gedanken, dass auch ein pluralistisches Gemeinwesen nicht alles akzeptieren kann, sondern nur das, was den Zusammenhalt des Gemeinwesens nicht sprengt. Und dazu gehört weit mehr als nur Verfassung und Vernunft, denn es geht um Menschen, nicht um Roboter.
Dass Systeme die Tendenz haben, einzurosten und sich von ihrer ursprünglichen Zielsetzung zu entfernen, gehört zum kleinen Einmaleins der Gesellschaftskunde. Systeme brauchen von Zeit zu Zeit eine Reform, sonst erstarren sie. Dasselbe gilt für Denksysteme. Wichtig ist der offene Diskurs, dass alles auf den Tisch kommt. Konsequenz ist gut, aber Fanatismus ohne Selbstkorrekturfähigkeit ist schlecht. Man hätte in diesem dicken Buch über das Absolute gerne auch die Weisheit gefunden, dass sich die Extreme gegenseitig wie kommunizierende Röhren aufschaukeln. Doch sie fehlt. Linke, die sich z.B. über die rechtsradikal gewordene AfD von Gauland und Höcke beklagen, sollten sich zuerst einmal an die eigene Nase fassen: Der ungebremste Durchmarsch linker Politik übersah, dass politisch Andersdenkende nicht verschwinden, wenn man ihnen die politische Vertretung wegnimmt. Die Idee einer Demokratie, in der es nur noch Linke gibt, ist eine granatenmäßige Schnapsidee. Ganz zu schweigen davon, dass die ungebremst durchgezogene linke Politik zwangsläufig mit der Realität kollidiert. All das schafft Radikalismus von der anderen Seite her, den es sonst nicht gegeben hätte. Umgekehrt wäre es übrigens genauso. – Damit genug der einfachen Wahrheiten, die wir in diesem Buch über Vielfalt und das Absolute so leider nicht finden konnten.
Enttäuschung Nr. 11
Der Autor des Buches ist selbst „absolut“. Das enttäuscht natürlich sehr, denn ist dies nicht ein Buch gegen das Absolute? Sowohl dieses Buch als auch andere öffentlich zugängliche Quellen machen deutlich, dass der Autor die Thesen der Postmoderne in ihrer Absolutheit, siehe oben, gar nicht reformiert. Zwar zählt der Autor ganz zu Anfang in knapper Form einige heutige Übertreibungen der Postmoderne auf (S. 9 f.), doch bei genauem Lesen erkennt man, dass er hier lediglich Meinungen über die Postmoderne referiert, aber seine eigene Meinung offenlässt. Zorn lässt den Leser denken, dass auch er diese Übertreibungen als Übertreibungen sieht, doch tatsächlich hat er nichts dergleichen gesagt. Nirgends in diesem Buch leistet Zorn die nötige Aussortierung von Übertreibungen und Brauchbarem. Im Grunde werden die anfangs referierten „Vorurteile“ gegen die Postmoderne im Verlauf des Buches nicht widerlegt sondern bestätigt. – In einer Talkshow sagte Zorn: „Ich bin … ich weiß nicht … ich bin selber kein postmoderner Philosoph … Ich habe nicht das Denkproblem, das die haben. Ich begnüge mich damit, die Geschichte zu erzählen.“ Wir können das nur so deuten, dass er über die Postmoderne hinaus will, aber sehr wohl mit und auf der Grundlage der Postmoderne. Insofern ist er natürlich sehr wohl postmodern. Wer nur das Buch gelesen aber nicht diese Talkshow gesehen hat, wird Zorn ohne weiteres für einen postmodernen Denker halten bzw. für einen post-postmodernen, „bildenden“ Philosophen im Sinne Rortys (S. 562). Es wäre ja seltsam, wenn Zorn auf der einen Seite die Postmoderne rehabilitiert, auf der anderen Seite aber sagen würde: Ich selbst halte nichts davon.
Politisch steht Zorn offenbar sehr weit links. Zu Marx scheint er ein tiefenentspanntes Verhältnis zu haben. Sein Geschichtsbild legt Zorn selbst in diesem Buch dar (vor allem S. 484-486). Wir haben es jedenfalls als Zorns Geschichtsbild gelesen. Liberale und Konservative kommen darin nicht gut weg. Habermas ist ihm zu konservativ, wie der frontale Angriff auf Habermas in diesem Buch und Aussagen in Talkshows deutlich machen. Das Milieu, in dem Zorn sich bewegt, spricht Bände. Auf Twitter pflegt Zorn mit Andersdenkenden einen teils inquisitorischen (vgl. Derridas zwängende Lektüre S. 360 f.), teils auf hanebüchene Irritation setzenden Gesprächsstil. Die Postmoderne lässt grüßen. Es ist auch befremdlich, wie „Rechte“ automatisch als Problemfälle der Demokratie, also als „Rechtsradikale“ eingeordnet werden, während für „Linke“ ganz andere Maßstäbe angelegt werden. Jeder kann sich in Zorns Büchern, in Medien und auf Twitter selbst davon überzeugen. Der Punkt ist: Wir sehen eine Absolutheit, die uns erschreckt.
So stellt es sich uns dar: Mit Daniel-Pascal Zorn ist wieder einmal ein Intellektueller der Versuchung erlegen, die innere Schlüssigkeit seines großartigen Gedankengebäudes für wahr zu halten, ohne dabei hinreichend auf die Rückbindung an die Realität geachtet zu haben. Und in diesem Gedankengebäude ist er nun gefangen wie die Kindliche Kaiserin in Michael Endes „Unendlicher Geschichte“ in ihrem Elfenbeinturm. Das ist es im Kern. Das ist die Entzauberung Zorns.
Die Abgehobenheit Zorns von der Realität zeigt sich auch in folgenden Aussagen: Seiner Meinung nach ist die menschliche Gesellschaft durch die Dominanz des Marktes in einen Zustand der „Künstlichen Intelligenz“ eingetreten, die unaufhaltsam ein Programm hin zu mehr Freiheit, Emanzipation, Vielfalt und Identität abarbeitet (S. 559). Mit anderen Worten: Die Entwicklungen rund um den Wokismus, mit ihren maßlosen Übertreibungen, deutet Zorn zwar noch nicht als die Erfüllung seiner wahren Utopie, aber doch immerhin als eine Zunahme an Freiheit. (Ein Blick auf seine Twitter-Tweets und seine Aussagen in Talkshows bestätigen das.) – Da kann man nur staunen: So „zwängend“ hatten wir uns Freiheit nicht vorgestellt. Was für Untiefen lauern da in Zorns Denken?
Oder ein anderes Beispiel: Zorn übersieht völlig die Entwicklungen, die durch eine Zuwanderung ohne hinreichende Integration vonstatten gehen, wie wir sie den Vielfalt-Schwärmern zu verdanken haben: Immer mehr Menschen in unserem Land haben kein hinreichend aufgeklärtes mind-set mehr. Immer mehr Frauen und junge Männer in unserem Land stehen unter der Knute eines Patriarchen. Während diese Rezension entsteht, wird Salman Rushdie bei einem Messerangriff schwer verletzt. Und in Dortmund nehmen Politiker an einer großen, öffentlichen Trauerfeier teil, auf der ein Gewalttäter (er hatte Polizisten mit einem Messer angegriffen) wie ein Märtyrer gefeiert wird – nur um die „Community“ zu beschwichtigen. Immer mehr Stadtteile verschwinden in dem nebelhaften Nichts vormoderner Zustände: Phantásien in Not! Doch Zorn ist ein Meister im Wegsehen und formuliert, wie wenn es die Realität nicht gäbe: „Gott, das religiöse Absolute, hat seine Macht über die Menschen verloren, zugunsten von Säkularisierung, Aufklärung und Fortschritt.“ (S. 235) und: „Die progressive, an Freiheit und Emanzipation orientierte Weiterentwicklung der Gesellschaft ist längst ein Operationsmodus dieser Künstlichen Intelligenz geworden“ (S. 559).
Sein Programm für die Gegenwart und die Utopie für die Zukunft hat Zorn (mit Lyotard und Rorty) auf den Seiten 558-564 beschrieben. Oder ist es doch nicht sein Programm? Wir haben es so gelesen, denn Zorn spricht auf S. 560 von „man“: „Man bräuchte die Postmoderne …“, und: „Bis es so weit ist, kann man sich an die zweite Bestimmung der Postmoderne halten.“
Wer auf Twitter genau aufpasst, erfährt, dass der Romantiker Novalis für Zorn der wichtigste Denker überhaupt zu sein scheint, der am weitesten gedacht habe (in Sachen Reflexivität, das große, alles überspannende Thema Zorns). Zorn will Novalis nicht als Romantiker verstanden wissen. Doch romantischer als Novalis geht es kaum. In seinen „Lehrlingen zu Sais“ hat der Romantiker Novalis einen Gegenentwurf zum „Verschleierten Bild zu Sais“ des Klassikers Schiller gewagt. Das verschleierte Standbild zu Sais verkörpert symbolisch die Erkenntnis letzter Wahrheit, also das Absolute. Doch die Gottheit hat verboten, den Schleier zu lüften. Diesen Schleier lüften: Genau das tut Novalis. Und Zorn gefällt’s. Aber ist Zorn damit nicht offensichtlich auf dem Weg zum … Absoluten?!
Bei Schiller geht die Sache (natürlich) nicht gut aus, und Schiller gibt uns die bedenkenswerten Worte mit auf den Weg:
Kein Sterblicher, sprach des Orakels Mund,
Rückt diesen Schleier, bis ich selbst ihn hebe.
Enttäuschung Nr. 12
Enttäuschend ist auch, in wie viele Selbstwidersprüche sich der Autor verwickelt. Da wird z.B. Vielfalt und Emanzipation befürwortet (für wen eigentlich? Das Wort Feminismus wird konsequent vermieden). Zu diesem Zweck vollführt der Autor einige moderate sprachliche Verrenkungen, bleibt dabei aber inkonsequent: So schreibt er meistens das gestelzte „Studierende“ (S. 155), manchmal aber einfach „Studenten“ (S. 154). Meistens ist von „Philosophen“ die Rede (S. 422), manchmal von „Philosophinnen und Philosophen“ (S. 424). Ganz selten findet sich ein kontraintuitives generisches Femininum statt eines generischen Maskulinums (S. 13). Doppelpunkte, Sterne, Unterstriche oder Binnen-I gibt es zum Glück keine (nur in einem Zitat). In Talkshows bemüht sich Zorn jedoch um die Doppelpunkt-Sprechpause. Allerdings muss er sich dabei immer wieder hastig selbst korrigieren. Zorn denkt sichtlich in normaler Sprache. – Aber derselbe Autor, der sich sprachlich so sehr bemüht, hat die Frauen unter den Philosophen völlig vergessen! Hannah Arendt und Edith Stein fehlen auffällig, wie schon gesagt. Auch im symbolischen Schlussbild des Buches kommen nur Männer vor. Acht alte, weiße Männer. (Ja, Derrida ist auch einer.)
Man hätte auch nicht erwartet, dass Zorn eurozentrisch denkt. Aber er tut es. Sogar eurozentrisch in den Kategorien von vor 1989. Denn auch der „Prager Frühling“ und Jan Patocka sowie die osteuropäischen bürgerlichen Revolutionen von 1989 fehlen bei ihm. In seiner Darstellung der Geistesgeschichte seit der Antike kommt nur der lateinische Westen vor (S. 239 ff.). Byzanz und die islamische Welt mit ihren eigenständigen Debatten und die gegenseitige Beeinflussung der verschiedenen Welten fehlen völlig bzw. werden mit einem kurzen Satz abgehandelt (S. 239 f.). Auch die völlig Absage an Gott ist sehr eng gedacht. Man hätte z.B. Mohamed Arkoun erwähnen können, der die Philosophie von Foucault und Derrida auf die religiösen Texte des Islam anwandte. Es ist auch fragwürdig, den Eindruck zu erwecken, als gehörte die Antike vor allem zu „Europa“ (um S. 242). Ist die Antike nicht eine versunkene Welt, die niemandem „gehört“, und die (zunächst) nicht nur vom lateinischen Westen, sondern auch von Byzanz und der islamischen Welt beerbt wurde, und die (heute) für die ganze Welt als gemeinsames Erbe der Menschheit offensteht? Doch der Autor bleibt völlig dem lateinischen Westen verhaftet. Nur in der Person von Pico della Mirandola werden dann auch Texte von Arabern und Ägyptern erwähnt (S. 568 f.). Averroes findet bei Zorn nicht statt. (Er kann auch gar nicht stattfinden, denn Averroes hat die Majestät der Vernunft aufgerichtet, was sich mit der Postmoderne wenig verträgt. Thomas von Aquin fehlt deshalb natürlich auch. Spätestens das ist sehr auffällig. Aber Augustinus, der Gottes Willen unvernünftig sein lässt, der kommt vor.) – Insgesamt verfehlt der Autor den Anspruch von Vielfalt jenseits des Eurozentrismus völlig.
Es ist auch fragwürdig, dass Zorn die Postmoderne (mit Rorty) permanent am Rand stehen sieht (S. 561). Denn Foucault war und ist ein Pop-Star! Postmoderne war und ist groß in Mode, man denke nur an völlig überzogene Maßlosigkeiten wie Gender, Diversity, Multikulti-Vielfalt, Critical Race Theory, Decolonialisation, oder „No borders no nations“ und „Refugees welcome bring your families“. Vieles, was manche etwas hilflos als „Kulturmarxismus“ bezeichnen, ist ganz oder in Teilen postmodern motiviert. Zorn selbst zählt es zu Anfang des Buches auf (S. 9 f.). – Aber Zorn sieht die Postmoderne am Rand stehen. Vielleicht ist das dank Habermas tatsächlich noch im engeren deutschen philosophischen Wissenschaftsbetrieb so.
Ein weiterer Widerspruch ergibt sich daraus, dass die Postmoderne als Kritik an der herrschenden Ordnung verstanden wird. Aber wenn die Menschen hilflos staunend mitansehen müssen (hilflos wie Lyotard nach 1968 S. 484), wie die herrschende Ordnung Gender und Diversity in völlig überzogener Weise auf den Thron hebt, ist die Postmoderne dann nicht zur Philosophie „des Systems“ geworden, und Zorn zu einer intellektuellen Stütze der Macht?
Den Kritikern der Postmoderne wirft der Autor vor, sie wollten sich selbst beweihräuchern, indem sie lieber sich selbst als die aktuelle Speerspitze der Philosophiegeschichte darstellen (S. 549). Aber ist der Autor hier nicht selbst polemisch? Die Schwarz-Weiß-Zeichnung von guter Postmoderne einerseits und bösen Kritikern andererseits ist ihrerseits überhaupt nicht postmodern, insofern völlig undifferenziert – andererseits auch wieder höchst postmodern, insofern Frechheit ein Markenzeichen der Postmoderne ist. Auf diesen Seiten wimmelt es jedenfalls nur so vor frechen Selbstwidersprüchen: Zorn stylt die postmodernen Philosophen (mit Rorty) als rebellische Außenseiter (S. 561-564), aber in Wahrheit ist es nur Style, denn die selbsternannten Außenseiter sind heute vielfach selbst in Machtpositionen, und zudem leistet die „normale“ Philosophie die nötige Kritik am „System“ auch selbst, ohne dazu der Postmoderne zu bedürfen.
Zorn kritisiert auch ausgiebig die gutaussehenden, sprachbegabten Populärphilosophen, die ein Bedürfnis des Marktes befriedigen (S. 549). Aber ist Zorn nicht selbst auch ein solcher? Er hat jetzt schon mehrere Bücher geschrieben, mit denen er in Talkshows kam, und auch für das neueste Buch sitzt er wieder in Talkshows bis hinauf zum Blauen Sofa des ZDF. Zorn platziert sich mit seinen Büchern definitiv am Markt.
Zu Anfang des Buches heißt es, dass mit der Postmoderne „ein letztes Mal“ alles auf den Tisch gekommen sei (S. 14). Wie wenn mit dem Ende der Postmoderne das Ende der Geschichte gekommen wäre. Doch viel weiter hinten hören wir: „Das Absolute ist nicht so leicht totzukriegen.“ (S. 414, 418) Die Geschichte ist also doch noch nicht zu Ende.
Was gelungen ist
- Am wertvollsten ist sicher die mikroskopische Nachzeichnung dieses Ausschnitts der Philosophiegeschichte des 20. Jahrhunderts, die die Motivation der einzelnen Denker teilweise gut herausarbeitet und in den größeren Zusammenhang der anderen Denker stellt. Wer dieses Buch gelesen hat, wird andere Darstellungen immer daran messen.
- Es konnte gezeigt werden, dass die Postmoderne durchaus einige bedenkenswerte Ansätze vorzuweisen hat. Es fehlt zwar ein Aussortieren und Reinigen dieser Ansätze, aber diese Botschaft ist trotz allem angekommen.
- Immer wieder wird auf die Strukturähnlichkeit von Problemen und Sachverhalten hingewiesen. Dies zwar oft nur knapp, aber das Gespür dafür wurde dennoch geschult.
- Sehr interessant ist die Berücksichtigung der Kybernetik. Der Rezensent ist Informatiker und bedankt sich.
- Natürlich ist auch die Warnung vor der Versuchung des Absoluten richtig. Allerdings wird sie durch die Absolutheit des Verfassers und seiner unbereinigten Postmoderne konterkariert. Unkritische Leser werden durch dieses Buch leider nicht gegen die Gefahren des Absoluten immunisiert werden, im Gegenteil.
Schluss
Der Zauberlehrling Zorn hat eine allzu pauschale Rettung der Postmoderne versucht, hat dabei auch manches unter den Tisch fallen lassen, und ist damit notwendig gescheitert. Leider zeigt er sich schwärmerisch in seinem Denkgebäude gefangen, so genial es in Teilen auch ist. Der Eindruck drängt sich auf, dass sich Philosophie und politische Einstellung bei Zorn gegenseitig im Wege stehen.
In der „Unendlichen Geschichte“ von Michael Ende heißt es: „Es gibt Menschen, die können nie nach Phantásien kommen, und es gibt Menschen, die können es, aber sie bleiben für immer dort. Und dann gibt es noch einige, die gehen nach Phantásien und kehren wieder zurück. … Und die machen beide Welten gesund.“ – Es ist Zeit, Phantásien den Rücken zu kehren: Es fehlt ein echtes Aussortieren und Reinigen des postmodernen Denkens. Es fehlt eine Klärung des Verhältnisses zur Vielfalt und zum Absoluten (z.B. gesellschaftspolitische Vielfalt-Schwärmerei? Streben nach dem Absoluten mit Novalis?). Es fehlt an simpler Menschenfreundlichkeit auch und gerade im Umgang mit Andersdenkenden.
Mit Goethe sagen wir: „Es muss auch solche Käuze geben.“ Zorns Belesenheit ist in jedem Fall ein Gewinn, und auch sein philosophisches Denken verschafft manche Anregung. Aber am Ende ist es mehr Wasser als Wein. „Welch‘ entsetzliches Gewässer!“ klagt der Zauberlehrling, bevor er den Meister zu Hilfe ruft.
Wer ein Antidot nötig hat, könnte z.B. diese Werke lesen (die Vielfalt macht’s):
- Empedokles, Fragmente.
- Platon, Apologie des Sokrates.
- Xenophon, Symposion.
- Goethe, Faust I + II.
- Albert Schweitzer, Kulturphilosophie.
- Hermann Hesse, Siddhartha.
- Thomas Mann, Joseph und seine Brüder.
- Walter Nutz, Vom Mythos der Freiheit.
- Neil Postman, Building a Bridge to the 18th Century: How the Past Can Improve Our Future.
- Durs Grünbein, Die Bars von Atlantis.
Epilog
Menschen sind im Garten des Akademos zusammengekommen, um ihre Gedanken auszutauschen. Kein Gebäude umgibt sie, man befindet sich in freier Natur. Es ist auch nicht kalt, sondern angenehm warm. Die Sonne steht im Meridian, nicht im Zenith, den die Sonne in diesen menschenfreundlichen Breiten niemals erreichen kann. Statt der eintönigen Weißheit der Eiswüste erfreut sich das Auge an der Buntheit einer vom Menschen wohlgeordneten Natur. Wind streicht durch die Bäume und lässt ihre Blätter leise rascheln: Die Welt ist offen. Doch niemand muss irgendwohin gehen. Man begegnet sich freundlich und bleibt beisammen. Auch Frauen und Fremdländische sind darunter. Die Gedanken schweifen frei, verzweigen und überkreuzen sich phantasievoll, und werden immer wieder von der Vernunft neu eingefangen und auf die eine, gemeinsame Wahrheit hingeordnet, um dann aufs neue auszuschweifen. Die Zyklen der Zeit und das Wesen des Menschen sind in Grundzügen längst durchschaut. Und dennoch ist alles ein großes Mysterium. Und wird es ewig bleiben, auch wenn die Erkenntnis nie aufhört. Der Turmbau zu Babel: Dieses absolute Projekt vielfältiger Hybris verfolgen nur die Narren. Wo die beste Polis als irrige Utopie erkannt wurde, so folgerichtig sie auch gedacht war, wird die zweitbeste Polis zum realistischen Ideal wahrer Menschenfreunde.
Bewertung: 2 von 5 Sternen.
(Erstveröffentlichung auf Thorwalds Internetseiten August 2022; zudem eine stark gekürzte Fassung auf Amazon am 25. August 2022)
Anhang
Einige zumindest zunächst sehr unverständliche Sätze
S. 170: Kants „Tertium ist die transzendentale Einbildungskraft. Sie ist die ‚ursprüngliche Zeit‘ und ‚bildet‘ so ‚die Wesensstruktur der Subjektivität‘.“
S. 318: Zu Nietzsche: „Um der reaktionären Einebnung der Differenz zu entgehen, entwirft Nietzsche ein Modell von Sinn und Wert, das nicht von Substanz und Sein ausgeht, sondern von Relation und Werden. Was sich in Sinn und Wert zum Ausdruck bringt, das sind aufeinander bezogene Relationen, die in Bewegungen des Werdens eingebunden sind, die maximale und minimale Spannungen ausbilden.“
S. 334: „Doch gerade die Philosophie ‚hat sich in ihr‘, der anthropologischen Illusion, ‚eingeschlossen, indem sie die Subjektivität verdichtete, hypostasierte und in der uneinholbaren Struktur des ‚menschlichen Wesens‘ einschloss.'“
S. 424: Unvermittelt: „Was ist die Bedingung?“ Tja, von was?
Diverse Mängel
S. 38: „Frankfurt“. Wünschenswert wäre: „Frankfurt am Main“. Mehrere Stellen im Buch.
S. 128: Lenins „berühmte Studie“. – Die weltanschauliche Studie eines Massenmörders aus Weltanschauung „berühmt“ zu nennen, ist unstatthaft. „Bekannt“ wäre besser.
S. 139, 239: „Kaiserzeit“: Gemeint ist die „römische Kaiserzeit“. Mehrere Stellen im Buch.
S. 146: „‚Jede Epoche ist unmittelbar zum Dasein‘ – so könnte man diese Position mit dem Historiker Leopold von Ranke zusammenfassen.“ – Doch bei Ranke ist es „unmittelbar zu Gott“, deshalb sollte es z.B. heißen: „Leicht abgewandelt könnnte man mit Ranke sagen …“
S. 194: „jüdische Kollegen denken über Migration nach“. – Wieso Migration? Emigration!
S. 199: Der Begriff „Metaphysik“ hätte erklärt werden sollen. Nicht jeder benutzt ihn so.
S. 201: Der Begriff „Weltanschauung“ hätte erklärt werden sollen. Nicht jeder benutzt ihn so.
S. 217: An der geheimen Konferenz in Princeton 1945 haben gewiss keine „Informatiker“ teilgenommen, der Begriff entstand erst später.
S. 219: Dass Mark I „der erste einsatzfähige digitale Großrechner“ war, darf bezweifelt werden. Zuses Z3 war auch digital und einsatzfähig. Der Umstand, dass der Rechner „groß“ war, erscheint hingegen wenig bedeutend.
S. 239: „Übersetzungen der über Bagdad und Kairo überlieferten Texte“ – Die weitaus meisten philosophischen Texte der Antike wurden über Byzanz wiedergewonnen, nicht durch arabische Rückübersetzungen. Das aber auch.
S. 282 f., 286: Mehrfach konsequent falsch: „Victor Emerita“, richtig: „Victor Eremita“.
S. 378: Es geht um die Logischen Empiristen, aber das Stichwort „Logischer Empirismus“ fällt erst auf S. 395.
S. 477: In Sätzen Lyotards werden „flics“ mit „Cops“ ins Deutsche übersetzt. Das geht nicht. Flics sind Flics.
S. 479: Trotsky mit s und y geschrieben: Mehrere Stellen. S. 483 Trotzki mit z und i.
S. 487: „Germanistisches Nationalmuseum“. Eine postmoderne Irritation?
S. 489: Beispiele für Geschichtsphilosophien, die Freiheit versprechen, aber faktisch Unfreiheit schaffen: „Drittes Reich“, „Ideologien von Stalin und Mao“. – Das sind aber gar nicht die Geschichtsphilosophien. Es hätte heißen müssen: Nationalsozialismus, Marxismus-Leninismus, Maoismus. Und wer von Stalin spricht, darf von Lenin nicht schweigen.