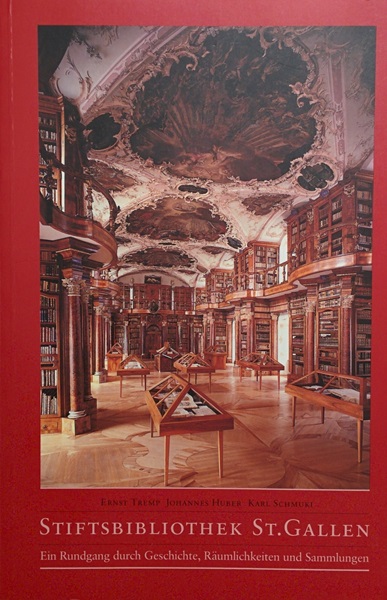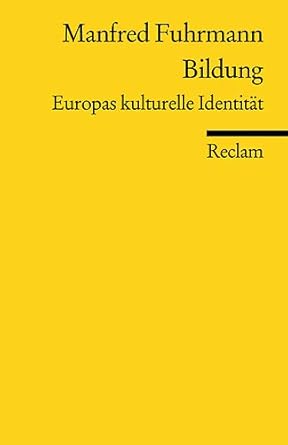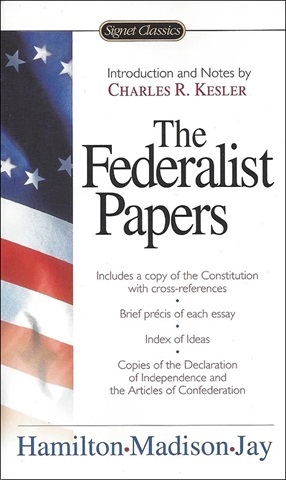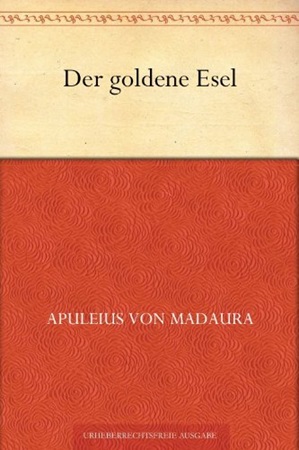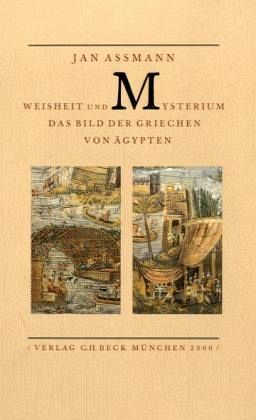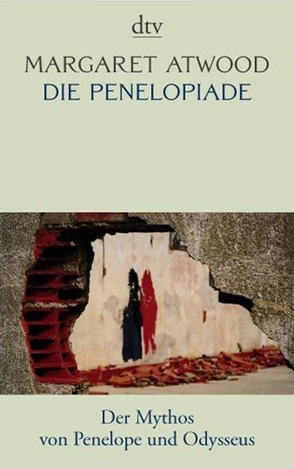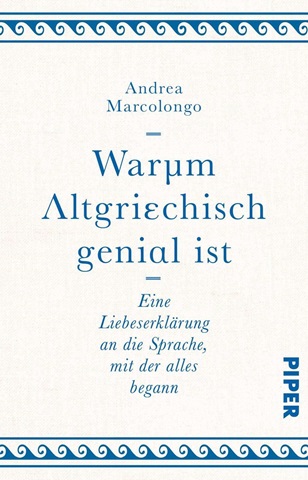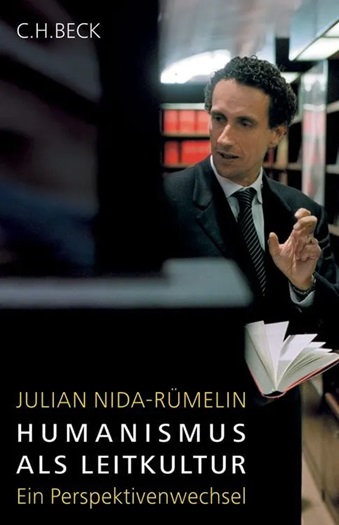
Humanismus als gute Gesprächsbasis – aber welcher Humanismus?
Das vorliegende Buch ist eine Sammlung von Reden, Aufsätzen und einem Interview von und mit Nida-Rümelin, die im Zeitraum 1999-2006 gehalten bzw. geschrieben worden waren. Dabei kommt es teilweise zu mehrfachen Wiederholungen derselben Thematik, was andererseits auch verschiedene Aspekte derselben Sache eröffnen kann.
Klassischer Humanismus
Zunächst ist es wohltuend, von einem Politiker, der Nida-Rümelin ja als Kulturstaatsminister 2001-2002 war, einige tiefer gründende Worte zu Themen wie Kultur und Bildung zu hören. Für Nida-Rümelin ist Bildung gerade nicht zuerst Berufsausbildung, sondern Menschenbildung, die den Menschen als ganzes entfaltet, und zur Selbständigkeit und Urteilsfähigkeit erzieht. Damit wird der Mensch kommunikationsfähig, gesellschaftsfähig, und letztlich auch fähig, sich verschiedensten beruflichen Situationen zu stellen, gerade auch in unserer heutigen einen Welt. Nida-Rümelin rückt dafür – auch im Buchtitel – den Humanismus in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit.
An einigen Stellen lässt Nida-Rümelin durchblicken, dass der Humanismus geerdet ist in seiner Tradition von der Antike bis z.B. zu Wilhelm von Humboldt. Damit ist der Humanismus keine beliebige Leerformel. Nida-Rümelin sieht den Humanismus auch zurecht als Widerspruch gegen das allzu Nützliche, gegen ein ökonomisches Diktat, oder gegen die Vereinnahmung durch den zynischen Zeitgeist. Auch sieht sich Nida-Rümelin eher dem Klassischen als dem Romantischen verbunden.
Das ist in der Tat die Grundlage, auf der unsere Gesellschaft eine Zukunft haben kann. Das ist auch die Grundlage, auf der sich die Zukunft von Kultur und Bildung zwischen den verschiedenen politischen Lagern zu diskutieren lohnt. Nida-Rümelin ist natürlich ein Linker, ein SPD-Mitglied. Aber eines, mit dem sich offenbar reden lässt. Das muss man festhalten.
Kritikpunkte
Leider hält Nida-Rümelin die Linie von Rationalität und Tradition nicht konsequent durch. In manchen seiner Texte schwebt der Humanismus als abgehobener Begriff im Raume herum, und wird zu einer Leerformel, mit der sich die Irrtümer des Zeitgeistes verbinden. So plädierte Nida-Rümelin z.B. für die „Vielfalt-Gesellschaft“, in der Religion bzw. Weltanschauung und Nationalkultur eines Menschen nur als irgendwelche Aspekte unter mehreren angesehen werden, die sich beliebig kombinieren und austauschen ließen, so dass daraus eine bunte, vielfältige Gesellschaft entstünde. Bei Nida-Rümelin heißt das „humanistischer Individualismus“. In Wahrheit handelt es sich aber nur um das alte, dumme Multikulti, nur anders verpackt.
Ebenso denkt Nida-Rümelin über einen Mittelweg zwischen Hobbes und Rousseau nach: Zwischen einer Gesellschaft, die durch Zwang von oben zusammenhält, und einer Gesellschaft, die durch Homogenität zusammengehalten wird, glaubt er an ein Modell der Kooperation von Bürgergesellschaft und starken Institutionen des Staates, und einen ethischen Minimalkonsens, der stets neu auszuhandeln sei. Nida-Rümelin übersieht damit völlig, wie stark die Bindekräfte von Traditionen, des Gewachsenen schlechthin, sind, und wie schwer so etwas wieder herzustellen ist, wenn es erst einmal kaputt gemacht wurde. Vielleicht sind Hobbes und Rousseau auch einfach die falschen Gegenpole. Jedenfalls wird weder ein Minimalkonsens, der gerade einmal aus den Menschenrechten besteht, noch ein stets neues Aushandeln je zu einer stabilen Gesellschaft führen. Multikulti funktioniert nur dort, wo es in die klaren Regeln einer Mehrheitsgesellschaft eingebettet ist. Oder anders ausgedrückt: Es funktioniert eigentlich per se überhaupt nicht.
Richtig ist allerdings, dass eine Toleranz aus Indifferenz nicht funktioniert. Toleranz ist nur dort echt, wo sie ganz bewusst Toleranz ausübt gegenüber einer Meinung, die man klar für falsch hält. Toleranz aus Respekt in diesem Sinne ist eine Tautologie. Toleranz ist Respekt vor dem Andersdenkenden, ist Empathie mit den Irrenden.
Auch andere linke Projekte werden von Nida-Rümelin ideologisch gestützt. So z.B. die Ganztagsschule, die angeblich zur Persönlichkeitsbildung beitrage. Oder planwirtschaftliche Elemente wie die Buchpreisbindung. Oder linke Theorien von Gerechtigkeit (John Rawls), denen zufolge Ungleichheit dann gerecht sei, wenn sie den Schwächeren nützt. Da kann man sehr geteilter Meinung sein, ob das den Schwächeren wirklich nützt! Jedenfalls kann man alles übertreiben, und gerade diese positive Diskriminierung scheint heute doch sehr übertrieben zu werden.
Erfrischend unideologisch
Andererseits ist Nida-Rümelin wiederum erfrischend unideologisch. Er wendet sich gegen die anti-humanistischen Impulse im marxistischen und freudianischen Denken: Wer immer nur cui bono? frage, oder immer nur nach psychologisch tieferen Absichten forsche, der verpasse es, den Menschen als Menschen ernst zu nehmen. Nida-Rümelin hatte auch ein richtiges Urteil über den Ostblock, womit er sich keine Freunde machte. Auch möchte Nida-Rümelin Karl Popper rehabilitieren, worin sich Nida-Rümelin mit Thilo Sarrazin trifft, der einstmals zusammen mit Helmut Schmidt Propaganda für Karl Popper in der SPD machte.
Kurz: Man muss nicht alles mögen, was Nida-Rümelin sagt und schreibt, aber man muss Nida-Rümelin als ein faires Gesprächsangebot verstehen, weil tiefere gemeinsame Grundlagen da sind: Der Humanismus. Mit der Idee des Humanismus gibt es eine gemeinsame Basis, auf deren Grundlage man die Zukunft gestalten kann. Linksliberale und Liberalkonservative gemeinsam.
Humanismus ist gewiss ein wichtiger Aspekt der gemeinsamen deutschen Leitkultur. Hier ist nun wiederum allerdings schade, dass Nida-Rümelin diesen Gedanken nicht auch historisch so durchbuchstabiert hat, dass sich humanistisches Denken in allen Kulturen der Welt vorfinden lässt, vom Christentum über den Islam bis hin zum Konfuzianismus.
Einige Randthemen
Sehr wohltuend sind Passagen, in denen Nida-Rümelin den real existierenden Wissenschaftsbetrieb auf die Schippe nimmt. Seiner Meinung nach hätten viele kreative Forscher vergangener Zeiten im heutigen System keine Chance mehr. Wie wahr. – Er wendet sich auch sehr richtig gegen ein Ausspielen der „exakten“ Naturwissenschaften gegen die „Geschwätzwissenschaften“ der Geisteswissenschaften. – Gut beobachtet auch, dass Platon in den Nomoi gegenüber der Politeia umdenkt. – Sloterdijk war wohl anders, als Nida-Rümelin denkt, kein Anti-Humanist. Sarrazin übrigens auch nicht, aber den erwähnt Nida-Rümelin nicht. – Schließlich noch eine Kuriosität: In einem Vortrag von 2001 bezeichnet Nida-Rümelin den historischen deutschen Sonderweg seit 1990 für beendet. Wenn er sich da mal nicht getäuscht hat!
Bewertung: 4 von 5 Sternen.
(Erstveröffentlichung auf Amazon am 03. Oktober 2016)