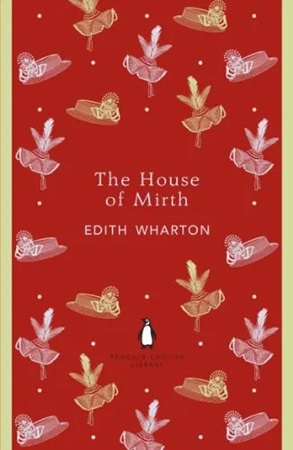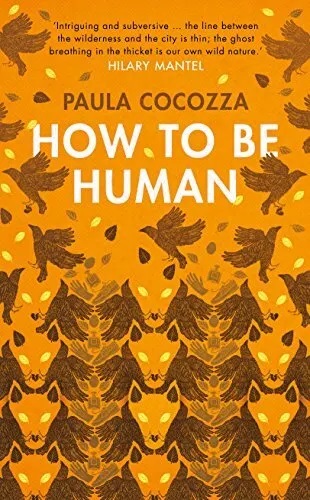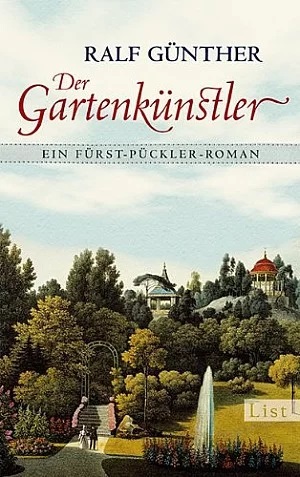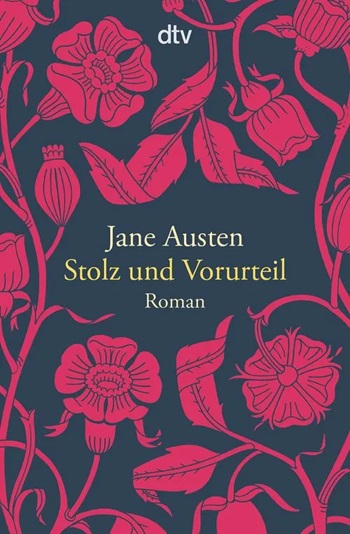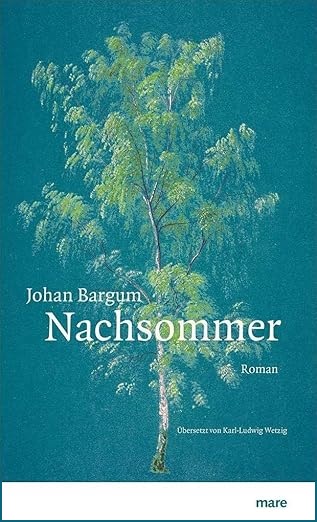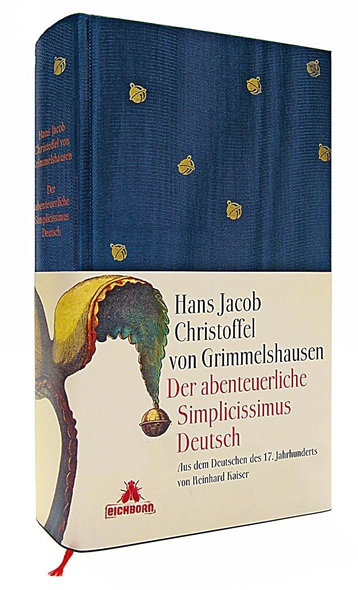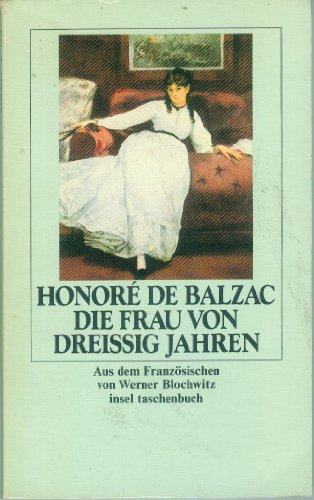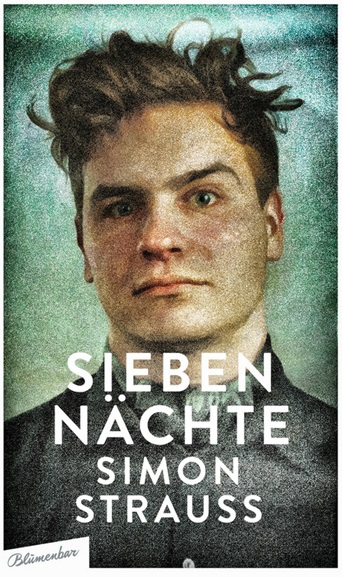
Ausbruchsversuch aus allzu glatten Leben? Nur eine Simulation davon!
Die Novelle „Sieben Nächte“ von Simon Strauß zeigt zunächst das Dilemma des modernen, verwöhnten, politisch korrekt denkenden jungen Menschen: Er hat sich gemeinsam mit seiner Generation ganz im Rahmen des Mainstreams entwickelt und dabei problemlos alles erreicht, was zu einem erfolgreichen aber unauffälligen jugendlichen Durchschnittsleben dazugehört, kurz: Er hatte weder ein Problem mit Mathematik noch ein Problem mit dem Zeitgeist, noch Probleme, Freunde und auch Frauen zu haben. Und jetzt steht er vor dem Beginn des Erwachsenenlebens, das ebenso 08/15 weiterzugehen droht wie seine Jugend: Heiraten, Kinder bekommen, ein Haus bauen, festangestellt sein. Doch dieses Leben ist zu glatt, zu brav, zu gewöhnlich. Es ist weder etwas besonderes noch vermittelt es Sinn. Es gab auch keine Widerstände, an denen man hätte wachsen und reifen können. Alles ist irgendwie kindisch und läppisch. Man war nicht einmal bei der Bundeswehr.
In dieser Situation beschließt der Protagonist, angeregt durch einen Bekannten, der auch das Schlusswort schreiben wird, in sieben Nächten jeweils eine der sieben Todsünden auszuleben und dies in den folgenden sieben Kapiteln schriftlich festzuhalten. Er will damit erreichen, etwas besonderes zu tun, persönlich zu reifen, und der Wildheit der Jugend ein Denkmal zu setzen, bevor er sich der Langweiligkeit des Erwachsenenlebens hingeben wird.
Die sieben Kapitel zu den sieben Nächten mit den sieben Todsünden sind moderne literarische Variationen der bekannten sieben Todsünden, die interessant, anregend, und teils packend zu lesen sind. Der Autor schafft es zweifelsohne, viele Fragen, Probleme und Situationen zu thematisieren, die dem Leser nur allzu bekannt sind. Das Schlusswort zieht dann ein etwas lendenlahmes Fazit: So richtig erfolgreich war der Ausbruchsversuch eigentlich nicht, aber er würde dennoch in Erinnerung bleiben und deshalb irgendwie wertvoll sein. Ein dem Buch vorangestelltes Gedicht beklagt das Schicksal des Dandys, schließt dann aber überraschend mit der Zeile: „Dandy, you’re all right.“
Kritik
Zunächst ist zu fragen, warum der Übergang in ein langweiliges Erwachsenleben einen dramatischen Verlust an Lebendigkeit, Freiheit etc. bedeuten sein soll, wenn bereits die Jugend langweilig war? Hier bäumt sich niemand auf, um die Wildheit der Jugend zu bewahren, denn bereits die Jugend war nach eigener Auskunft allzu glatt und allzu langweilig. Dies ist ein echter Selbstwiderspruch in diesem Buch, wenn auch verzeihlich, denn dann wäre es eben kein „letzter“ sondern der erste und einzige Ausbruchsversuch aus einem langweiligen Leben.
Dann ist zu fragen, warum das Verhalten in den sieben Nächten, also das Begehen der sieben Todsünden, ein Ausbruch aus der beklagten Langweiligkeit sein soll? Denn was in diesen sieben Nächten geschieht, entspricht doch ganz der Langweiligkeit der allzu glatt verlebten Jugend! Er ist hochmütig, wie es verwöhnte Jugendliche nun einmal sind, er schläft wollüstig mit einer Frau, was er nach eigener Auskunft ebenfalls schon mehrfach getan hatte, usw. Dieser Widerspruch führt beim Leser zu ersten Zweifeln: Hat der Autor übersehen, dass dieser „Ausbruch“ gar keiner ist?!
Es ist vor allem zu fragen, warum man „sündigen“ muss, um zu reifen? Auch durch „Sünden“ kann sich eine gewisse Reife ergeben (wenn man seine Schuld einsieht), aber echte Reife erlangt man doch vor allem gerade dadurch, dass man gegen Widerstände das Richtige tut. Also z.B., dass man schwierige Probleme mit Geduld löst, etwa an einem schwierigen Studium dranbleibt. Oder eine Freundschaft bzw. eine Ehe über Höhen und Tiefen hinweg erhält. Oder das Erschaffen eines literarischen oder wissenschaftlicher Werkes über viele Jahre hinweg. Das Aalglatte hingegen tut selten gut. So mancher tut sich allzu leicht, mit Frauen im Bett zu landen, scheitert aber an der Liebe. So mancher hat viel Spaß mit Freunden, ist aber völlig ignorant gegenüber dem Leiden anderer. So mancher plappert die öffentlichen Meinungen beifallheischend nach, und seien es nur die ewig doofen Witze über republikanische US-Präsidenten, hat aber keine eigene Meinung, die er sich unter Mühen und Irrtümern errungen hätte, und für die er bereit wäre, sich lächerlich zu machen.
Auch die Perspektive auf ein angeblich langweiliges Erwachsenenleben ist völlig falsch: Warum sollte es langweilig sein, zu heiraten, eine Familie zu gründen, ein Haus zu bauen und einen Beruf zu ergreifen? So kann nur jemand denken, der sich dem Mainstream so sehr hingegeben hat, dass er sich gar nichts anderes mehr vorstellen kann als den Mainstream. Denn heiratet man eine Frau nicht auch deshalb, um in ihr eine seelenverwandte, erhellte Verbündete gegen die Anfeindungen der dumpfen Mitwelt zu haben? Wird man nicht versuchen, seine Kinder so zu erziehen, dass sie zu großartigen, selbständigen, besonderen Menschen werden? Wird man nicht vielleicht auch im Beruf oder im Hobby versuchen, die Welt irgendwie zu verbessern? Als Lehrer seine Schüler auf das Leben vorbereiten? Als Krankenschwester die Leiden von Kranken lindern? Das Besondere kann manchmal sehr einfach sein. Wer ein Überzeugter ist, wird immer und überall auf irgendeine Weise wirken.
Völlig ausgeblendet wird die große Frage nach Religion und Weltanschauung. Eine richtige Religion oder Weltanschauung mit der entsprechenden Moral zu finden bzw. zu erarbeiten und mit großem Ernst und großer Konsequenz danach zu leben, sollte eigentlich eine der wichtigsten Aufgaben eines erhellten jungen Menschen sein, und würde auch dem Zeitgeist (vermutlich aller Zeiten) völlig zuwiderlaufen. Davon ist in diesem Buch aber an keiner Stelle die Rede.
„Faschistisch“?
Dem Buch wurde vorgeworfen, „faschistisch“ zu sein. Das ist Unfug. Weder wird die Demokratie noch die Gleichberechtigung von Mann und Frau noch sonst etwas derartiges ernsthaft in Frage gestellt. Es wird lediglich der Wunsch formuliert, besonders und sinnvoll zu leben, und nicht langweilig und grau. Das ist zwar elitär und gegen den (derzeit linksliberalen) Zeitgeist, aber nur deshalb, weil es schon immer so war, dass sich nur wenige Menschen solche Gedanken machen. In diesem Sinne ist auch jeder Linksintellektuelle elitär. – Vermutlich stammt der Vorwurf daher, dass Simon Strauß der Sohn von Botho Strauß ist, und sich sprachliche und thematische Parallelen zwischen den Werken beider entdecken lassen. Aber auch Botho Strauß war kein „Faschist“, sondern wurde nur als solcher verschrieen.
Konservativ?
Die Idee, durch „Sünden“ zu reifen, ist so ziemlich das Anti-Konservativste, was man sich ausdenken kann. Nein, dieses Buch ist nicht konservativ. Man könnte lediglich die Fragestellung, von der das Buch ausgeht, und die Respektlosigkeit vor dem linksliberalen Zeitgeist, die sich in einigen Passagen zeigt, als konservativ bezeichnen. Diese Punkte sind auch das einzig Gute an diesem Buch.
Visionsloser Trotz und stilles Einverständnis mit der Langweiligkeit des Mainstream
In Wahrheit bleibt der Autor dieses Buches selbst noch in seinem Widerstand gegen den Zeitgeist in demselben gefangen. Es ist nämlich sehr linksliberal gedacht, dass man durch „sündigen“ reift, denn „sündigen“ ist der Inbegriff der Überschreitung von Verboten, die eine konservative Autorität angeblich deshalb aufgestellt hat, um die Menschen wie Kinder zu halten. Es ist sehr linksliberal gedacht, Ehe, Familie, und Beruf grau in grau zu sehen: Die Familie als die „Agentur der kapitalistischen Konsumgesellschaft“, der Beruf als willenlose Knechtschaft im Dienste des Kapitalismus. Es ist sehr linksliberal gedacht, Sex wie einen Schluck Wasser zu konsumieren, und Liebe als konservatives Konzept beiseite zu schieben. Diese Stereotypen stecken offenbar tief im Inneren des Autors, und er konnte sich nicht von ihnen lösen, sie nicht überwinden, und nun lehnt er sich wie ein trotziges Kind aufgrund eines unausgegorenen Unbehagens dagegen auf, ohne zu wissen, was er statt dessen eigentlich wollen sollte. Tugendhaftigkeit, Ehe, Familie, Beruf und Liebe will er offenbar nicht, weil er das Abenteuer in ihnen nicht erkennen kann. Und das Thema Religion und Weltanschauung fehlt völlig. Damit würde aber jede echte Kritik am Zeitgeist beginnen müssen.
Am Ende scheint der aufbegehrende Protagonist (bzw. der Autor selbst, wer sonst?) mit dem Schicksal des Dandy sogar ganz zufrieden zu sein. Das wird sehr deutlich in dem einleitende Gedicht, das mit „Dandy, you’re all right“ endet, und im Schlusswort, das sich mit einem gescheiterten Ausbruchsversuch völlig zufrieden gibt. Allzu schnell kehrt man in den grauen Mainstream zurück. Ein echter Ausbruchsversuch war vom Autor offenbar nie geplant. Alles war im Grunde eine Simulation von Ausbruch, die sich als Teil des Mainstream entpuppt. Die Simulation von Widerstand als Initiationsritus in den grauen Erwachsenen-Mainstream. Damit kann man’s dann ganz vergessen. Das ist im Grunde genau das Problem, vor dem der Vater des Autors 1993 im „Anschwellenden Bocksgesang“ gewarnt hatte:
„Heute benutzen Majorität und Minderheit, gleich welcher Sparte, durchweg dasselbe konforme Vokabular der Empörungen und Bedürfnisse. Dem gegenüber werden sich strengere Formen der Abweichung und der Unterbrechung als nötig erweisen; … … … Der Widerstand ist heute schwerer zu haben, der Konformismus ist intelligent, facettenreich, heimtückischer und gefräßiger als vordem, das Gutgemeinte gemeiner als der offene Blödsinn, gegen den man früher Opposition oder Abkehr zeigte.“ – „Dabei: so viele wunderbare Dichter, die noch zu lesen sind – so viel Stoff und Vorbildlichkeit für einen jungen Menschen, um ein Einzelgänger zu werden. Man muß nur wählen können; das einzige, was man braucht, ist der Mut zur Sezession, zur Abkehr vom Mainstream. Ich bin davon überzeugt, daß die magischen Orte der Absonderung, daß ein versprengtes Häuflein von inspirierten Nichteinverstandenen für den Erhalt des allgemeinen Verständigungssystems unerläßlich ist. Nicht zuletzt deshalb steht man jetzt vor einer gigantischen Masse an Indifferenz unter den Jugendlichen, weil die politisierte Gesellschaft sich ausschließlich mit korporierten Minderheiten beschäftigt hat und keinerlei Prägemuster für den Einzelgänger zur Verfügung stellte.“
Fazit
Die Langweiligkeit einer aalglatt und zeitgeistig verlebten Jugend zu thematisieren und danach zu fragen, wie man reift und ein besonderes und sinnvolles Leben lebt, ist ein großartiger Ansatz und eine wichtige Fragestellung. Die Ausführung dieses Ansatzes muss jedoch als völlig gescheitert angesehen werden. Insbesondere ist es dem Autor nicht gelungen, wesentliche Irrtümer des Zeitgeistes zu überwinden. Schlimmer noch: Der Autor scheint eine Überwindung des aalglatten Lebens in Wahrheit gar nicht anzustreben, sondern sich mit einer vorübergehenden Simulation von Widerstand zufrieden zu geben, die in Wahrheit auch nur Teil des Mainstreams ist, den er im Grunde bejaht.
Es bleiben der Ansatz des Buches und einige lesenwerte literarische Miniaturen und zum eigenen Denken anregende Textstücke. Für den Rest gilt: Dandy, you’re NOT all right.
Bewertung: 2 von 5 Sternen.
(Erstveröffentlichung auf Amazon am 08. Juni 2019)