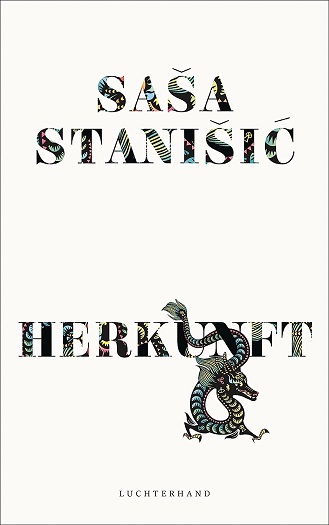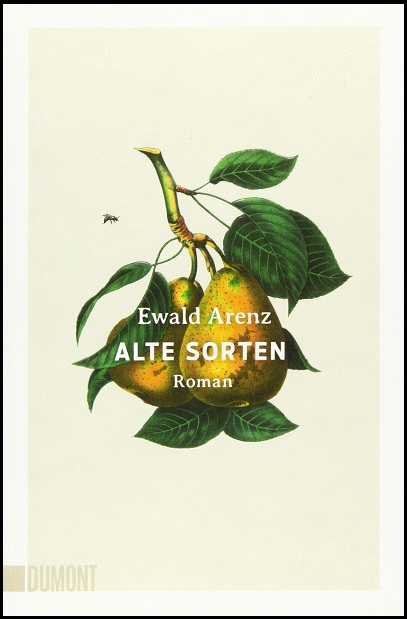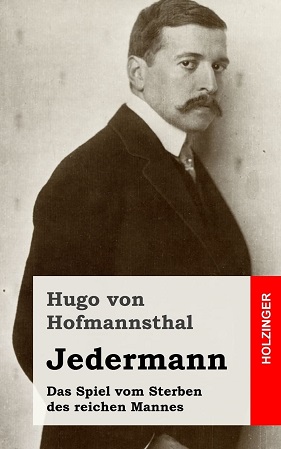
Große Enttäuschung: Offenbar Lieblingsstück primitiver Antikapitalisten
Wer hat nicht schon vom „Jedermann“ gehört? Dieses legendäre Stück, dass immer in Salzburg aufgeführt wird, das nur von den besten Schauspielern gespielt werden darf, dieser Eckstein der weltweiten Theaterkultur: Man muss es gelesen haben! Also ran.
Das Stück „Jedermann: Das Spiel vom Sterben des reichen Mannes“ ist in Stil und Inhalt ganz in der Art eines Jesuiten-Theaters zur christlichen Belehrung der gläubigen Massen gehalten. Es ist in der Tat eine Adaption frühneuzeitlicher Vorlagen.
Der Inhalt ist überraschend stupide: Ein reicher Mann, um die 40, erfährt, dass er sterben muss, und sucht nun Begleiter in den Tod, die ihn vor Gott rechtfertigen sollen. Doch alle winken ab: Sein Freund ebenso wie seine Verwandten und Knechte. Auch sein eigener Mammon verweigert ihm die Gefolgschaft. Nur die Personifikationen von guten Werken und Glaube retten ihn am Ende, nachdem er sich reumütig zum christlichen Glauben bekehrt hat.
Drei Probleme
Das Stück leidet zunächst an zwei Problemen: Zum einen ist es strikt im Rahmen eines altbackenen christlichen Glaubens gehalten, den es an keiner Stelle symbolisch überhöht oder modern deutet. Noch größer ist jedoch das Problem, dass die zu Beginn des Stückes vorgeführten Sünden des Herrn Jedermann überhaupt keine Sünden sind!
- „Sünde“ Nr. 1: Ein Bettler kommt zu Jedermann, Jedermann gibt ihm spontan etwas Geld. Doch der Bettler will gleich den ganzen Geldbeutel. Dies weist Jedermann zurück. Wo soll hier eine Sünde sein? Es ist nur vernünftig.
- „Sünde“ Nr. 2: Ein Schuldner wird in den Schuldturm geworfen. Jedermann findet das richtig, denn der Schuldner hat den Gläubiger schließlich um sein Geld betrogen. Eine Sünde kann man das nicht nennen, denn es ist gerecht. Aber dabei bleibt Jedermann nicht stehen: Jedermann übernimmt für die mittellose Familie des Schuldners Kost und Logis! Das ist keine Sünde, das ist eine soziale Tat!
- „Sünde“ Nr. 3: Jedermann hat eine Freundin und scheut es, sich in der Ehe zu binden. Er lebt gerne und gut in Geselligkeit mit Freunden. Hier könnte man vielleicht den Unwillen, sich zu binden, kritisieren, aber von einer schweren Sünde ist hier weit und breit nichts zu sehen. Die Toskana-Fraktion der Antikapitalisten lebt nicht anders.
- „Sünde“ Nr. 4: Jedermann hat Gott und die Erlösertat Christi vergessen. Das ist natürlich eine Todsünde – aber nur im Rahmen eines altbacken christgläubigen Weltbildes! Moderne Menschen können damit nichts anfangen, zumal sich Jedermann durchaus sozial verhält, wie wir sahen.
Fast schon sympathisch ist Jedermanns unfreiwillig herausgerutschter Satz, gemünzt nicht auf seine engeren Freunde, sondern auf andere Gäste seines Hauses:
„Wie Ihr da seid hereingelaufen,
So könnte ich Euch alle kaufen,
Und wiederum verkaufen auch,
Dass es mir nit so nahe ging
Als eines Fingernagels Bruch.“
Sympathisch deshalb, weil Jedermann mit diesen Worten die aus dem Kontext dieser Stelle ersichtlichen wahren Motive jener Gäste entlarvt, die nicht seine Freunde sind, sondern nur von seinem Reichtum an seiner Tafel profitieren wollen.
Das dritte Problem sind diverse Lächerlichkeiten:
Lächerlich wird das Stück, wo Jedermann eines Lebens bezichtigt wird, das dem Klischee des dekadenten, egoistischen Reichen entspricht: Lächerlich deshalb, weil wir doch zuvor sahen, dass es so nicht ist. Jedermann ist nicht Ebenezer Scrooge, sondern zu Almosen und sozialer Unterstützung bereit. Das Stück enthält hier einen eklatanten Selbstwiderspruch.
Lächerlich ist auch der Versuch des Stückes, in der Absage von Freunden, Verwandten und Knechten, Jedermann in den Tod zu begleiten, eine moralische Aussage sehen zu wollen. So ein Unsinn! Man kann selbst vom besten Freund zwar viel verlangen, aber den Tod wohl kaum. Damit wendet sich die Dramatik der Absagen an Jedermann ins Lächerliche. Selbst für einen gläubigen Christen ist der Gedankengang fragwürdig, einen Freund in den Tod zu begleiten. Solches hat man zuletzt von den Sumerern gehört, wo die Könige sich mitsamt ihrem extra zu diesem Zweck getöteten Hofstaat bestatten ließen, und das gilt als barbarisch.
Und übrigens: Wieso sollte ein Freund, der ebenso „sündig“ gelebt hat wie Jedermann, ihm im Jenseits irgendwie helfen können?! Hier ist das Stück auch logisch brüchig.
Woher der Erfolg?
Wie kommt es nun, dass ein so völlig aus unserer Zeit gefallenes und im Grunde lächerliches Stück einen solchen Erfolg feiern konnte? Die Antwort ist einfach: Der einzig mögliche moderne Anknüpfungspunkt ist ein primitiver Antikapitalismus. Jedermann, der – wie wir sahen – eigentlich ganz vernünftig ist, wird gerade deshalb angefeindet, weil er reich ist und Geld hat. Der Reichtum an sich (!) wird bereits verteufelt, und nicht so sehr, wie er verwendet wird.
Während Jedermann sagt:
„Geld ist wie eine andere War‘
Das sind Verträge und Rechte klar“
sagt der Schuldner:
„Geld ist nicht so wie andre War‘
Ist ein verflucht und zaubrisch Wesen, …
Des Satans Fangnetz in der Welt
Hat keinen anderen Nam als Geld.“
Reichtum, Geld, Zinsen: Einfach alles Teufelszeug. Schuldig ist – natürlich! – nicht der, der geliehenes Geld nicht zurückzahlen kann, sondern der, der es verliehen hatte. Das ist nichts anderes als ein primitiver Antikapitalismus, der auf einem fundamentalen Nichtverstehen von ökonomischen Zusammenhängen beruht. Nur das kann den Erfolg dieses Stückes erklären. Hier ist übrigens das üble Klischeebild vom jüdischen Wucherer nicht fern, der die braven Nichtjuden in die „Zinsknechtschaft“ führt. So manche mittelalterliche Judenhatz beruhte auf diesem falschen Denken, und als das Stück zum ersten Mal in Salzburg aufgeführt wurde (1920), meinten nicht wenige mit Karl Marx („Zur Judenfrage“, 1843) eine enge Verbindung von jüdischer Kultur und dem „bösen“ Kapitalismus erkennen zu können. Wir sehen, in welchen Sphären des Geistes wir uns bewegen.
Hier geht das schiefe Bild des Christentums von Reich und Arm eine üble Synthese ein mit modernem sozialistischen Gedankengut. Der Autor Hugo von Hofmannsthal war übrigens kein Sozialist, sondern ein Monarchist und Konservativer. Aber in der Kritik am Kapitalismus treffen sich Christentum und Sozialismus offenbar.
Indem man sich um dieses Stück versammelt, macht man ein politisches Statement. Alle, die sich um es scharen, und es von Jahr zu Jahr als Eckstein der Kultur hochleben lassen, erklären dadurch gleichzeitig jeden, der sich dem Stück verweigert, jeden Befürworter einer sozialen Marktwirtschaft, zu einem kulturellen Banausen. Zu einem unsensiblen Dummkopf, der eben mangels Sensibilität nicht verstanden habe, worauf es in der Welt ankomme.
In diesem Stück wird der Vernünftige zum Bösewicht gemacht, und das Unvernünftige des antikapitalistischen Denkens zur Weihe der höchsten Moral erhoben. Und in der Tat: Wenn man die positiven Amazon-Rezensionen durchliest, findet man immer wieder Aussagen wie die, dass Jedermann selbst Almosen für Bettler verweigern würde. An dieser Falschaussage sieht man, mit welchen Augen das Stück gelesen wird, und welchen falschen Eindruck es bei weniger gebildeten Lesern und Zuschauern hinterlässt.
Schluss
Der einzige Trost für aufgeklärte Menschen ist, dass dieses Stück das Kindische dieser antikapitalistischen Sichtweise durch die bezeichnenderweise gut passende Einbettung in die kindliche Gläubigkeit des Mittelalters unfreiwillig als kindisch entlarvt und mit sich ins Lächerliche zieht.
All diese vernunftwidrigen Pharisäer, die sich den teuren Theaterurlaub in Salzburg gönnen, und sich im Mainstream einer Schickeria von Gleichgesinnten sonnen, während der selbstbestätigende Beifall am Ende dieses antiaufklärerischen Stückes aufbrandet: Ihnen ruft die Stimme der Vernunft hinterher: „Jedermann! Jedermann!“ – Ihnen legt Athene die Frage vor, welche Vernunftleistung sie für ihren Nachruhm sprechen lassen wollen! – Ihnen wird beim Symposion von Sokrates eine Abfuhr erteilt!
Sie sind die wahren Jedermänner!
Bewertung: 1 von 5 Sternen.
(Erstveröffentlichung auf Amazon ca. April 2014; 31.08.2023 festgestellt, dass die Rezension auf Amazon nirgends mehr zu finden ist.)