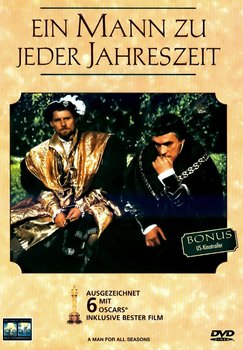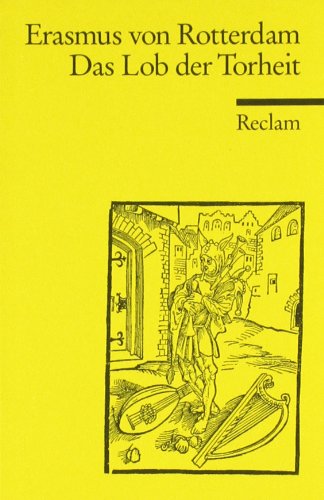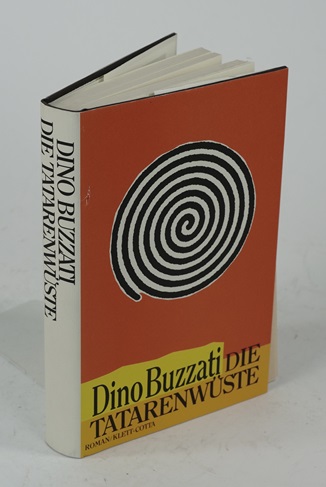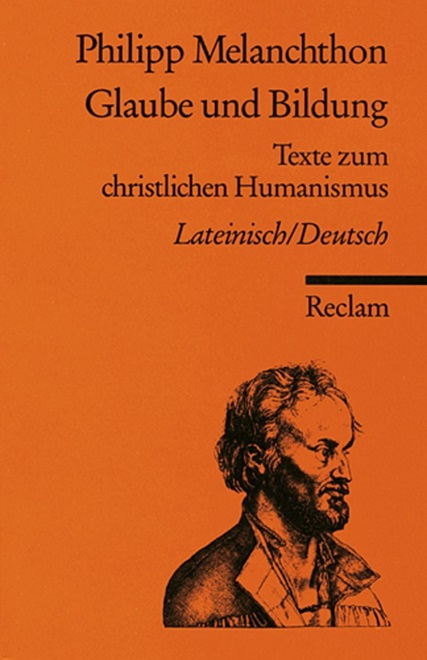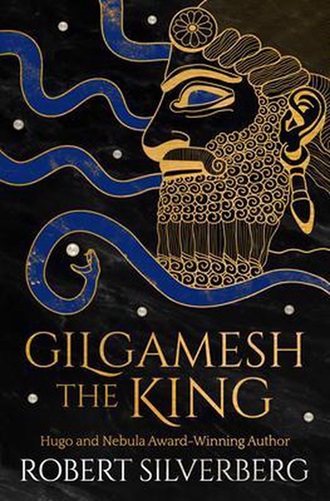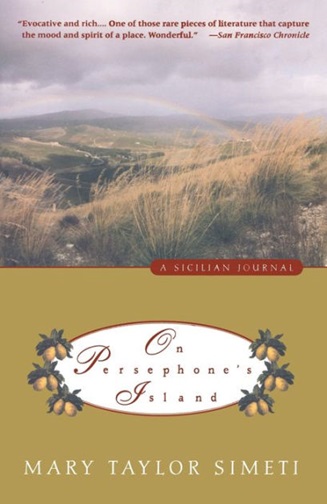Campanellas Sonnenstadt als Brutstätte sozialistischen Denkens
Der Text „Die Sonnenstadt“ (La città del Sole), oft fälschlich als „Sonnenstaat“ übersetzt, ist das politische Programm eines praktizierenden Sozialrevolutionärs aus dem Jahr 1602, veröffentlicht 1623. Es ist keine satirische Schrift wie die „Utopia“ des Thomas Morus, der seiner Zeit ironisch den Spiegel vorhalten wollte und nicht ernsthaft an die Verwirklichung seiner Ideen dachte. Und es ist auch keine Wissenschaftsvision wie das „Neu-Atlantis“ von Francis Bacon, wo der Schwerpunkt auf noch zu machenden Erfindungen liegt. Campanella zählt an Techniken und Methoden nur auf, was die Renaissance bereits zu bieten hatte, bis hin zur Idee der Flugmaschinen.
Lupenreiner Sozialismus
Im Mittelpunkt der Betrachtungen stehen die sozialen Verhältnisse, die in herzlich naiver Weise einen lupenreinen Sozialismus propagieren. Es ist für den modernen Leser ganz und gar erstaunlich, wie exemplarisch die einzelnen Aspekte des Sozialismus in dieser Schrift Punkt für Punkt abgehandelt werden:
Niemand besitzt etwas für sich, alle bekommen das Ihre von den Beamten zugeteilt. Die Menschen seien durch Besitzlosigkeit zum Gemeinsinn befreit. Die Familie ist aufgelöst. Geschlechtsverkehr findet ausschließlich zur Triebbefriedigung und zur Fortpflanzung statt, wobei die Partner von Beamten ausgewählt werden. Die Kinder werden gemeinschaftlich erzogen. Liebe spielt sich nur auf platonischer Ebene ab, Eifersucht gäbe es nicht.
Es gibt keine schweren Verbrechen, da die Menschen zu höchstem Edelsinn befreit seien. Eine Erbsünde, d.h. eine grundsätzliche Verstricktheit des Menschen in das Böse, gäbe es nicht, sondern Fehler und Verbrechen seien immer eine Folge falscher Erziehung, falscher gesellschaftlicher Verhältnisse usw. und damit grundsätzlich beseitigbar.
Die Herrscher gäben ihr Amt freiwillig ab, wenn sich jemand fände, der weiser ist als sie. Die Menschen strebten alle voller Eifer nach Bildung und Pflichterfüllung für die Gemeinschaft. Eigeninitiative ist nicht vorgesehen. Individuelle Begabungen sind darauf angewiesen, von Beamten erkannt und gefördert zu werden.
Kritik
Es ist kein Zufall, dass Campanella Aristoteles grundsätzlich ablehnt und schmäht. Ein realistischer Einwand des Aristoteles, der stellvertretend die ganze Kritik an solchen sozialistischen Blütenträumen repräsentiert, dass nämlich der Eine immer darauf warte, dass ein anderer die Arbeit für ihn tue, wird kurz abgetan. Der Realist Aristoteles wird von Campanella als Pedant verschrieen.
Damit wird auch deutlich, dass Campanellas Naivität nicht verzeihlich ist. Manche meinen ihn entschuldigen zu müssen, weil er ein so früher Denker sei, dass er noch nicht wissen konnte, wie der Sozialismus an der Realität scheitern wird. Doch dies ist unzutreffend. Man hat dies schon immer gewusst und wissen können.
Da ist es auch keine Entschuldigung, dass die spanische oder kirchliche Herrschaft zu seiner Zeit nach einer Revolution schrie. Eine Revolution muss keine sozialistische Revolution sein, wenn sie z.B. humanistisch orientiert ist und Athen und Rom vor Augen hat, was der Zeit Campanellas nicht ferngelegen hätte.
Herkunft der sozialistischen Ideen
Was aber hatte Campanella dann vor Augen, wenn nicht Athen oder Rom? Woher kommen überhaupt seine sozialistischen Ideen? Es wird deutlich in seinen Worten von den vielen Gliedern des einen Gemeinwesens, einem Wort des Apostels Paulus, das das ideale Zusammenwirken aller Gläubigen in der heiligen Gemeinschaft der Kirche beschreibt. Campanellas Sonnenstadt folgt ganz offensichtlich dem christlich-religiösen Ideal der idealen Gemeinschaft der Gläubigen unter einer perfekt funktionierenden Hierarchie! Wahrhaft aufklärerisches Denken sieht anders aus.
Selten hat sich die These, dass der Sozialismus eine säkularisierte Wendung des christlich-religiösen Glaubens ist, so bestätigt gefunden wie hier. Hier bei Campanella sind wir ganz dicht dran an der originalen Brutstätte der sozialistischen Ideen.
PS 29-SEP-2013: Die Rezension macht zu wenig deutlich, dass der sozialistische Charakter auch durch Übernahmen aus Platons Politeia zustande kommt. Damit hat Campanella die liberale Wende Platons in dessen späteren Werk Nomoi ignoriert, es liegt eine typische Fehlinterpretation Platons vor.
Einige bemerkenswerte Einzelaspekte
Völlig befremdlich ist die Ausgestaltung der Strafen in der Sonnenstadt; sie sehen alles andere als zivilisiert aus, sondern erinnern an archaische Stammestraditionen: Es gibt die kollektive Steinigung, Verbrennen, Todesstrafe ohne vorherige Diskussion, für die Wahrheitsfindung nutzlose Mindestanzahlen von Zeugen, und unbeweisbare Anklagen fallen auf den Ankläger zurück. Im Übrigen gilt das Prinzip Auge um Auge, Zahn um Zahn.
Bei Campanella sieht man sehr eindrücklich, wie Astrologie und Astronomie noch eine gemeinsame Wissenschaft bilden. Neue Erkenntnisse über Himmelsmechanik und Zeichendeutung gehen hier noch Hand in Hand. Gegen Ende schweift der Text sogar vom Thema der Sonnenstadt ab und verliert sich in astrologischen Prophezeiungen über die Zukunft Europas.
Hat die Sonnenstadt etwas mit Platons Atlantis zu tun? Nein.
Der Stadtgrundriss der Sonnenstadt mit ihren sieben Mauerringen auf einem Hügel, die den sieben Planeten zugeordnet sind, gleicht verblüffend der Stadt Ekbatana, wie sie von Herodot beschrieben wird, nicht jedoch Platons Atlantis, das drei Ringe von Wasser und Land um einen Hügel herum aufweist. Der Tempel in der Mitte hat nichts mit Platons Atlantis zu tun, ebenso wenig der Kult der Sonnenstadt. Wasserringe tauchen auch keine auf, lediglich Burggräben, was etwas völlig anderes ist.
Auch sonst weist nichts auf Atlantis: Keine rechteckige Ebene, keine Lage am Rande einer Ebene, kein schwarz-weiß-rotes Gestein, keine zwei Quellen, keine Gründungslegende mit fünf Zwillingspaaren, und auch kein Sittenverfall gefolgt von einem Angriff auf den Rest der Welt. Campanella macht zwar zahlreiche Anleihen bei Platon, jedoch nur bei dessen Staatsutopie Politeia, nicht aber bei dessen Atlantisdialogen. Zumal Atlantis bei Platon ja auch nicht positiv sondern negativ gezeichnet wird.
Eindeutig erkennbar sind Anleihen bei der Utopie des Thomas Morus, vor allem was die Rahmenhandlung betrifft. Dabei ist die Utopie des Thomas Morus selbst wiederum eine Karikatur der britischen Insel, nicht aber der Insel Atlantis. Es wäre also schlicht falsch zu behaupten, Campanella hätte sich zu seiner Sonnenstadt von Platons Atlantis inspirieren lassen. Ein solcher Zusammenhang ist nirgends erkennbar.
Fazit
Für die Aufarbeitung und Präsentation des Textes mit Anmerkungen und Nachwort gibt es vier von fünf Punkten; ein Punkt Abzug für ein zu großes Verständnis für die gefährlichen Ideen Campanellas.
Bewertung: 4 von 5 Sternen.
(Erstveröffentlichung auf Amazon am 27. Juli 2010)