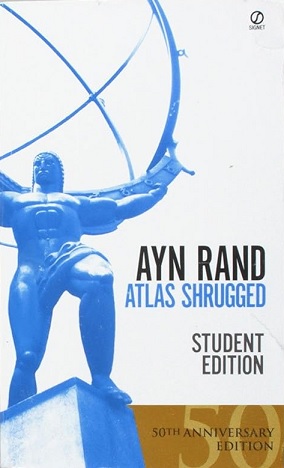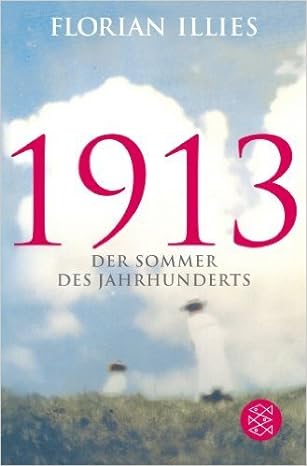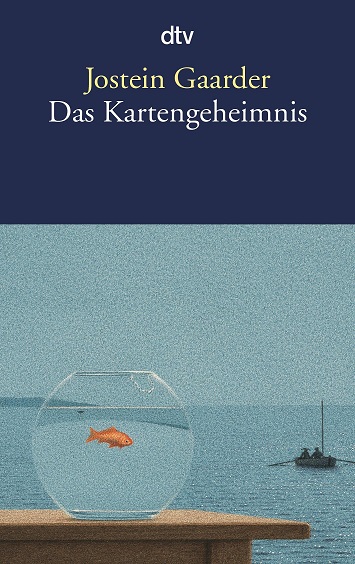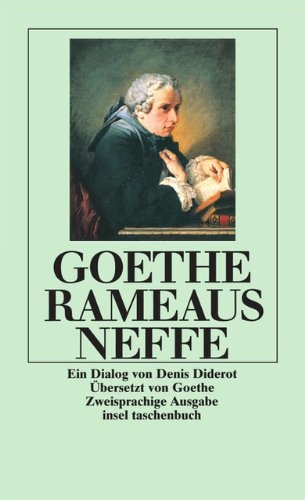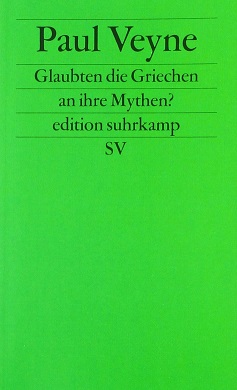Glaubt Paul Veyne eigentlich an seine eigenen Mythen?! Postmoderne Hardcore-Ideologie statt lehrreicher Mythenforschung
Wer sich mit Deutung und Funktion von Mythen befasst, wird immer wieder über eine ganz bestimmte Literaturangabe stolpern: Paul Veyne, „Glaubten die Griechen an ihre Mythen?“. Der geneigte Leser erwartet bei einem solchen provokant-launigen Titel einerseits kundige Anleitung und Aufklärung über das schillernde Phänomen der Mythen und deren variationsreiche Wahrnehmung schon zu Zeit der alten Griechen, andererseits aber auch einen vergnüglichen und geistreichen Essay zum Thema, dessen Lektüre die reine Freude ist. Manche Literatur empfiehlt diese Schrift ganz in diesem Sinne, womit offenbar zugleich die Bildung und Gelehrsamkeit des Empfehlenden demonstriert werden soll.
Doch je weiter man in dieses Büchlein hineinliest, desto krasser die Enttäuschung des Lesers. Es handelt sich nicht um das erwartete lehrreiche Lesevergnügen, sondern – o Schreck! – um die Deklaration einer postmodernen, anti-rationalistischen und sogar anti-humanistischen Hardcore-Ideologie. Das eigentliche Thema des Buches, die Mythen der alten Griechen, dient offenbar lediglich als Kulisse zur Manifestation dieser Ideologie, und wird dieser brutal untergeordnet. Soviel Unsinn zur Antike wie hier hat man selten gelesen. Und dem philosophisch Gebildeten rollen sich sämtliche Fußnägel auf.
Daran, dass dieses Büchlein in den Literaturangaben zum Thema Mythologie immer wieder „mitgeschleift“ wird, obwohl praktisch kein Autor auf die eigentlichen Aussagen Veynes eingeht, kann man erkennen, dass die wenigsten es gelesen haben, und dass das Büchlein nur wegen seines schönen und interessanten Titels angeführt wird, und vielleicht deshalb, weil man dem Autor einen gewissen Ruf zubilligt, ohne Näheres über ihn zu wissen. Es scheint bislang nur recht kurz angebundene Rezensionen zu geben, die dieses Büchlein kritisch in den Blick nehmen. So z.B. die deutlich ablehnende Rezension von Simon Goldhill vom King’s College, Cambridge, in „The Classical Review“ von 1990. Es ist also Zeit für eine gründliche Besprechung.
Worin besteht die Ideologie von Paul Veyne?
Paul Veyne glaubt, dass die Menschen – schon immer, jetzt, und für alle Zukunft – in völlig willkürlichen Illusionen leben, die sich allein und ausschließlich der Einbildungskraft verdanken. Ob etwas Realität oder Fiktion sei, liege allein im Auge des Betrachters (S. 33 f.). Die „Wahrheit“ umschließe sowohl Mythos als auch Fiktion (S. 27). Der Glaube an „Alice im Wunderland“ beim Lesen dieses Buches wird gleichgesetzt mit dem Glauben an die Erkenntnisse der Physik (S. 34). Statt von Wahrheit spricht Veyne lieber von Wahrheitsprogrammen oder Wahrheitspalästen, die viel größer sind als die Gegensätze von Wahrheit und Irrtum, Vernunft und Mythos, Imagination und Wirklichkeit; obwohl sich die Wahrheiten der verschiedenen Wahrheitspaläste vielfach widersprechen, widersprechen sie sich doch nicht, denn in sich sei jeder von ihnen vernünftig und wahr (S. 105, 146 f.). So Paul Veyne.
Die Realität zählt bei der Feststellung von Wahrheit nicht. Mit Nietzsche sagt Paul Veyne: „Die Tatsachen existieren nicht“ (S. 52 f.), denn Tatsachen existieren nicht für sich allein, sondern müssen immer interpretiert werden. Die Wahrheit stamme nicht aus der Realität (S. 105). Paul Veyne meint, dass Husserl irre, wenn er Imaginäres und Erfahrung zu trennen versuche, denn das Imaginäre sei letztlich genauso wahr (S. 108). Zwar gäbe es tatsächlich eine materielle Wirklichkeit, so Veyne, doch diese werde immer interpretiert oder ignoriert (S. 129). Für ihn steht alles auf einer Stufe: Religiöser Glaube, ein Roman, oder die physikalischen Theorien Albert Einsteins; Empirismus sei eine Größe, die man vernachlässigen könne, meint Veyne (S. 140).
Auch die Vernunft sei ganz nutzlos und eine Illusion. Statt der Vernunft würden die Menschen von ihren Interessen geleitet. Alle Wahrheiten kämen von der Einbildungskraft her, nicht von der Vernunft (S. 35). Deshalb entschuldigt Veyne auch das interessegeleitete Lügen, und es sei ganz falsch, einen Gegensatz von Philosophie und Rhetorik zu sehen, denn auch die Philosophie folge weder der Vernunft noch der Wahrheit, sondern allein dem Interesse (S. 72). Das sei auch dann so, wenn wir uns über uns selbst täuschen und unsere eigenen interessegeleiteten Motive nicht erkennen würden (S. 72). Es würden auch niemals Argumente miteinander ringen, sondern immer nur verschiedene Wahrheitsprogramme. Es gäbe gar keine Vernunft, sondern nur Interessen (S. 102-104). Auch hinter den Mythen oder den Menschenrechten stünden nur Interessen bzw. „Kräfte“; das alles habe keine Wahrheit sondern sei rein geschichtlich, das Denken des Menschen gehorche dem Willen zur Macht, womit Veyne wieder bei Nietzsche ist (S. 110). Wahrheit sei zu nichts zu gebrauchen, sie entspräche nur unseren Vorlieben, sie sei nur ein Deckmantel für den Willen zur Macht (S. 153).
An manchen Stellen nennt Paul Veyne statt Interessen und Vorlieben plötzlich den Zufall als die Ursache unserer Wahrheitspaläste, ohne diesen Widerspruch aufzulösen. Der Prozess der Geschichte sei eine Abfolge von Zufällen und basiere nicht auf Vernunftgründen oder den Produktionsverhältnissen (S. 142 f.). Alle geschichtlichen Prozesse jenseits von Ökonomie und Ideologie, also Mythos, Kunst und Wissenschaft, könne man nur beschreiben, wenn man Rationalität und Wahrheit fallen lasse; und auch die Sozial- und Ökonomiegeschichte sei ohne Wahrheit und Vernunft (S. 143 f.). Alles sei irrational, es gäbe keinerlei Determinismus, die Geschichte ist eine zufällige Abfolge von Wahrheitspalästen, ohne Vernunft (S. 145 f.; 153 f.).
Diese Verhältnisse bezieht Paul Veyne immer auf „uns“, also auf alle Menschen. Alle Menschen würden diesen Gesetzen quasi willenlos unterliegen, ohne Ausnahme. Wir alle würden nur Interessen verfolgen, auch wenn wir uns selbst über unsere Motive täuschen würden (S. 72). Unser Geist tue es ohne Unterlass, das sei unser Alltagsleben (S. 105 f.). Unsere Wahrheitsprogramme veränderten sich ohne unser Wissen, der Mensch sei kein denkendes Schilfrohr im Wind (S. 141). Damit ist gemeint: Das Schilfrohr kann sich nur passiv im Wind neigen, und der Mensch wisse noch nicht einmal, dass er nur wie ein Schilfrohr sei. Veyne meint auch, dass es gar nicht unaufrichtig sei, verschiedene Wahrheitsprogramme im Kopf zu haben, die sich widersprechen, denn auch das würden wir alle so tun; unser Geist täte dies ohne Unterlass (S. 105 f.).
Warum das falsch ist, und wie es eigentlich ist
Diese Grundideologie von Paul Veyne ist natürlich extrem zynisch und sinnleer. Man muss sich das nur einmal vorstellen! Aber natürlich ist diese Grundideologie vor allem auch einfach nur falsch. Es beginnt damit, dass Paul Veyne die Empirie für vernachlässigbar hält. Das ist natürlich Unsinn. Die Erfahrung lehrt uns alle, dass diese Welt kein Wunschkonzert ist. Wenn wir uns nicht gemäß der Realität verhalten, dann werden wir hart mit der Realität zusammenstoßen. Die Empirie erkennt diese Realität, und die Vernunft ordnet die einzelnen Erkenntnisse, so dass wir uns orientieren können, um es einmal ganz einfach auszudrücken. Und nicht nur die Umwelt, sondern auch das Wesen des Menschen selbst ist teilweise vorgegeben. Realität ist nicht beliebig konstruierbar. Das „Ding an sich“ von Immanuel Kant ist zwar letztlich nicht erkennbar, aber es ist vernünftig anzunehmen, dass es doch existiert. „Leicht beieinander wohnen die Gedanken, doch hart im Raume stoßen sich die Sachen“, dichtete schon Friedrich Schiller im Wallenstein.
Natürlich ist es vernünftig anzunehmen, dass es eine Realität gibt, und damit auch eine echte Wahrheit. Und zwar genau eine in sich konsistente Wahrheit, und nicht zwei Wahrheiten, die sich widersprechen. Natürlich kennen wir alle die eine, echte Wahrheit nicht, und wir alle sind immerzu auf dem Weg, uns der Wahrheit anzunähern, und natürlich begehen wir dabei auch Irrtümer, die uns wieder von der Wahrheit entfernen, aber deshalb ist es noch lange nicht vernünftig, Vernunft und Wahrheit kurzerhand ganz fallenzulassen. Das hieße das Kind mit dem Bade ausschütten. Ja, die Tatsachen existieren nicht „einfach“, sondern bedürfen der Interpretation, das ist schon richtig. Aber das ist kein Grund, die Existenz der Tatsachen selbst anzuzweifeln. Zudem: Würde es weder Vernunft noch die Annahme einer gemeinsamen, anstrebbaren Wahrheit geben, dann würde der Diskurs unter den Menschen unmöglich werden, der eine wesentliche Eigenschaft des Menschen und der menschlichen Gesellschaft ist. Veyne stellt hier die Menschlichkeit des Menschen infrage.
Natürlich wird menschliches Denken und Handeln vielfach durch Interessen und durch Zufall bestimmt, und natürlich ist das dem denkenden Menschen oft nicht bewusst – aber zu behaupten, dies sei immer und grundsätzlich so, ist entschieden zuviel behauptet. Es ist doch gerade die Bildung, die den Menschen über sein bloßes materielles Dasein hinaus erheben möchte. Es ist doch ein Kennzeichen von Bildung, sekundäre Motivationen wie Interessen und Vorlieben zu erkennen, und die Vernunft besser und richtiger zu benutzen. Bildung ist es, an sich selbst zu arbeiten und innere Widersprüche im eigenen Denken aufzudecken und auszuräumen. Doch Paul Veyne tut so, als seien alle Menschen nur ungebildete, bornierte Kleinbürger. Aber selbst diese sind noch reflektierter als Veyne es zugeben möchte, deshalb noch niedriger: Als seien alle Menschen – alle! – Menschen nicht viel besser als Tiere, die nur ihren Reflexen gehorchen. Wer nach Vernunft und Moral strebe, der täusche sich nur über seine wahren Motive, meint Veyne. Für Veyne ist der gute, nach Vernunft, Moral und Wahrheit strebende Mensch praktisch nur ein unaufgeklärter Idiot, über den er müde lächelt. Veyne untergräbt hier die Grundlagen von Bildung und Kultur, und rührt mit diesem Weltbild auch an die Grundfesten des Humanismus. Es ist einfach nur verantwortungslos und falsch.
Das zynische Geschichtsbild von Paul Veyne
Auf der Grundlage der dargestellten Ideologie ist dann auch das Geschichtsbild von Paul Veyne einfach nur zynisch und sinnlos zu nennen. Es gäbe keine Kausalität im Ablauf der Geschichte, sie sei unvorhersagbar, meint Veyne. Alle Versuche, den Lauf der Geschichte im Nachhinein zu erklären, seien unglaubwürdig, weil selektiv. Es sei geradezu verwunderlich, dass es so etwas wie geschichtliche Kontinuitäten gäbe. Man müsse jedes geschichtliche Ereignis als Einzelereignis für sich allein betrachten, und dann könne man auch keine Erklärung mehr dafür geben.(S. 49-54)
Geschichtsschreibung sei ein Mittel der Glaubensbildung, wie – so Veyne – der Journalismus auch (S. 15). Reporter würden nicht glaubwürdiger, wenn sie die Quellen ihrer Recherchen nennen würden, meint Veyne (S. 21). Was sei die geschriebene Geschichte? Es sei einfach die Politik von früher (S. 82). Wo die Moderne in der Geschichte ein Ringen um Aufklärung sieht, sieht Paul Veyne nur ein rationales Mäntelchen zur Fortsetzung des Wunderbaren (S. 62).
Das Ideal der Geschichtsschreibung des Historikers Paul Veyne besteht darin, den zufälligen Verlauf der Geschichte nachzuzeichnen. Es ginge darum zu beschreiben, was die Menschen sich jeweils als Wahrheitspalast errichtet hätten, und wie sie die materielle Realität selektiv wahrgenommen hätten (S. 150). Die Menschen könnten aus der Geschichte aber nichts lernen; eine reflexive Analyse führe nicht zu einer Annäherung an die Wahrheit, sondern nur zu einem anderen Wahrheitsprogramm (S. 150). Die Reflexion des Historikers ist somit nicht als ein Licht auf dem Weg zu verstehen, ein Blick zurück in die Geschichte würde in keiner Weise dabei helfen, den richtigen Weg zu finden (S. 153 f.). Die Wahrheit sei, dass die Wahrheit veränderlich sei, und das könne man ohne Selbstwiderspruch sagen, meint Paul Veyne (S. 141, 152). Die Aufgabe des Historikers sei es, Wahres über Wahrheitspaläste zu sagen (S. 152).
Man fragt sich natürlich, was eine solche Geschichtsschreibung noch für einen Sinn macht. Lernen soll man also nichts können aus der Geschichte. Soll der Geschichtsschreiber dann also mit einer Tinte schreiben, die sich sofort wieder selbst auslöscht, und nur leere Seiten bleiben, wie beim „Alten vom wandernden Berge“ in der „Unendlichen Geschichte“ von Michael Ende? Oder soll man sich den Geschichtsschreiber wie Sisyphos vorstellen, als einen glücklichen Menschen mit sinnloser Aufgabe? Und der Gipfel ist ja, dass Paul Veyne für sich als „Geschichtsschreiber neuen Typs“ in Anspruch nimmt, er könne echte Wahrheiten über die Pseudo-Wahrheiten aller anderen aussagen, und dass das kein Widerspruch sei. Sein hilfloser Versuch, dies mit dem Dilemma „Alle Kreter lügen, sagte ein Kreter“ zu begründen, verfängt nicht beim gebildeten Leser, der den Unsinn von Paul Veyne an dieser Stelle schon längst nicht mehr mit gnädigen Augen liest. Er, Paul Veyne, stehe also irgendwie über den Dingen, und wenn er in diesem Buch ständig von „wir“ und „uns“ spricht, die wir alle ungebildet und dumm unseren tierischen Reflexen folgen, dann hat er sich selbst immer ausgenommen? Aha. Ist das jetzt das „Interesse“ und der „Wille zur Macht“ von Paul Veyne?
Falsche und zynische Darstellung der antiken Geschichtsschreibung
Nach einer langen, langen Einleitung kommen wir in dieser Rezension jetzt zum ersten Mal auf die Antike zu sprechen, um die es ja eigentlich gehen sollte, aber offensichtlich nicht geht. Noch vor den Mythen widmet sich Paul Veyne der antiken Geschichtsschreibung. Dreiviertel der Texte antiker Geschichtsschreiber gingen allein auf deren Einbildungskraft zurück, meint Veyne allen Ernstes (S. 124). Bei der antiken Geschichtsschreibung habe es sich um ein Mittel der Glaubensbildung gehandelt (S. 15). Das Wort „historia“ wird von Veyne als „Ermittlung“ im Sinne einer schlechten journalistischen Recherche gedeutet (S. 20).
Das kritische Denken, das wir bei Autoren wie Herodot sehr wohl finden, wird von Paul Veyne niedergemacht und schlechtgeredet, ohne Herodot beim Namen zu nennen (S. 18 f.). Die Aussage von Herodot, dass er sich verpflichtet fühle, die Dinge so wiederzugeben, wie er sie hörte, auch wenn er selbst nicht daran glaube, wird von Veyne nicht als ein Fortschritt von Vernunft und Kritik gefeiert, sondern als angebliches Eingeständnis, dass alles, was Herodot bis zu diesem Punkt berichtet habe, eine unkritische Wiedergabe der Quellen gewesen sei (S. 23). Paul Veyne hegt eine ganz grundsätzliche Skepsis gegen die guten Absichten von antiken Geschichtsschreibern (S. 101 f.).
Die Bitte Ciceros, dass man seine Taten propagandistisch aufwerten möge, ohne dabei allzusehr auf die Regeln der historischen Gattung zu achten, wertet Veyne als Hinweis auf die Verlogenheit der Zeit, übersieht aber völlig, dass in dieser Bitte die Aussage enthalten ist, dass die historische Gattung Regeln kennt (S. 24). Und die Kritik, die Cicero und Livius an den Überlieferungen der Frühzeit üben, sei in keiner Weise eine historische Kritik, meint Veyne (S. 67). Der Geschichtsschreiber, der die Genealogie der Könige von Arkadien niederschrieb, habe wie ein Romanautor gehandelt, glaubt Veyne zu wissen (S. 125).
Wir können uns dieser zynischen, schiefen und falschen Sichtweise auf die antike Geschichtsschreibung natürlich nicht anschließen. Es tut weh, diesen üblen und unfairen Rabulismus auf Autoren wie Herodot angewandt zu sehen.
Schief und falsch verwendete Begriffe senden unterschwellige Botschaften
Während der Lektüre fällt immer wieder auf, dass Paul Veyne bestimmte Worte nicht gemäß ihrer eigentlichen Bedeutung verwendet. Seine teils schiefe, teils falsche Verwendung von Begriffen ist nicht etwa bloße Ungeschicklichkeit, und auch kein abkürzendes, „faules“ Sprechen, wie es dem Leser beim Beginn seiner Lektüre noch erscheinen will, sondern offenbar ganz bewusst so gewählt, um den Leser dadurch zu manipulieren. Zum einen verschwimmen die verschiedenen Begriffe in ihrer Bedeutung, so dass die Klarheit der Bedeutung der Begriffe unterminiert wird. Auf diese Weise wird dem Leser Glauben gemacht, die Begriffe hätten keine hinreichend klare Bedeutung, so dass die Glaubwürdigkeit von Veynes vernunftwidrigen Thesen bei weniger gebildeten Lesern erhöht wird. Zum anderen werden durch die falsche Verwendung der Begriffe unterschwellige Botschaften transportiert. Wahres und Gutes erscheint als verlogen und schlecht, Schlechtes und Verlogenes als gut und wahr, ganz wie es die Ideologie von Paul Veyne fordert. Und nein: Diese Phänomene verdanken sich nicht einer schlechten Übersetzung; sie sind auch im französischen Originaltext vorhanden.
So spricht Veyne z.B. gerne kurzerhand in absoluter Weise von „Wahrheit“, wo er besser von „damals geglaubter Wahrheit“ gesprochen hätte (S. 9 f., 105). Ob mit dem Wahrheitsbegriff die Realität oder eine Bedeutung im übertragenen Sinn gemeint ist, wird von Veyne ebenfalls nicht unterschieden (S. 32 f.). Mit Nietzsche sagt er kurzerhand: „Die Tatsachen existieren nicht“ (S. 52 f.). Aber um genau zu sein, hätte er besser davon gesprochen, dass sie nicht „einfach“ existieren, sondern – obwohl sie nämlich sehr wohl existieren – nicht ohne Interpretation zu haben sind. Vom Mythos meint Paul Veyne, dass er weder wahr noch falsch sei (S. 41). Aber das kann man so nicht sagen. Denn natürlich gibt es Mythen, die einfach nicht wahr sind, und dann gibt es wiederum Mythen, die einen beachtlichen wahren Kern haben. Aber Veyne interessiert das offenbar nicht. Dann meint Veyne, dass eine Lüge im Mythos solange nicht als Lüge gelte, solange der Erfinder der Lüge daraus keinen Vorteil ziehe (S. 41). Das ist eine sehr ungewöhnliche Definition von Lüge, die dem allgemeinen Verständnis von Lüge zuwiderläuft. Für gewöhnlich knüpft man das Wesen der Lüge an das Bewusstsein des Autors, ob er denn weiß, dass er lügt.
Völlig gegen das allgemeine Verständnis wird auch das Phänomen des Fälschers aufgefasst. Paul Veyne nennt auch das eine Fälschung, was ihr Autor völlig ernst meinte, und erst später als falsch erkannt wird (S. 126). Der Vorgang des Fälschens wird konsequent relativiert: Eigentlich sei doch jeder der Fälscher eines anderen Wahrheitsprogrammes, meint Veyne (S. 128). Der Fälscher sei gewissermaßen ein Fisch im falschen Gefäß (S. 130), und überhaupt seien die Grenzen zwischen Information und Unterhaltung reine Konvention (S. 125). Man könne einfach nicht zwischen dem Imaginären und dem Wirklichen unterscheiden, das ginge gar nicht, meint Veyne (S. 124). Paul Veyne vermeidet konsequent, den zentralen Gedanken des Fälschens auszusprechen: Dass sich ein Fälscher nämlich bewusst sein muss, dass er eine Unwahrheit produziert. Dass es so etwas überhaupt geben könnte, dass jemand bewusst fälscht und deshalb mit Recht ein Fälscher genannt wird, und dass jemand, der nicht bewusst fälscht, auch nicht Fälscher genannt zu werden verdient, egal wie falsch seine Worte auch immer sein mögen, diese Idee wird bei Paul Veyne konsequent ausgeblendet, sie existiert gar nicht. Für Paul Veyne sind Fälscher und Lügner Menschen, die die Wahrheit sprechen, nur in einem anderen Bezugssystem. Was für ein Unsinn.
Für einen Historiker wie Paul Veyne besonders bezeichnend ist die ständig wiederholte Verwendung des Wortes „Geschichte“, wo man besser von „Geschichtsschreibung“ gesprochen hätte (z.B. S. 15, 125 f.). Dahinter steckt natürlich seine Idee, dass es keine echte Wirklichkeit gibt, sondern nur Wahrheitspaläste, die mit einer empirischen Realität nicht das Geringste zu tun haben. Das allgemeine Verständnis des Wortes „Geschichte“ als dem, was wirklich passiert ist, wird deshalb von Veyne mit der Bedeutung des Wortes „Geschichtsschreibung“ überschrieben, also dem, was die Leute glauben, dass angeblich passiert sei. – Auch die Vernunft erleidet bei Paul Veyne dieses Schicksal: Überall dort, wo er eigentlich von einer „Rationalisierung“ sprechen müsste, nämlich einer rationalisierenden Deutung von Mythen, spricht Veyne konsequent von „Rationalismus“ (z.B. S. 84, 134). Nun ist aber nicht jede rationalisierende Deutung von Mythen auch rational(istisch). Im Gegenteil, oft ist eine rationalisierende Deutung von Mythen falsch und irrational. Aber für Paul Veyne gibt es ja keinen echten Rationalismus, und so spricht er kurzerhand von „Rationalismus“, wo er Rationalisierung meint. Dadurch wird die Rationalität, die Vernunft selbst, der Lächerlichkeit preisgegeben, und von ihrer eigentlichen Bedeutung entfremdet.
Ähnliches geschieht auch, wo Paul Veyne von den „verantwortungsbewussten“ Leuten spricht, die im Glauben an die vermeintlich gute Sache mit der Wahrheit nicht pingelig sind (S. 98). Natürlich sind Menschen, die es mit der Wahrheit nicht genau nehmen, alles andere als „verantwortungsbewusst“. Solche Leute halten sich vielleicht selbst für verantwortungsbewusst und sie stellen sich vielleicht selbst als verantwortungsbewusst heraus (man vergleiche den Unbegriff des „Gutmenschen“), aber sie sind natürlich nicht wirklich verantwortungsbewusst. Paul Veyne hätte das Wort „verantwortungsbewusst“ an dieser Stelle in Anführungszeichen setzen müssen, um Ironie deutlich zu machen. Aber er hat es nicht getan. Denn für ihn ist es keine Ironie. Für ihn ist es ernst. – Und schließlich wird so auch der Begriff des „Patriotismus“ unterminiert. Paul Veyne verwendet das Wort „Patriotismus“ konsequent im Sinne von „Nationalismus“ (S. 100, 151). Auf diese Weise wird kein Unterschied mehr gemacht zwischen einem Menschen, der sein Land liebt, und einem hässlichen Nationalisten. Für Paul Veyne ist das offenbar dasselbe. Wie primitiv.
Die Gefährlichkeit der Ideologie von Paul Veyne
Der gebildete Leser hat natürlich längst erkannt, wie gefährlich die Ideologie von Paul Veyne ist. In ihr ist das Potential zu jedem beliebigen Unsinn und damit zu jedem beliebigen Verbrechen angelegt. Wir sind jedoch nicht darauf angewiesen, solche Auswüchse lediglich theoretisch zu schlussfolgern, nein, Paul Veyne präsentiert uns noch in demselben Büchlein mehrere bedauerliche Anwendungsfälle seiner Ideologie, wo es richtig gefährlich wird.
Zunächst steht die Ideologie von Paul Veyne jeder Form von Wissenschaft diametral entgegen. Wenn es keine Annäherung an die Wahrheit geben kann, keinen Rückbezug zur Empirie, und alles nur frei schwebende Illusion ist, dann kann es auch keine Wissenschaft geben. So meint Paul Veyne denn auch konsequenterweise, dass religiöser Glaube, ein Roman, oder die physikalischen Theorien Albert Einsteins auf einer Stufe stünden (S. 140). Die Erfindung des Mikroskops durch Leeuwenhoek und die dadurch möglich gewordene Entdeckung der Mikroben seien nach Meinung von Paul Veyne außer zur Konversation zu nichts gut gewesen (Fußnote 215). So spannt er auch das naturwissenschaftliche Prinzip der Auffindung immer besserer Erkenntnisse in das Prokrustes-Bett seiner Ideologie und spricht auch hier von der „wissenschaftlichen Wahrheit, die dauernd provisorisch ist“, obwohl das Wort „Wahrheit“ hier natürlich nicht hingehört, das ist der springende Punkt, und er spricht vom „Mythos der Wissenschaft“ (S. 138). An einer Stelle verteidigt Veyne auch eine rhetorisch interessegeleitete Lüge von Galen (S. 72), und wie gesehen gibt es für Paul Veyne eigentlich keine Fälscher. Letztlich stellt Paul Veyne damit auch seine eigene Profession infrage, denn wie will er unter diesen Voraussetzungen Geschichtsschreibung als Wissenschaft betreiben?
Zum Nationalsozialismus finden wir bei Paul Veyne besonders unappetitliche Aussagen. Auch der Nationalsozialismus war nach Meinung von Paul Veyne eine „Erfindung“ aus heiterem Himmel, und lasse sich nicht auf auf wesentliche Gründe und Ursachen zurückführen, sondern sei in keiner Weise vorhersagbar gewesen (S. 52), woran kleine Kausalitäten nichts ändern, die Paul Veyne immerhin doch sieht. Ganz so aus heiterem Himmel wurde der Nationalsozialismus dann aber wohl doch nicht „erfunden“, wie Veyne meint, auch wenn eine starke Kausalität ebenfalls eine Übertreibung wäre. Da Veyne die Empirie für vernachlässigbar hält, kommt er konsequent zu der Ansicht, dass allein das Interesse, nicht an Auschwitz glauben zu wollen, genüge, um alle Zeugnisse über Auschwitz unglaubwürdig werden zu lassen (Fußnote 8). Folgerichtig wird dann der Holocaustleugner Faurisson nicht als Fälscher gedeutet – wir sahen oben schon, dass es für Veyne gar keine Fälscher im eigentlichen Sinne gibt – sondern als Mythenmacher (!), dessen Fehler allein darin bestand, zu argumentieren, und eben nicht, wie es ein guter Mythenmacher im Sinne von Paul Veyne hätte tun sollen, einfach apodiktische Behauptungen zu verbreiten (S. 127 f.). Paul Veyne findet es zudem angebracht, einen dummen Witz über den Holocaustleugner Faurisson zu reißen: Auch der Fälscher selbst sei eine Fälschung gewesen, denn es gäbe gar keine Holocaustleugner, wenn man nur aufhören würde, an die Existenz solcher mythischen Wesen zu glauben (S. 126 f.). Aber da müssen wir mit Bertrand Russell kontern: Realität ist das, was nicht verschwindet, wenn man aufhört daran zu glauben. Schließlich witzelt Veyne auch noch dumm über das Thema Verantwortung herum: Verantwortungslosigkeit sei ja sooo schlimm, und deshalb „sicherlich“ auch falsch; Diodor könne das bestätigen, meint er nur sarkastisch-ironisch (S. 142). Mit anderen Worten: Das ganze Geschwätz von der Verantwortung ist genauso Unfug wie das Geschwätz über geschichtliche Wahrheit, denn beides gibt es für Veyne nicht. Gott sei Dank geht es darum ja gar nicht, meint Paul Veyne. Das ist nur logisch: Wo es keine Wahrheit gibt, kann es keine Verantwortung und auch keine Schuld geben. Wir müssen uns Paul Veyne als glücklichen Kollaborateur des Vichy-Regimes vorstellen – oder was sollte man von jemandem erwarten, der Wahrheit und Vernunft beiseite wischt und statt dessen vom „Willen zur Macht“ spricht?
Wir sahen oben schon, dass die Ideologie von Paul Veyne – horribile est dictu – ein Angriff auf den Humanismus ist. Wenn es keine Wahrheit gibt und die Empirie vernachlässigbar ist, dann kann der Mensch auch nichts lernen, und es sind auch keine vernünftigen Diskurse unter den Menschen möglich. Auch Wissenschaft ist ohne Humanismus nicht möglich. Der Gedanke, dass es gerade die Bildung ist, die den Menschen über seine Abhängigkeiten, über seine Interessen und Vorlieben erhebt und zu einem selbstbestimmten, vernunftgeleiteten Menschen macht, fehlt bei Paul Veyne völlig. Für Veyne muss man gleich ein „Genie“ sein, um aus einem Wahrheitsprogramm, in dem man sich befindet, wieder herauszukommen (S. 141). Bloße Bildung reicht offenbar nicht bzw. existiert in Veynes Welt nicht. Es gibt natürlich auch keine Moral. Allein die moralische Grundfrage, was denn zu tun ist, sei schon verfehlt; nur der Anthropozentrismus glaube an eine Antwort auf diese Frage, so Veyne (S. 151). Die meisten Jahrhunderte hätten sich diese Frage zudem gar nicht gestellt, meint Veyne (S. 151). Wirklich? Da haben wir die Geschichte aber ganz anders verstanden. Veyne meint auch, dass es keine der Natur der Dinge einbeschriebene Struktur gäbe, die eine Moral begründen könnte: Auch Kritiken wie Entmystifizierung, Sprachkritik und Ideologiekritik seien nur Romane (S. 151). Vorstellungen von Sinn und Moral seien immer Fälschungen und als solche leicht erkennbar: Sie verströmen menschliche Wärme, und das sei per se schon falsch (S. 151). Wahrheit sei einfach zu nichts zu gebrauchen (S. 153). Im vorletzten Absatz des Buches schreibt Veyne: „der Mensch ist eben kein denkendes Schilfrohr. Habe ich deshalb dieses Buch auf dem Lande geschrieben? Ich beneidete die Tiere um ihre Gelassenheit.“ (S. 154) Das ist eine unmissverständliche Absage an den Humanismus, in Form der Bevorzugung des Nichtdenkens der Tiere.
Der ideologische Hintergrund
Paul Veyne kommt oft auf Nietzsche zu sprechen, erwähnt hin und wieder Max Weber, lobt den Rationalismus-Gegner Paul Feyerabend (Fußnote 166), und nennt einmal die Kontroverse zwischen Rationalismus und Irrationalismus, konkretisiert in der Auseinandersetzung von Habermas und Foucault (S. 143). Hier sind wir genau beim Punkt. Das postmoderne Denken von Michel Foucault ist die Quelle von Paul Veynes Ideologie. Es war Foucault, der statt Vernunft und Wahrheit Interessen und Machtverhältnisse ins Zentrum rückte. Es war Foucault, der Begriffe und Werte beliebig umdefinierte: Wahrheit gab es nicht mehr, Kranke galten nicht mehr als krank, Wahnsinnige nicht mehr als wahnsinnig, Kriminelle nicht mehr als kriminell. Und Foucault stützte sich auf den Nihilismus Nietzsches und dessen radikale Vernunftkritik.
Michel Foucault fand viele Anhänger, stieß aber auch auf heftige Kritik: Schon Sartre warf ihm vor, den Humanismus zu verwerfen und die Grundlagen des aufklärerischen Denkens infrage zu stellen. Foucault wurde vorgeworfen, unklare und konfuse Begriffe zu verwenden und selbstwidersprüchlich zu sein. Außerdem habe er historische Fakten unzuverlässig verwendet. Für den Historiker Hans-Ulrich Wehler war Michel Foucault „ein intellektuell unredlicher, empirisch absolut unzuverlässiger, kryptonormativistischer ‚Rattenfänger‘ für die Postmoderne“.
Auch das Denken von Michel Foucault hatte gefährliche Konsequenzen: So unterstützte bzw. verharmloste Michel Foucault sowohl die Errichtung eines totalitären Gottesstaates im Iran als auch die massenmörderische Terrorherrschaft der Roten Khmer in Kambodscha.
Warum Paul Veyne seine eigene Ideologie nicht glaubt
Es gibt einige Stellen und Aspekte, wo deutlich wird, dass Paul Veyne offenbar nicht wirklich von seiner eigenen Ideologie überzeugt ist. Da ist zunächst der Umstand zu nennen, dass Paul Veyne dieses Büchlein geschrieben hat. Wozu, wenn es keine Wahrheit gibt, an die man sich annähern kann? Wozu, wenn argumentieren nicht hilft? Wozu, wenn man aus der Geschichte nichts lernen kann? Und wozu, wenn Veyne in seinem ganzen Wissenschaftsverständnis nicht ernst genommen werden kann? Im Grunde hat er ja gar kein Wissenschaftsverständnis, sondern das Gegenteil davon: Ein Verständnis, dass Wissenschaft unmöglich und sinnlos ist. – Und dennoch hat Paul Veyne dieses Büchlein geschrieben, das er als wissenschaftlicher Historiker geschrieben hat, und in dem er keine apodiktischen Mythen verbreitet sondern teilweise argumentiert. Wie sollen wir ihm da glauben, dass er an seine eigene Ideologie glaubt?!
Wir sahen schon eine Reihe von Beispielen, wo Paul Veyne selbstwidersprüchlich argumentiert. Aber vielleicht glaubt er ja wirklich an die Möglichkeit seiner Selbstwidersprüche. Interessant ist jedoch, dass er bei der Frage nach der Entstehung des Nationalsozialismus entgegen seiner vollmundigen Thesen, dass Geschichte sich rein zufällig ereigne, und dass der Nationalsozialismus gewissermaßen eine zufällige Erfindung der Geschichte sei, dennoch „kleine kausale Serien“ sehen will (S. 52). Wie das? Woher kommt jetzt diese kleine Kausalität?! So klein sie auch sein mag, ist es doch eine Kausalität. Hier ist Veyne nicht konsequent. – Nachdem Veyne zunächst erklärt hatte, dass die verschiedenen Wahrheitsprogramme sich gar nicht widersprechen könnten, weil es eben nicht um Wahrheit ginge, und ein Mensch auch völlig widerspruchsfrei mehrere sich gegenseitig (dann also wohl nur scheinbar?) widersprechende Wahrheitsprogramme zugleich im selben Kopf haben könne, erklärt Veyne, dass ein vernünftiges Ringen von Argumenten in Wahrheit ein Kampf verschiedener Wahrheitsprogramme miteinander sei (S. 92). Doch wie das, wenn sie sich gar nicht widersprechen? Können sich verschiedene Wahrheitsprogramme nun widersprechen oder nicht? Paul Veyne klärt dieses Rätsel an keiner Stelle auf.
Immer wieder stellt Paul Veyne in diesem Büchlein klare Behauptungen mit Wahrheitsanspruch auf, obwohl es doch seiner Auffassung nach gar keine Wahrheit geben kann. Besonders deutlich in seiner apodiktischen Aussage „Die Wahrheit ist einfacher: ….“ (S. 104, „La verité est plus simple“), die ausgerechnet inmitten einer Orgie von Aussagen getätigt wird, dass es keine Wahrheit gäbe. Auf den Doppelpunkt folgt zudem ein Argument – wie aber kann Veyne argumentieren, wo das doch seiner Auffassung nach nichts bringt? Vom „Patriotismus“ behauptet Veyne, dass er Millionen Tote gefordert habe (er meint natürlich den Nationalismus, aber lassen wird das jetzt), und gibt sich sehr überzeugt davon (S. 151). Der Wahrheitsanspruch ist auch hier nicht übersehbar. Auch der Satz „Die zweite Interpretation ist die einzig richtige“ formuliert eine überraschend klare Wahrheitsbehauptung (S. 131). Und wenn es um Heidegger geht, den er offenbar nicht mag, ist plötzlich wieder Kritik gefragt, obwohl die doch laut Veyne gar nicht möglich ist: „Man hat den Verdacht, dass ein wenig historische und soziologische Kritik besser wäre als noch so viel Ontologie.“ (S. 130).
Wir erinnern uns auch, dass Paul Veyne sich sehr viel Mühe damit gegeben hatte, den Menschen als von Motiven geleitet darzustellen, über die er sich selbst gar nicht bewusst ist: Nicht Vernunft, Wahrheit und Moral würden den Menschen leiten, sondern Interesse, Vorlieben und Zufälle. Doch in Fußnote 33 erfahren wir plötzlich, dass Kinder, Primitive und Gläubige nicht naiv seien: Sie würden Imaginäres und Wirkliches gar nicht verwechseln, obwohl Veyne uns doch glauben machen wollte, dass man das gar nicht unterscheiden könne. Wir erfahren auch von einem Stamm, der Menschen, die sich aus religiös-rituellen Gründen für Wildschweine halten, klar von echten Wildschweinen zu unterschieden weiß. Sieh an, wer hätte das gedacht! Ist die Empirie also doch nicht vernachlässigbar?!
Und im Schlusssatz dieses Büchleins meint Paul Veyne dann: „Schon beim Lesen des Titels wird jeder, der auch nur die geringste historische Bildung besitzt, vorweg geantwortet haben: ‚Aber natürlich haben sie an ihre Mythen geglaubt!‘ “ Hier nun endlich, im letzten Satz, taucht sie doch noch versteckt auf, die Bildung! Die Bildung, die es angeblich gar nicht geben soll. Die Bildung, die es uns ermöglicht, aus unserem modernen Bezugssystem auszubrechen, in dem die antiken Mythen keine Wahrheit mehr haben, und uns in das Bezugssystem antiker Menschen zu versetzen, die natürlich in verschiedentlichster Weise an ihre Mythen glaubten. Es ist diese Bildung, die diese Transferleistung im Denken ermöglicht, mithilfe der Vernunft und der Wahrheit als Ziel, und man muss dazu noch nicht einmal ein Genie sein, wie Paul Veyne behauptete.
Wir glauben nicht, dass Paul Veyne wirklich ungebrochen an seine eigene Ideologie glaubt. Es ist ein Mythos, dass Veyne im „ungebrochenen Mythos“ seiner Ideologie lebt. Wir glauben dies nicht, erstens, weil dies gar nicht geht. Theoretisch nicht. Und praktisch erst recht nicht. Wir glauben es aber auch zweitens nicht, weil Paul Veyne – wie gezeigt – mehrfach deutlich erkennen ließ, dass er nicht daran glaubt. Die Frage ist, inwieweit sich Paul Veyne darüber im Klaren ist? Wir fühlen uns unwillkürlich an Erich von Däniken erinnert, dessen saftige Selbstironie ja auch nicht zu übersehen ist: Auch er glaubt und glaubt doch nicht wirklich an seine eigenen Mythen. Beide, Paul Veyne und Erich von Däniken, sind in einer bedauernswerten Gemengelage von Irrtum und Durchschauen des Irrtums gefangen. Das Durchschauen des Irrtums hat aber den Durchbruch zur Dominanz im Denken beider nicht geschafft.
Endlich: Das Thema Mythen!
Jetzt endlich kommen wir in dieser Rezension zu dem eigentlichen Thema von Veynes Büchlein, das im Titel angekündigt wurde, und wegen dessen die meisten Leser dieses Büchlein zu lesen begonnen haben werden – zu Ende gelesen werden es aber nur die wenigsten haben, denn es geht, wie gesehen, zuerst um ganz andere Themen, und dann erst um Mythen.
Leider ist Paul Veyne nicht in der Lage, die bei den Griechen entstehende Mythenkritik angemessen zu würdigen. Denn für Paul Veyne gibt es ja keine Annäherung an eine Wahrheit, und man könne auch nichts lernen, und es würde immer nur ein Wahrheitspalast durch einen anderen ersetzt, ohne Beteiligung der Vernunft. Deshalb wohl macht sich Paul Veyne lustig darüber, dass die Griechen die Frage nach der Wahrheit stellten, und redet von „Denkpolizist“ (S. 76). Die geistige Leistung der Griechen und der kulturelle Fortschritt sind für Veyne nur ein Witz. Er meint in unverständlichen Worten, dass die Kritik am Mythos durch die Transformation der Zeitlichkeit entstand, aber wie das zuging, wolle er eigentlich gar nicht wissen (S. 47). Der Leser ist schockiert: Das ist doch genau sein Thema, und er will es nicht wissen?! An anderer Stelle wendet er sich ebenfalls gegen Versuche, die Mythenkritik zu erklären, weil sie ein Ergebnis vieler Zufälle sei (S. 48 f.). In Fußnote 210 erfahren wir dann, dass sich Paul Veyne Hampl anschließe, demzufolge – angeblich – Mythos, Sage und Märchen nicht unterscheidbar seien. Das ist eine weitreichende Aussage, warum nur in einer späten Fußnote? Und nirgendwo finden wir eine saubere Unterscheidung verschiedener literarischer Gattungen: Sage, Legende, Mythos, Märchen, usw. – Wir sehen, dass sich die Ideologie von Paul Veyne äußerst negativ auf seine Behandlung des Themas auswirkt.
Tatsächlich werden alle Fragestellungen, die man zu Mythen haben kann, bei Veyne in der ein oder anderen Weise aufgeworfen und angesprochen. Doch die Perspektive ist häufig schräg, und es wird selten hinreichend differenziert. Oft wird rabulistisch über die verschiedenen Zeiten hinweggegangen, und viel zu weitreichende Pauschalurteile gefällt („die Griechen glaubten …“). Man könnte immerhin sagen, dass Paul Veyne eine Fundgrube für interessante Gedanken zum Thema Mythen ist. Das ja. Man kann dieses Büchlein zur Anregung lesen, um auf Gedanken zu kommen, auf die man sonst nicht gekommen wäre. Wir zählen nur kurz einige Themen auf, die angesprochen werden:
- Das mythische vs. das historische Zeitalter.
- Mythos und Logos seien nicht einfach ein Gegensatz.
- Glaube variiert in Graden und Formen.
- Glaube variiert nach sozialer Schicht, Bildung.
- Glaube variiert je nach Jahrhundert, von Homer bis Pausanias.
- Text ohne Autor; Tradition schafft Autorität.
- Mythen haben soziale Funktionen.
- Kriterium Entmythologisierung: Vergangenheit nicht wunderbarer als Gegenwart.
- Kriterium Entmythologisierung: Wahren Kern herausschälen.
- Dass Mythen völlig unwahr sind, also Lüge, hätten „die Griechen“ nicht erkannt.
- Pausanias mache dann den Schritt zur allegorischen Deutung.
- Der Entmythologisierer begründet selbst einen neuen Mythos.
- Mythensammler schufen Kanon, Varianten, verursachten einen Kahlschlag der Varianten.
- Mythen können Chiffren in diplomatischer Sprache sein.
- Problem der Entmythologisierung wurde nie gelöst, sondern wurde durch Christentum obsolet.
Paul Veyne kommt immer wieder darauf zurück, dass die Griechen nie erkannt hätten, dass die Mythen einfach Lügen seien (z.B. S. 136). Der Leser fragt sich: Kann man das denn so pauschal sagen? – Immer wieder kommt Veyne darauf zurück, dass die heute gültige, moderne Deutung von Mythen die Deutung als Archetypen sei, also eine psychologisierende Deutung im Sinne von C.G. Jung (z.B. S. 26 f., 39, 75, 94). Doch das ist nur eine mögliche moderne Deutung von vielen! Wie kommt Paul Veyne darauf, dass es nur diese eine gäbe?! – Wiederholt meint Veyne, dass die griechische Skepsis, Rationalität und Geschichtsschreibung nicht so sei wie die unsere (S. 13, 115). Doch in welcher Weise? Das ist doch im Kern sehr zu bezweifeln, dass ihre Rationalität eine völlig andere war als unsere. – Einmal sagt Veyne, dass die Griechen bis zur Entmythologisierung unkritisch gläubig und unkritisch skeptisch gegenüber ihren Mythen gewesen wären (S. 26). Ein andermal sagt er, dass man mit Mythen bis zu Nietzsche und Max Weber unkritisch umgegangen sei. Weder das eine noch das andere kann den Leser überzeugen. Hier wird viel zu wenig differenziert. – Veyne behauptet, dass Hesiod seine Werke frei erfunden und zugleich daran geglaubt habe (S. 42). Das kann er einem gebildeten Menschen nicht erzählen. – Cicero hätte nicht an die Götter geglaubt (S. 65). Das bezweifle ich doch sehr. Es kommt darauf an, was man unter „Glaube“ und unter „Göttern“ versteht. – Autoren, die die Wahrheit von Mythen hochhalten, seien wie Philologen, die die erhaltenen Textstellen eines antiken Textes hochhalten (S. 91). Der Vergleich hinkt schwer.
Platon und Mythen
Geradezu dramatisch ist der Umstand, dass Paul Veyne in einem Werk über antike Mythen allen Ernstes glaubt, Platon auslassen zu können: „Doch überschlagen wir dieses Kapitel, vor dem selbst die kühnsten Kommentatoren zurückschrecken würden“; denn Platon mache alles, er deute Mythen allegorisch, oder mit geschichtlich wahrem Kern, oder er mache sogar eigene Mythen (S. 81). Das ist natürlich gar zu schrecklich, sich mit so einem wetterwendischen Wicht wie Platon zu befassen, das lässt man dann lieber gleich bleiben als Wissenschaftler, nicht wahr? Dass Platon eine absolut zentrale Rolle im antiken Diskurs über Mythen spielt, fällt für Paul Veyne offenbar nicht ins Gewicht. Er spricht diesen Umstand noch nicht einmal aus. Auch wegen dieses kühnen Übergehens von Platon ist Paul Veyne einfach nicht ernst zu nehmen. Dabei ist Paul Veynes Furcht nur allzu verständlich, denn Platon steht für alles, was Veyne ablehnt: Für Vernunft und das Streben nach der Wahrheit.
Durch die Hintertür hat sich Paul Veyne natürlich trotzdem mit Platon befasst. Es finden sich ungefähr zehn Stellen in diesem Büchlein, an denen Veyne auf Platon eingeht. Nur gibt Paul Veyne nicht zu, dass Platon wichtig ist. Offenbar will Paul Veyne Platon „vernichten“, indem er ihn lächerlich macht, systematisch fehlinterpretiert und vor allem ausblendet. Das ist dann fast schon kindisch.
Veyne unterstellt, dass Platon geglaubt habe, dass alle Mythen von Dichtern erfunden worden seien (S. 77). Das ist natürlich Unsinn, aber ganz im Sinne von Veyne. – Platons Diktum, dass man die Unwahrheit der Wahrheit so gut wie möglich nachbilden müsse, deutet Veyne so, dass jede Unwahrheit eigentlich nur eine Ungenauigkeit sei (S. 87). Auch das ist falsch, denn es gibt für Platon auch die klare Unwahrheit, Lüge und Fälschung, die kein Annäherungsversuch an die Wahrheit ist. Aber Veyne, für den es keine echten Fälscher gibt, sieht das natürlich anders. – In Platons Aussage zur Kriegstauglichkeit von Frauen deutet Veyne die Aussage zu den Sauromaten so, als würde Platon die Sauromaten als Kern des Amazonen-Mythos deuten (S. 112 f.; Nomoi VII 806ab). Doch das ist falsch. Es wird nur verglichen, „wie die Sauromatinnen“, aber es findet keine Ausdeutung des Mythos im Sinne von Paul Veyne statt. – An einer Stelle meint Veyne, die Griechen hätten sich nie mit dem Problem der Überlieferung befasst (S. 85). An einer anderen Stelle schreibt Veyne, dass man die Prinzipien der Kritik der Überlieferung bei Platon finden könne (S. 68). – Meistens wird die Zeitlichkeit der Mythen mit der Zeit bis zum Trojanischen Krieg angegeben (S. 11, 55, 92 ff.). An einer Stelle wird die Zeitlichkeit der Mythen jedoch lapidar „platonisch“ genannt (S. 40). Die platonische Vorstellung von Zeit war aber eine ganz andere als die der traditionellen Mythologie, nämlich zyklisch, wie Paul Veyne wiederum an anderer Stelle richtig erkannt hat (S. 64). Auch hier also eine flapsige Ungenauigkeit. Für Paul Veyne ist das aber vermutlich egal, und Flapsigkeit völlig gerechtfertigt, da ja ohnehin alles nicht wahr ist, da ja ohnehin kein Wert auf Vernunft gelegt werden kann, usw. usf.
In Fußnote 5 nennt Paul Veyne das Werk „Greece before Homer: Ancient Chronology and Mythology“ von John Forsdyke 1957 als eine seiner Quellen. Wir haben die Vermutung, dass Paul Veyne sich bei der Abfassung seines Büchleins allzu sehr auf dieses Werk gestützt haben könnte. „Allzu sehr“ nicht im Sinne eines Plagiates, aber in dem Sinne, dass auch bei Forsdyke Platon mehr oder weniger ausgeblendet wird, und dass auch bei Forsdyke eine übertriebene Schwerpunktbildung auf Pausanias zu beobachten ist, ganz wie bei Veyne.
Platons Atlantis
In Fußnote 89 kommt Paul Veyne sehr versteckt auch auf Platons Atlantis zu sprechen. Dort heißt es: „Zu den mythischen Zeitaltern bei Platon (Politik [Politeia] 268-269b; Timaios 21a-d; Gesetze 677d-685e), der sie richtig stellt und nicht mehr oder weniger daran glaubt als Thukydides oder Pausanias, vgl. Raymond Weil, Archéologie de Platon, Paris 1959, S. 14, 30, 44.“
Mit den „mythischen Zeitaltern bei Platon“ ist zunächst nur von Platons zyklischem Geschichtsbild die Rede, auch wenn dies eng mit Platons Atlantis zusammenhängt. Doch mit der Stellenangabe Timaios 21a-d, in der nicht von Zeitaltern sondern von Ur-Athen und Atlantis zu erzählen begonnen wird, und dem Verweis auf Raymond Weil, in dessen Werk es zentral um Platons Atlantis geht, ist der Bezug zu Platons Atlantis dann unmissverständlich hergestellt. Und Platons Auffassung über – unter anderem – Atlantis ist Paul Veyne zufolge also, dass Platon „nicht mehr oder weniger daran glaubt als Thukydides oder Pausanias“.
Wir könnten daraus jetzt ohne weiteres ableiten, dass Paul Veyne glaubt, dass Platon seine Atlantisgeschichte völlig ernst gemeint hat. Ohne weiteres könnten wir sagen, dass Paul Veyne damit gegen die Mehrheit der Historiker und Philologen steht, denenzufolge Atlantis eine Erfindung von Platon ist. – Doch halt! Paul Veyne verwischt ja gerade den Unterschied von Erfindung und Wahrheit. Für Paul Veyne gibt es auch keinen Fälscher, sondern nur verschiedene Wahrheitspaläste – die sich aber allesamt wiederum nur unserer Einbildungskraft verdanken. Die Empirie ist für Veyne vernachlässigbar. Wenn man dies bedenkt, dann ist Paul Veyne natürlich wieder ganz anders einzuordnen. Veyne glaubt vielleicht tatsächlich, dass Platon an Atlantis glaubte, aber Veyne glaubt zur gleichen Zeit auch daran, dass Platon Atlantis erfand. Ganz so, wie Veyne es auch für Hesiod sagt (S. 42). Das ist zwar Unsinn, aber Veynes Meinung. Mit anderen Worten: Paul Veyne hat eine Meinung, die wie ein Pudding ist, den man nicht an die Wand nageln kann. Auch der Verweis auf Raymond Weil ist vielsagend. Denn anders als Paul Veyne, demzufolge Platon daran glaubt, auch wenn er es erfunden hat, ist Raymond Weil ein ganz entschiedener Verfechter der These, dass Platon die Atlantisgeschichte sehr bewusst erfunden hat.
Immerhin können wir trotz allem eines ganz klar festhalten: Paul Veyne glaubt gewiss und sicher daran, dass Platon an seine Atlantisgeschichte glaubte. Veyne glaubt zwar zugleich auch, dass Platon die Atlantisgeschichte erfand, doch ändert das nichts daran, dass Paul Veyne sich in ganz klarem Widerspruch zu den meisten Historikern, Philosophen und Philologen befindet, die meistens der Auffassung sind, dass Platon die Atlantisgeschichte sehr bewusst erfunden hat. Wenigstens diesen Widerspruch zur vorherrschenden Meinung können wir aus der Meinung von Paul Veyne herausdestillieren. Da gibt es nichts zu rütteln.
Merken wir noch an, dass Paul Veyne seine Meinung über Atlantis säuberlich in eine Fußnote versteckt hat, und auch innerhalb dieser Fußnote nur implizit durch einen Stellenverweis auf Platons Timaios und den Literaturverweis auf Raymond Weil deutlich werden lässt. Offenbar war es Paul Veyne unangenehm, seine eigene Ideologie auf das Thema Atlantis angewendet zu sehen. Er hätte ja auch ganz einfach explizit schreiben können: Platon glaubte an Atlantis und erfand es zugleich, so wie er es bei Hesiod ja auch macht. Aber vermutlich fürchtete er, es könne ihn jemand beim Wort nehmen: „Platon glaubte an Atlantis“, ohne den ganzen Wahnwitz seiner Ideologie zu erfassen: „und erfand es zugleich“. Es ist doch immer wieder interessant, was Wissenschaftler zum Thema Atlantis nur in Fußnoten zu schreiben wagen.
Formale Kritik
Da wir jetzt schon soviel Text in diese Rezension investiert haben, sollten wir auch vor einer Kritik formaler Aspekte nicht zurückschrecken. Wie viele Autoren hat Paul Veyne zahlreiche Informationen in Fußnoten gepackt, die man gerne im Haupttext gesehen hätte. Angenehm ist aber, dass die Fußnoten nicht für jedes Kapitel, sondern für das ganze Buch durchgängig nummeriert sind. Das erleichtert den Umgang mit ihnen erheblich. Andererseits sind die Fußnoten leider nicht als Fußnoten gesetzt, sondern am Ende des Buches als Endnoten gesammelt. Das erschwert die Arbeit mit ihnen wiederum deutlich.
Einige Kapitel sind mit Überschriften versehen, in denen thematisch etwas ganz anderes zur Sprache kommt, als die Überschrift erhoffen lässt. Es gibt bei Veyne zahlreiche Wiederholungen von Aussagen, was ein Hinweis darauf ist, dass er sein Buch nicht hinreichend durchstrukturiert hat.
Der deutsche Übersetzer hat einige Fehler begangen. So schreibt er z.B. Titus-Livius und Sextus-Empiricus mit Bindestrich. Euhemeros wird zu Ephemerios – wie ephemer? – und Euhemerismus zu Ephemerismus. Auf S. 138 wurde statt mit DNA mit ADN übersetzt.
Wertvolle Gedanken
Es gibt auch einige wenige wertvolle Gedanken in Paul Veynes Büchlein. Die Frage, woher der Brauch kam, seine Quellen anzugeben, wird mit der Kontroverse beantwortet (S. 22 f.). Die Konkurrenzsituation ist es, die den Autor zwingt, seine Belege anzugeben. Das ist auch ganz mein Gedanke zu Herodot: Herodot war deshalb nicht konsequent in der Anwendung seiner Methode (zu der allerdings mehr gehört als nur Quellen anzugeben), weil er noch außer Konkurrenz stand. Thukydides verzichtet allerdings noch weit mehr auf Quellenangaben.
Das Wissen darum, dass man etwas wissen kann, genügt bereits, um dorthin zu gelangen (S. 112). D.h. es gibt zumindest im Prinzip kein unerreichbares Wissen, das nur Privilegierten und Eingeweihten offensteht. – Der Zweck eines Studiums besteht nicht nur darin, die Inhalte eines Fachs zu lernen, sondern auch darin, den Autoritätsglauben bezüglich dieses Faches abzulegen (S. 114). Im Idealfall ja. – Schließlich der Gedanke, dass die Naturwissenschaften grundsätzlich auch nicht seriöser sind wie die Geisteswissenschaften, weil der Umgang mit „Fakten“ kein Erkenntnisprivileg bedeutet, denn auch Fakten müssen interpretiert werden (S. 139).
Schluss
Dies ist ein richtig schlechtes Buch, das das gewählte Thema nicht nur für die Darlegung einer abseitigen Ideologie missbraucht, sondern auch das Thema selbst schlecht darstellt. Statt etwas über Mythen zu erfahren, wird der Leser im Laufe der Lektüre immer tiefer in eine ideologische Wahnwelt verstrickt und hat das Gefühl, einer Gehirnwäsche unterzogen zu werden. Im Grunde ist es geradezu frech, was Paul Veyne hier vorgelegt hat. Es ist gewissermaßen das Paradebeispiel für ein Produkt der Geisteswissenschaften, das diese wie „Geschwätzwissenschaften“ aussehen lässt. Paul Veyne ist bestallter Professor und wird vom Steuerzahler bezahlt – da hätte man sich etwas mehr Ernsthaftigkeit und Qualität schon erwarten können. Fehlt Paul Veyne der Bezug zu den arbeitenden Menschen, die seinen Posten finanzieren?
Fast kann Paul Veyne einem leid tun. Was für ein Selbstbild muss ein Mensch haben, der die Welt so zynisch sieht, dass Vernunft und Wahrheit und Moral absolut gar nichts zählen, sondern nur und ausschließlich Zufälle, Interessen und der Wille der Macht? Oder ist Paul Veyne ein Blender? Müssen wir dieses Machwerk als den „Willen zur Macht“ und als das „Interesse“ von Paul Veyne interpretieren? Oder ist es beides: Paul Veyne glaubt diese Dinge wirklich, aber er hat sie zugleich auch erfunden. Im Sinne der Ideologie dieses Büchleins wird es wohl beides sein, so wie Paul Veyne es auch von Hesiod glaubt (S. 42). Wir erinnern erneut an die oben gezogene Parallele zu Erich von Däniken.
Da ist es tröstlich, wenn wir in diesem Büchlein wenigstens Spuren finden, die uns erahnen lassen, dass Paul Veyne nicht ungebrochen an den Unfug glaubt, den er uns hier aufgetischt hat. Diese Spuren könnten Ansätze zur Heilung von Paul Veyne sein, damit die Einsicht in ihm wächst, dass er auf dem Holzweg ist, und dass sein Büchlein leider nur den Geist der Holzsprache atmet. Wir erwarten Paul Veyne zurück auf dem Pfad der Menschlichkeit, der Vernunft und der ewigen Suche nach der einen Wahrheit.
* * *
Die genannten Seitenzahlen beziehen sich auf die deutsche Ausgabe.
Bewertung: 1 von 5 Sternen.
(Erstveröffentlichung auf Atlantis-Scout im September 2020)
Bibliographie und externe Links
Paul Veyne, Glaubten die Griechen an ihre Mythen? Ein Versuch über die konstitutive Einbildungskraft, übersetzt von Markus May, Edition Suhrkamp, Frankfurt am Main 1987. Original: Les Grecs ont-ils cru à leurs mythes? Essai sur l’imagination constituante, Éditions du Seuil, Paris 1983. Englisch: Did the Greeks believe in their Myths? An essay on the Constitutive Imagination, translated by Paula Wissing, The University of Chicago Press, Chicago / London 1988.
Französische Originalversion, teilweise zugänglich:
https://books.google.de/books?id=ZX6BAAAAQBAJ&pg=PT1
Englische Version, teilweise zugänglich:
https://books.google.de/books?id=EpbZLRPGgBsC&hl=de&pg=PP1
Deutsche Version, nicht zugänglich:
https://books.google.de/books?id=q3iYAAAACAAJ
Bernd Goebel / Fernando Suárez Müller, Postmodernismus: Status quo einer philosophischen Strömung. Einleitung – Überblick der Beiträge, in: Bernd Goebel / Fernando Suárez Müller (Hrsg.), Kritik der postmodernen Vernunft – Über Derrida, Foucault und andere zeitgenössische Denker, Wissenschaftliche Buchgesellschaft Darmstadt WBG, Darmstadt 2007; S. 7-28.
Simon Goldhill, Review of: Paul Veyne, Did the Greeks Believe in their Myths? An Essay on the Constitutive Imagination, translated by Paula Wissing, University of Chicago Press, 1988, in: The Classical Review Vol. 40 Issue 1 (April 1990); S. 172.
Wikipedia:
https://de.wikipedia.org/wiki/Paul_Veyne
books & ideas: The Curious Monsieur Veyne
https://booksandideas.net/The-Curious-Monsieur-Veyne.html